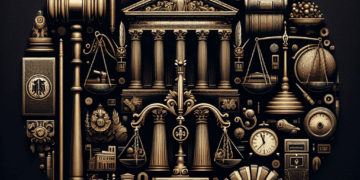Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Definition und Rechtliche Grundlagen
Die übliche Vergütung ist ein zentrales Rechtsinstitut im deutschen Vertragsrecht, das in § 612 und § 632 BGB verankert ist. Sie beschreibt die Vergütung, die nach allgemeiner Auffassung der beteiligten Kreise für eine vergleichbare Leistung zur Zeit des Vertragsschlusses am Ort der Leistungserbringung gewährt zu werden pflegt.
Wichtigste Punkte
- Die übliche Vergütung ist im deutschen Vertragsrecht in § 612 und § 632 BGB verankert.
- Sie dient als Auffangtatbestand, wenn keine ausdrückliche Vergütungsvereinbarung getroffen wurde.
- Die Bestimmung beruht auf Branchenstandards, regionalen Besonderheiten und Marktüblichkeiten.
- Die übliche Vergütung gilt in Werk-, Dienst- und Arbeitsverträgen.
- Sie ist besonders wichtig bei Gefälligkeitshandlungen und unklaren Vertragsverhältnissen.
- Digitale Technologien und Künstliche Intelligenz revolutionieren traditionelle Vergütungsmodelle.
- Die Rechtswissenschaft muss sich an neue Arbeits- und Wirtschaftsformen anpassen.
Rechtlich dient die übliche Vergütung als Auffangtatbestand, wenn keine ausdrückliche Vergütungsvereinbarung getroffen wurde. Sie sichert, dass Leistungen nicht unentgeltlich erbracht werden müssen, wenn nach den Umständen eine Vergütung zu erwarten ist. Die Bestimmung erfolgt durch Berücksichtigung branchenspezifischer, regionaler und zeitlicher Faktoren.
Ermittlung und Bestimmungskriterien
Die Ermittlung der üblichen Vergütung erfolgt nach mehreren Kriterien. Wesentlich sind Branchenstandards, regionale Besonderheiten und vergleichbare Leistungen zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses. Tarifverträge, Branchenrichtlinien und Marktüblichkeiten dienen als Referenzrahmen.
Bei der Bewertung werden Faktoren wie Qualifikation, Leistungsumfang und wirtschaftliche Rahmenbedingungen berücksichtigt. Die Rechtsprechung prüft im Einzelfall, ob eine Vergütung den Grundsätzen von Treu und Glauben entspricht. Fehlt eine taxmäßige Vergütung, gilt die übliche Vergütung als vereinbart.
Rechtliche Wirkungen und Anwendungsbereiche
Die übliche Vergütung findet Anwendung in verschiedenen Vertragstypen, insbesondere im Werk-, Dienst- und Arbeitsvertragsrecht. Im Werkvertragsrecht nach § 632 BGB gilt sie als Auffangtatbestand bei fehlender Vergütungsvereinbarung. Im Dienstvertragsrecht nach § 612 BGB sichert sie eine angemessene Vergütung für Dienstleistungen.
Besondere Bedeutung hat die übliche Vergütung bei Gefälligkeitshandlungen und unklaren Vertragsverhältnissen. Sie verhindert, dass Leistungen grundsätzlich unentgeltlich erbracht werden müssen. Die Rechtsprechung entwickelt kontinuierlich Kriterien zur Bestimmung der Üblichkeit.
Digitale Transformation und Vergütungsmodelle
Digitale Technologien verändern traditionelle Vergütungsmodelle. Blockchain und Smart Contracts ermöglichen neue Formen der Leistungsbewertung. Künstliche Intelligenz kann objektive Bewertungskriterien entwickeln.
Internationale Wirtschaftsbeziehungen erfordern flexible Vergütungskonzepte. Die Rechtsprechung muss sich kontinuierlich an technologische Innovationen anpassen. Neue Arbeitsformen wie Crowdworking stellen klassische Vergütungsmodelle in Frage.
Zukunftsperspektiven
Die Entwicklung der üblichen Vergütung wird durch technologische und gesellschaftliche Veränderungen geprägt. Interdisziplinäre Ansätze werden erforderlich, um faire Vergütungsmodelle zu entwickeln. Die Rechtswissenschaft steht vor der Herausforderung, traditionelle Konzepte an neue Arbeits- und Wirtschaftsformen anzupassen.