Achtung mit Black Friday Werbung!
Diese Woche geht es wieder los. Gefühlt jeder Händler hat eine Rabattaktion mit irgendwie mit der Farbe "Schwarz" assoziiert wird....
Mehr lesenDetailsIn der Frühphase eines Start-ups fehlt es oft an Liquidität, um markgehrechte Gehälter zu zahlen. Deshalb setzen viele Gründer auf Mitarbeitendenbeteiligung nach dem Prinzip Work for Equity – also Arbeit gegen Unternehmensanteile. Dabei werden Mitarbeiter am zukünftigen Erfolg beteiligt, sei es durch echte Geschäftsanteile oder virtuelle Versprechen, anstatt (oder neben) sofortiger Gehaltszahlung. Dieses Modell verspricht, talentierte Fachkräfte trotz knapper Kassen zu gewinnen und langfristig zu binden. Allerdings wirft Work for Equity komplexe rechtliche Fragen auf, da es an der Schnittstelle von Arbeitsrecht und Gesellschaftsrecht liegt. Zugleich stellt sich die Frage der Fairness: Unter welchen Bedingungen ist Mitarbeitendenbeteiligung ein faires Angebot und wann gerät sie zur einseitigen Risikoabwälzung auf Early Employees? Im Folgenden werden Chancen, Risiken und konkrete Gestaltungsformen wie Vesting (bzw. Reverse Vesting) und Anti-Dilution-Klauseln ausführlich beleuchtet. Dabei wird die Abgrenzung zwischen arbeitsrechtlichen Pflichten, gesellschaftsrechtlichen Vorgaben und unternehmerischen Konzepten (z.B. Slicing the Pie) herausgearbeitet. Auch unterschiedliche Beteiligungsformen (virtuelle vs. echte Anteile, monetäre Beteiligungen) und ihre vertragliche Umsetzung – inklusive typischer Klauseln und aktueller Rechtsprechung – werden dargestellt. Ziel ist ein juristisch fundierter Überblick, der insbesondere Start-ups in Deutschland hilft, Work for Equity rechtssicher und fair zu gestalten. Steuer- und sozialversicherungsrechtliche Aspekte werden nur am Rande erwähnt.
Die Mitarbeitendenbeteiligung kann auf verschiedene Weisen erfolgen. Grundsätzlich lassen sich drei Hauptformen unterscheiden:
In der Praxis kombinieren Start-ups oft diese Modelle. Zum Beispiel kann ein Schlüsselmitarbeiter einen geringeren Lohn plus VSOP erhalten, während ein Mitgründer echte Anteile hält. Welche Beteiligungsform passt, hängt vom Ziel des Start-ups und der jeweiligen Position des Mitarbeiters ab. Oft sind VSOP-Programme auf einen Exit ausgerichtet, während echte Anteile eine laufende Gewinnbeteiligung ermöglichen. Angesichts der genannten Vor- und Nachteile entscheiden sich die meisten deutschen Start-ups derzeit für virtuelle Anteile (VSOP) und gegen echte Mitarbeiteraktien, auch weil dies steuerlich und administrativ bis vor kurzem die einzig praktikable Lösung war. Dennoch gewinnen echte Beteiligungsprogramme – etwa über Aktienoptionen – an Attraktivität, zumal neue Gesetze hierfür Erleichterungen schaffen (siehe unten zum Zukunftsfinanzierungsgesetz).
Eine Mitarbeitendenbeteiligung bietet in der Theorie Vorteile für alle Seiten. Gleichzeitig birgt sie aber Risiken und Nachteile, die in der Praxis sorgfältig abgewogen werden müssen.
Zusammenfassend bietet Work for Equity große Chancen – insbesondere als Wettbewerbsvorteil im „War for Talent“ – birgt aber auch erhebliche Risiken für beide Seiten. Eine ehrliche Aufklärung über Chancen und Risiken ist essenziell, damit alle Beteiligten informierte Entscheidungen treffen können. Im nächsten Schritt soll geklärt werden, welche rechtlichen Rahmenbedingungen beim Einsatz von Work for Equity in Deutschland unbedingt beachtet werden müssen.
Work for Equity wirft insbesondere Fragen der Abgrenzung zwischen Arbeitsverhältnis und Gesellschafterstellung auf. Einerseits wird Arbeitsleistung erbracht, andererseits soll hierfür (teilweise) keine Geldvergütung, sondern eine Kapitalbeteiligung fließen. Dies berührt zentrale arbeitsrechtliche Schutznormen ebenso wie gesellschaftsrechtliche Vorgaben zur Beteiligungsstruktur. Im Folgenden werden die wichtigsten Rahmenbedingungen skizziert.
Arbeitsentgelt und Mindestlohn: Grundsätzlich gilt: Arbeitnehmer haben einen gesetzlichen Anspruch auf Vergütung. Ein Arbeitsvertrag, der keine oder eine unverhältnismäßig geringe Vergütung vorsieht, verstößt gegen den Kern des Arbeitsrechts (§ 611a Abs.1 BGB verlangt die Vereinbarung einer Vergütung) und ggf. gegen gute Sitten (§ 138 BGB). Insbesondere ist in Deutschland der gesetzliche Mindestlohn zu beachten (derzeit 12 € pro Stunde, Stand 2023). Das Mindestlohngesetz (MiLoG) gilt für alle Arbeitnehmer – auch in Start-ups gibt es keine Ausnahme, wonach man Gehalt einfach durch Equity ersetzen dürfte. Jede Unterschreitung des Mindestlohns macht den Arbeitgeber haftbar; die Differenz kann vom Mitarbeiter eingefordert werden, ein Verzicht ist gesetzlich ausgeschlossen. Ein Vertrag, der reine Unentgeltlichkeit vorsieht, wäre daher nach § 134 BGB nichtig, soweit er gegen MiLoG verstößt. Nur in engen Ausnahmefällen kann von der Lohnpflicht abgewichen werden, nämlich wenn die Person nicht als Arbeitnehmer im arbeitsrechtlichen Sinn gilt. So sind etwa Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH keine Arbeitnehmer und haben folglich auch keinen gesetzlichen Mindestlohnanspruch . Ein Gründer, der zugleich Geschäftsführer und (Mit-)Eigentümer ist, darf sich also formal selbst ein geringes oder null Euro Gehalt zahlen, ohne gegen MiLoG zu verstoßen. Gleiches gilt für echte Mitunternehmer (z.B. Partner in einer Personengesellschaft), die kraft ihrer Beteiligungsstellung kein abhängiges Beschäftigungsverhältnis haben. Allerdings ist hier Vorsicht geboten: Nicht jede Bezeichnung als „Partner“ oder „Mitgründer“ schützt vor der Einordnung als Arbeitnehmer, wenn die tatsächlichen Umstände eine persönliche Abhängigkeit nahelegen. Man spricht dann von Scheinselbständigkeit oder Scheinarbeitsverhältnis. Gerade wenn jemand nur einen kleinen Anteil hält, keine Sperrminorität und keine Leitungsfunktion hat, aber vollzeit wie ein normaler Angestellter für das Start-up arbeitet, besteht das Risiko, dass Gerichte ihn dennoch als Arbeitnehmer betrachten – mit der Folge, dass sämtliche Arbeitnehmerschutzgesetze (Kündigungsschutz, Urlaubsansprüche, MiLoG etc.) greifen und die Equity-Vereinbarung im Konfliktfall als Umgehung behandelt werden könnte. Diesem Risiko versucht man in der Praxis zu begegnen, indem echte Equity-Deals meist nur mit Kernteam-Mitgliedern gemacht werden, die entweder selbst Gründerstatus haben oder zumindest zusätzlich ein angemessenes Fixgehalt beziehen. Rein auf Equity basierende Mitarbeit ist in Deutschland im Grunde nur bei Organpersonen oder echten Gesellschaftern zulässig. Zu beachten ist außerdem, dass bei einem Mitarbeiter im Gegenzug für Gehaltsverzicht gewährter Gesellschaftsanteil arbeitsrechtlich als Teil der Vergütung gelten kann – etwaige spätere Entfernung dieses Anteils (etwa durch Entzug bei Kündigung) könnte dann als Lohnkürzung oder Vertragsstrafe gewertet werden, wenn keine wirksame Vereinbarung vorliegt. Arbeitsrecht und dispositives Gesellschaftsrecht treffen hier aufeinander, weshalb die Verträge sehr sorgfältig austariert sein müssen.
Arbeitszeit und Sozialversicherung: Auch wenn das Hauptaugenmerk auf dem Lohn liegt, verdienen einige Randaspekte Erwähnung. Ein Mitarbeiter, der für Equity arbeitet, ist in der Regel trotzdem sozialversicherungspflichtig (außer er wird als selbständiger Berater o.ä. geführt, was aber das Risiko der Scheinselbständigkeit birgt). Die Abführung von Sozialabgaben bemisst sich mangels Gehalt dann ggf. an einer fiktiven Größe oder am Mindestlohn. Zudem gelten Arbeitszeitgesetze, Urlaubsansprüche usw. unverändert. Das Startup kann also nicht argumentieren, der Mitarbeiter arbeite ja „freiwillig“ länger ohne Gehalt – Überstundenregelungen bleiben anwendbar. Insgesamt sind die arbeitsrechtlichen Schutzvorschriften zwingend: Sie lassen sich nicht dadurch abbedingen, dass man dem Mitarbeiter Anteile gibt. Daher muss ein Work-for-Equity-Modell immer arbeitsrechtskonform gestaltet sein – entweder indem man den Status des Mitarbeiters ändert (zum Mitgesellschafter macht, siehe oben) oder indem man ihm zumindest den Mindestlohn zahlt und die Beteiligung zusätzlich gewährt.
Formvorschriften und Kapitalmaßnahmen: Sobald echte Gesellschaftsanteile ins Spiel kommen, greift das Gesellschaftsrecht – in Start-ups typischerweise das GmbH-Recht (GmbHG) oder seltener Aktienrecht (AktG). Bei einer GmbH ist zu beachten, dass die Übertragung von Geschäftsanteilen nach § 15 GmbHG notarieller Beurkundung bedarf. Das bedeutet, dass jeder Mitarbeiter, der einen GmbH-Anteil erhalten soll, entweder in den Gründungsakt einbezogen oder später per notariell beurkundetem Abtretungsvertrag am Unternehmen beteiligt werden muss. Alternativ kann auch eine Kapitalerhöhung durchgeführt werden, bei der neue Anteile geschaffen und vom Mitarbeiter übernommen werden – auch dies erfordert notarielle Protokollierung des Gesellschafterbeschlusses und die Eintragung im Handelsregister. Praktisch ist es aufwändig (und teuer), viele kleine Beteiligungen in einer GmbH abzubilden. Zudem haben alle Gesellschafter bestimmte Rechte nach dem GmbHG, die man nicht ohne Weiteres ausschließen kann. So steht jedem Gesellschafter ein Informations- und Einsichtsrecht nach § 51a GmbHG zu, und wichtige Beschlüsse (z.B. Änderung des Gesellschaftsvertrags, Kapitalerhöhungen, Verkauf des Unternehmens) erfordern qualifizierte Mehrheiten (75% nach § 53 II GmbHG). Zahlreiche Kleinbeteiligte können also zumindest theoretisch die Beschlussfassung verkomplizieren – etwa wenn einzelne nicht auffindbar sind oder wider Erwarten doch gegen Maßnahmen stimmen. Aus diesen Gründen wird bei echten Anteilen oft versucht, die Mitspracherechte der Mitarbeiter vertraglich zu beschränken, z.B. indem ihre Stimmrechte im Gesellschaftsvertrag ruhen oder auf bestimmte Kernrechte reduziert werden. Allerdings stößt dies an Grenzen des Gesetzes und muss sehr sorgfältig formuliert sein (um nicht als Knebelung unwirksam zu werden). Einfacher ist es meist, Mitarbeiter ohne Stimmrecht zu beteiligen (etwa über stille Beteiligungen oder Genussrechte), was aber wiederum weniger attraktiv sein kann.
Aktiengesellschaft vs. GmbH: Einige Start-ups erwägen, sich gleich als AG (oder europäische SE) aufzusetzen, da das Aktienrecht flexiblere Instrumente für Mitarbeiterbeteiligungen bietet. Insbesondere können Aktienoptionen über sogenanntes bedingtes Kapital ermöglicht werden: Das Unternehmen schafft in der Satzung einen Topf an potenziellen Aktien, die an Mitarbeiter ausgegeben werden dürfen, ohne jedes Mal eine HV-Entscheidung herbeiführen zu müssen. Durch das 2023 geplante Zukunftsfinanzierungsgesetz soll diese Grenze für bedingtes Kapital von 10% auf 20% des Grundkapitals erhöht werden, was ESOP-Programme deutlich erleichtert. Bei Aktien können Mitarbeiter auch einfacher zu einem späteren Zeitpunkt einsteigen, da die Übertragung (jedenfalls vinkulierter Namensaktien) keiner notariellen Form bedarf, sondern schlicht durch Indossament/Vertrag möglich ist. Allerdings bringt die Rechtsform der AG in der Frühphase auch Nachteile: Sie erfordert ein hohes Grundkapital (50.000 €), laufende Publizitäts- und Formalpflichten (Jahresabschluss im Bundesanzeiger, Hauptversammlung, evtl. Aufsichtsrat ab 3 Personen im Vorstand etc.). Für viele kleine Start-ups ist das Overhead einer AG zu groß. Deshalb wird häufig die Kompromisslösung gewählt: Das Unternehmen bleibt vorerst eine GmbH (oder UG), und die Mitarbeiter bekommen virtuelle Anteile. Wenn das Unternehmen wächst oder einen Exit (Börsengang) anstrebt, kann es später immer noch in eine AG umgewandelt werden, um echte Aktien auszugeben.
Pooling-Strukturen: Um die Nachteile vieler direkter Gesellschafter in den Griff zu bekommen, bedienen sich einige Start-ups eines Tricks: Sie schalten eine Beteiligungsgesellschaft dazwischen, die die Mitarbeiteranteile bündelt. Ein populäres Modell ist die Mitarbeiterbeteiligungs-KG (dazu unten mehr), bei der die Mitarbeiter als Kommanditisten einer GmbH & Co. KG beitreten und diese KG dann als Einheit an der Haupt-GmbH beteiligt ist. Auch Treuhandkonstruktionen sind denkbar, bei denen z.B. ein Treuhänder (etwa ein Rechtsanwalt oder eine Management GmbH) die Anteile treuhänderisch für die Mitarbeiter hält. Solche Pooling-Modelle erleichtern die Verwaltung, da intern (im Pool) relativ flexibel Zu- und Abgänge von Beteiligten geregelt werden können, während extern gegenüber der Hauptgesellschaft nur ein Shareholder auftritt. Wichtig ist in jedem Fall, dass bei mehreren Beteiligten klare Vereinbarungen über Rechte und Pflichten getroffen werden: Dazu zählen insbesondere Vorkaufsrechte, Drag-Along/Tag-Along-Regelungen (Mitverkaufsrechte bzw. -pflichten) sowie Exit- und Bewertungsmodalitäten. Diese werden idealerweise im Gesellschaftsvertrag (bei direkter Beteiligung) oder in einem Beteiligungsvertrag festgeschrieben. Zu bedenken ist auch, dass echte Mitarbeitergesellschafter unter Umständen der unternehmensmitbestimmungsrechtlichen Schwelle näherkommen (Stichwort BetrVG und Schwellenwert Beschäftigtenzahl für Betriebsrat etc.), wobei das in kleinen Start-ups selten relevant wird.
Kombination mit Arbeitsverträgen – Slicing Pie Konzept: Ein besonderes Augenmerk verdient das “Slicing the Pie”-Konzept, das in jüngerer Zeit auch in Deutschland Aufmerksamkeit erlangt hat. Hierbei handelt es sich um ein dynamisches Beteiligungsmodell, bei dem Beteiligungsquoten nach tatsächlich geleisteten Beiträgen (Arbeitszeit, eingebrachtes Geld, Sachleistungen etc.) fortlaufend angepasst werden. Es ist quasi ein Zeitkonto: Jeder, der für das Projekt arbeitet oder investiert, sammelt „Slices“ (Punkte), und die relative Anzahl dieser Punkte bestimmt zu jedem Zeitpunkt den Anteil am Unternehmen. Dieses System soll eine perfekt faire Equity-Verteilung gewährleisten, da sie sich nach den jeweiligen Risiko-Beiträgen richtet. Juristisch bewegt man sich dabei jedoch auf dünnem Eis. In der Praxis werden Slicing-Pie-Modelle häufig durch eine Mischung aus Vorgründungsgesellschaft (GbR) und späterer Übertragung der Anteile umgesetzt. Beispielsweise schließen mehrere Personen einen Vertrag, der vorsieht, dass zunächst als GbR zusammengearbeitet wird und jeder gemäß der Slicing Pie-Formel einen relativen Anteil erwirbt. Sobald ein bestimmter Meilenstein erreicht ist (z.B. Marktreife oder erste Finanzierung), wird die bis dahin erarbeitete Verteilung „eingefroren“ und in echte Anteile einer neu zu gründenden Kapitalgesellschaft umgewandelt. Solche Verträge kombinieren Elemente des Arbeitsvertrags, Gesellschaftsvertrags und sogar Lizenzvertrags (wenn etwa an eingebrachten Ideen/IP Rechteeinräumungen erfolgen). Die Herausforderung ist, dass bis zur formellen Gründung einer Gesellschaft rechtlich oft eine GbR entsteht – was bedeutet, dass alle Beteiligten persönlich haften könnten. Zudem besteht das Risiko, dass die Behörden diese Konstruktionen als Umgehung eines regulären Arbeitsverhältnisses werten, insbesondere wenn eigentlich ein Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis vorliegt. Die deutschen Gesetze gegen Scheinselbständigkeit und illegale Beschäftigung wurden zuletzt 2019 nochmals verschärft. Entsprechend vorsichtig muss man Slicing-Pie-Verträge gestalten: Es sollte klar sein, dass alle Beteiligten Mitgründer auf eigenes Risiko sind, sonst drohen im Nachhinein Beiträge zur Sozialversicherung oder Lohnnachzahlungen. Oft werden solche Modelle in einer frühen, pre-seed Phase genutzt und enden, sobald Investoren einsteigen – ab dann gelten wieder starre Beteiligungsquoten. Insgesamt bietet Slicing Pie zwar maximale Flexibilität, aber zahlreiche rechtliche Fallstricke im Arbeits-, Sozialversicherungs- und Gesellschaftsrecht. Ohne qualifizierte Rechtsberatung sollte ein solcher Vertrag nicht aufgesetzt werden, da die Haftungsrisiken erheblich sind. In Deutschland bewegt man sich hier in einer Grauzone zwischen vorweggenommener Gesellschaftsgründung und bogus employment. Daher bleibt dieses Konzept (noch) eine Ausnahmeerscheinung, während in den USA – wo arbeitsrechtlich vieles liberaler gehandhabt wird – Slicing Pie populärer ist.
Die erfolgreiche Implementierung von Mitarbeitendenbeteiligung steht und fällt mit einer sauberen vertraglichen Gestaltung. Dabei sind einerseits individuelle Lösungen gefragt, andererseits haben sich gewisse Standardklauseln etabliert, um typische Szenarien zu regeln. Im Folgenden werden einige der wichtigsten Vertragsmechanismen erläutert:
Vesting (vom engl. to vest = erwerben, reifen) bezeichnet das Konzept, dass Anteile erst über einen gewissen Zeitraum “verdient” werden müssen. Anstatt dass ein Mitarbeiter sofort endgültig 5% am Unternehmen hält, wird vereinbart, dass er diesen Anteil nur behält, wenn er z.B. mindestens vier Jahre im Unternehmen bleibt. Üblich sind Vesting-Zeiträume von 3–5 Jahren, oft mit einer Cliff-Periode zu Beginn (z.B. 1 Jahr), während der noch nichts unverfallbar ist. Erst nach Ablauf der Cliff vestet ein erster Block (z.B. 25% nach 1 Jahr) und danach der Rest anteilig monatlich oder quartalsweise. Verlässt der Mitarbeiter vor Ablauf der Vesting-Periode das Unternehmen, verfallen die noch nicht gevesteten Anteile – er behält also nur den bereits erworbenen Prozentsatz. Ziel ist es, einen Anreiz zur langen Bindung zu schaffen und gleichzeitig das Unternehmen zu schützen: Wer früh geht, soll nicht genauso profitieren wie jemand, der jahrelang aufgebaut hat. Vesting ist im Silicon Valley seit Jahrzehnten Standard und hat auch in Deutschland Einzug gehalten, insbesondere bei VSOP-Plänen (dort „verdient“ der Mitarbeiter seine virtuellen Anteile über die Zeit). Für Gründer und Investoren ist Vesting nahezu unverzichtbar, um das „Worst-Case“-Szenario zu vermeiden, dass ein Mitgründer oder Early Employee mit großem Anteil ausscheidet und dem Unternehmen nichts als ein Motivationsloch hinterlässt.
Reverse Vesting wendet das Prinzip speziell auf Gründer an. Da Gründer in aller Regel zu Beginn 100% der Anteile unter sich aufteilen (bevor Mitarbeiter und Investoren dazukommen), kann man ihnen die Anteile nicht stückweise erst noch zuteilen. Stattdessen erhalten alle Gründer beim Start ihre Anteile vollumfänglich, verpflichten sich aber im Gesellschaftervertrag, diese Anteilsrechte rückwirkend zu verlieren oder zurückzugeben, falls sie vor Ablauf der Vestingfrist ausscheiden. Praktisch geschieht dies meist über Call-Optionen zugunsten der Mitgründer oder der Gesellschaft: Scheidet ein Gründer frühzeitig aus (z.B. Kündigung des Geschäftsführer-Anstellungsvertrags innerhalb von 36 Monaten), dann haben die verbleibenden Gesellschafter das Recht, ihm einen definierten Teil seiner Anteile zum Nominalwert oder geringen Preis abzukaufen. So schrumpft sein Anteil entsprechend der nicht „abgesessenen“ Vestingzeit. Dieses Vorgehen stellt sicher, dass auch unter Gründern Fairness herrscht – wer weniger beiträgt (weil er früh geht), hält am Ende weniger Anteile. Für Investoren ist eine solche Klausel oft Bedingung beim Einstieg. Reverse Vesting-Klauseln müssen jedoch sorgfältig formuliert sein, um rechtlich haltbar zu sein (siehe unten zur Problematik des Hinauskündigungsverbots).
Good Leaver/Bad Leaver: In der Praxis werden Vesting-Regeln häufig mit Leaver-Klauseln kombiniert. Diese unterscheiden die Gründe des Ausscheidens. Ein Bad Leaver ist z.B. jemand, der aus eigenem Antrieb kündigt oder aus wichtigem Grund (verhaltensbedingt) gefeuert wird. Ein Good Leaver hingegen scheidet z.B. wegen langer Krankheit, Tod, betriebsbedingter Kündigung oder auf neutralem Weg (einvernehmlich nach Ablauf einer bestimmten Zeit) aus. Je nach Fall werden unterschiedliche Rechtsfolgen vereinbart: Ein Bad Leaver verliert oft auch bereits vestete Anteile (oder muss sie zum Nominalwert zurückgeben), während ein Good Leaver zumindest den erworbenen Anteil behalten oder zu Marktkonditionen abfinden lassen darf. Diese Differenzierung soll verhindern, dass jemand sich illoyal verhält und dennoch belohnt wird, oder umgekehrt soll fair sein, wer unverschuldet geht. Allerdings können zu strenge Bad-Leaver-Klauseln, die einen Mitarbeiter über Gebühr bestrafen, in AGB-Kontrollen der Arbeitsgerichte als unwirksam eingestuft werden (Stichwort: unverhältnismäßige Vertragsstrafe). Hier ist Augenmaß geboten.
Rechtliche Zulässigkeit von Vesting: Eine kritische juristische Hürde für Vesting-Klauseln bei echten Anteilen ist das sogenannte Hinauskündigungsverbot im Gesellschaftsrecht. Nach gefestigter Rechtsprechung des BGH dürfen Gesellschafter einer GmbH nicht ohne weiteres durch Mehrheitsbeschluss aus der Gesellschaft gedrängt werden, nur weil z.B. das Anstellungsverhältnis endet. Die Gesellschafterstellung ist rechtlich unabhängig vom Arbeitsvertrag – ein Ende der Mitarbeit rechtfertigt nicht automatisch den Entzug der Eigentümerposition. Vesting läuft aber im Kern darauf hinaus, Anteile „verfallen“ zu lassen, wenn jemand nicht mehr mitarbeitet. Hier kollidieren die investor-freundlichen Vesting-Vereinbarungen mit dem Schutz des GmbH-Gesellschafters. Lange Zeit war unklar, ob und wie Vesting in deutschen Gesellschaftsverträgen wirksam vereinbart werden kann. Die Lösung liegt in einer vertraglichen Ausgestaltung als Optionsrecht statt als automatischer Verfall. D.h. der betreffende Gesellschafter erhält zunächst alle Anteile, verpflichtet sich aber vertraglich, im Austrittsfall ein Angebot zum Rückkauf der (unvesteten) Anteile zu einem vorher festgelegten niedrigen Preis abzugeben (bzw. ein solches Angebot der Mitgesellschafter anzunehmen). Technisch wird so kein einseitiger „Hinauswurf“ durchgeführt, sondern ein im Voraus vertraglich geregelter Erwerbsvorgang. Diese Konstruktion kann dennoch problematisch sein, insbesondere wenn der ausscheidende Gründer eigentlich schon erhebliche Leistungen erbracht hat und dann praktisch leer ausgeht. Die Diskussion erreichte 2024 einen neuen Meilenstein: Das Kammergericht Berlin hat in einem Hinweisbeschluss vom 12.08.2024 (Az. 2 U 94/21) angedeutet, Vesting-Regelungen in Startups großzügiger zu beurteilen. Es schuf neuen Spielraum dahingehend, dass unter bestimmten Voraussetzungen ein solcher Anteilsentzug vereinbar mit der gesellschaftsrechtlichen Treuepflicht sein kann, ohne gegen die BGH-Doktrin zu verstoßen. Konkret ging es in dem Fall um eine Vereinbarung zwischen Gründern, die wechselseitige Kauf- und Verkaufsangebote im Ausscheidensfall vorsah – diese wurde vom KG als zulässig erachtet. Dennoch bleibt Vorsicht geboten: Die genaue Wirksamkeit hängt von der ausgewogenen Gestaltung im Einzelfall ab, und höchstrichterliche Klarheit vom BGH steht noch aus. In der Praxis sollten Vesting-Klauseln immer mit guter Begründung versehen sein (Schutz eines legitimen Unternehmensinteresses) und dem Ausscheidenden zumindest einen angemessenen Ausgleich für bereits geleistete Beiträge belassen, um einer gerichtlichen Inhaltskontrolle standzuhalten.
Anti-Dilution-Klauseln dienen dem Schutz eines Anteilseigners vor Wert- oder Quotenverlust durch spätere Kapitalmaßnahmen. Im Venture-Capital-Kontext sind solche Klauseln zugunsten von Investoren üblich – etwa in Form von Full Ratchet (Investoren werden im Down-Fall so gestellt, als hätten sie zum niedrigen neuen Preis investiert) oder Weighted Average (Anpassung der Preisbasis nach Durchschnittswert). Für Mitarbeiterbeteiligungen hingegen werden Verwässerungsschutzrechte fast immer ausgeschlossen . Der Grund liegt auf der Hand: Start-ups müssen flexibel neues Kapital aufnehmen können, ohne mit jedem virtuellen Anteilseigner Nachverhandlungen führen zu müssen. Würde man Mitarbeitern garantieren, stets bei Kapitalerhöhungen mitzuziehen oder kompensiert zu werden, würde dies Investoren abschrecken und die Altgesellschafter zusätzlich verwässern. Daher ist in VSOP-Verträgen regelmäßig geregelt, dass eine Ausgabe neuer Anteile an Investoren die relative Beteiligungsquote der Mitarbeiter entsprechend reduziert, ohne Ausgleich (Virtuelle Mitarbeiterbeteiligung in Startups). Für den Mitarbeiter bedeutet dies, dass sein prozentualer Anteil am Exit-Erlös sinken kann, wenn zwischenzeitlich neue Finanzierungsrunden stattfinden. Beispiel: Hat ein Mitarbeiter Anspruch auf 1% des Exit-Erlöses und es kommt eine Finanzierungsrunde hinzu, die den Altgesellschaftern 20% abnimmt, so sinkt sein Anteil auf 0,8% (sofern keine besonderen Regelungen greifen). Achtung: Nicht jede Kapitalmaßnahme rechtfertigt den vollständigen Verzicht auf Verwässerungsschutz. In extremen Fällen könnte man überlegen, gewisse Maßnahmen abzusichern – z.B. einen Split oder bestimmte Umwandlungen – doch in der Praxis beschränken sich Schutzklauseln meist auf die Investorenseite. Mitarbeiter sollten sich zumindest bewusst sein, dass Investoren bei Down-Rounds häufig ihren eigenen Verwässerungsschutz haben und dadurch die Verlustlast einseitig auf Gründer und Mitarbeiter verschoben wird. Eine faire Gestaltung könnte darin bestehen, dass bei gravierenden Verwässerungen ggf. zusätzliche virtuelle Anteile an Mitarbeiter ausgegeben werden, um die Motivation aufrechtzuerhalten (diese Entscheidung liegt aber im Ermessen der Geschäftsführung und der Gesellschafterversammlung). In Summe gilt: Anti-Dilution-Klauseln sind in Work-for-Equity-Deals eher die Ausnahme. Stattdessen wird zu Beginn oft ein ausreichend großer Pool an Mitarbeiteranteilen definiert (z.B. 10% des Kapitals), der dann auf mehrere Mitarbeiter verteilt wird, wodurch zukünftige Verwässerungen für alle diese Anteile gemeinsam wirken.
Exit-Regelungen und Liquidationspräferenzen: Mitarbeiterbeteiligungsverträge – insbesondere VSOP – sollten klar definieren, wie die Berechnung der Beteiligung im Exit-Fall erfolgt. Häufig orientiert sich der Zahlungsanspruch an dem Netto-Verkaufserlös nach Abzug bestimmter Kosten und Liquidationspräferenzen der Investoren. Investoren erhalten in Beteiligungsverträgen oft Vorab-Auszahlungen (Liquidation Preference), z.B. ihr investiertes Kapital plus X% Zinsen, bevor der Rest auf alle verteilt wird. In einem fairen Programm wird diese Reihenfolge auch auf virtuelle Anteile angewendet: D.h. erst wenn die (vertraglich definierten) Erlösvorrechte bedient sind, partizipieren die virtuellen Anteile am verbleibenden Überschuss. Beispiel: Ist vereinbart, dass bei einem Teilverkauf (z.B. 80% des Unternehmens) der Mitarbeiter nur anteilig beteiligt wird, so erhält er in dem Fall 80% seines rechnerischen Anspruchs und bleibt mit 20% virtuell weiter beteiligt. Solche Detailklauseln sind wichtig, um spätere Streitigkeiten zu vermeiden. Auch Abfindungsmechanismen sollten geregelt sein: Manche Programme erlauben es dem Unternehmen, einen Mitarbeiter vor dem Exit auszuzahlen und damit aus dem Programm zu nehmen. Das kann sinnvoll sein, wenn z.B. ein Mitarbeiter vor dem Exit ausscheidet – anstatt ihn bis zum Exit zu „parken“, kann das Unternehmen ihm seinen bis dahin aufgebauten Anspruch abkaufen (Devesting gegen Abfindung). Diese Option sollte aber fair ausgestaltet sein (i.d.R. zum Marktwert der virtuellen Anteile, sofern bestimmbar) und idealerweise nur einseitig vom Mitarbeiter ausübbar sein, damit das Unternehmen nicht kurz vor einem großen Exit die Belegschaft billig herauskauft.
Drag-Along / Tag-Along: Wenn Mitarbeiter echte Anteile halten (sei es direkt oder indirekt über eine KG), müssen Mitverkaufsrechte und -pflichten vereinbart werden. Ein Drag-Along (Mitziehklausel) stellt sicher, dass im Falle eines Unternehmensverkaufs (Share Deal) alle Gesellschafter mitverkaufen müssen, wenn eine definierte Mehrheit dies tut. Ohne Drag-Along könnte ein Minderheitsgesellschafter den Verkauf blockieren, indem er seine Anteile nicht verkaufen will – ein Exit wäre dann gefährdet. Üblicherweise wird festgelegt, dass z.B. die Mehrheit der Gesellschafter (inkl. Investoren) berechtigt ist, die Minderheit zu den gleichen Konditionen in den Verkauf zu zwingen. Für Mitarbeiter schafft das auch Klarheit: Sie wissen, dass sie im Erfolgsfall mit exitieren und nicht als Gesellschafter in einer Firma verbleiben, die verkauft wurde. Im Gegenzug ist ein Tag-Along (Mitverkaufsrecht) relevant, damit Minderheitsgesellschafter gleichbehandelt werden, falls die Mehrheitsgesellschafter ihre Anteile veräußern. In der Praxis bedeutet Tag-Along: Wenn die Gründer/Investoren einen Käufer für ihre Anteile finden, haben die Mitarbeiter das Recht, zu denselben Konditionen ihre kleinen Anteile mit zu verkaufen. So wird verhindert, dass ein Käufer nur die lohnenden großen Pakete kauft und die kleinen Aktionäre zurückbleiben. Bei virtuellen Programmen stellt sich diese Frage nicht direkt, da die Mitarbeiter keine echten Anteile halten – jedoch sollte dort vertraglich geregelt sein, dass im Exit-Fall automatisch die Ansprüche fällig werden und das Programm endet.
Wettbewerbsverbote und Bleibeklauseln: Einige Unternehmen ergänzen Equity-Vereinbarungen um nachvertragliche Wettbewerbsverbote. Gerade bei High-Tech-Start-ups will man verhindern, dass ein Mitarbeiter mit erlangtem Know-how sofort zum Konkurrenten geht. In Deutschland sind solche Klauseln nur gegen Zahlung einer Karenzentschädigung zulässig (§ 74 Abs.2 HGB analog auch für Nicht-Handelsvertreter). Oft stellt sich die Frage, ob die Beteiligung selbst als ausreichende Kompensation für ein Wettbewerbsverbot dienen kann – in der Regel nicht, da die Entschädigung in Geld bemessen sein muss. Dennoch kann man Mitarbeiter auf laufende Wettbewerbsabreden verpflichten (für die Dauer der Zugehörigkeit) und Verstöße mit dem Verlust von Anteilen sanktionieren (z.B. Bad-Leaver-Klausel bei Abwerbeversuchen o.ä.). Solche Klauseln müssen sehr klar definiert und angemessen sein, um nicht als unverhältnismäßig verworfen zu werden.
Vertragsdokumente und Muster: Die Umsetzung erfolgt meist in mehreren Dokumenten. Kern ist entweder der Arbeitsvertrag mit Beteiligungsklausel oder ein separater Beteiligungsvertrag. Bei echten Anteilen wird oft der Gesellschaftsvertrag der GmbH entsprechend ergänzt (durch Vesting-/Vorkaufsrechtsklauseln) und der Mitarbeiter schließt einen Beitrittsvertrag. Bei virtuellen Anteilen gibt es häufig einen Rahmenvertrag (Plan), der die Bedingungen für alle Teilnehmer festlegt, und individuelle Zuteilungsvereinbarungen mit jedem Mitarbeiter. Zahlreiche Musterformulierungen kursieren – etwa vom Bundesverband Deutscher Startups oder aus Veröffentlichungen von Kanzleien. Beispielsweise existieren Standardklauseln für Vesting-Perioden oder Good/Bad Leaver. Dennoch sind Anpassungen meist nötig, um den speziellen Umständen Rechnung zu tragen. Jeder Start-up-Cap Table ist anders, und auch die Position des Mitarbeiters (C-Level vs. einfacher Ingenieur) kann Anpassungen erfordern. Wichtig ist, dass sämtliche getroffenen Abreden schriftlich und möglichst eindeutig fixiert werden. Mündliche Versprechen wie „Du bekommst bei Exit schon deinen Anteil“ sind gefährlich, da sie im Zweifel unverbindlich sind. Ebenso sollte mit Überschneidungen zwischen Arbeits- und Gesellschaftsvertrag umgegangen werden: Wird z.B. die Vesting-Dauer im Arbeitsvertrag genannt, sollte sie im Gesellschaftsvertrag konsistent geregelt sein, um Widersprüche zu vermeiden. Schließlich sollten solche Verträge dynamisch mitwachsen: Wenn neue Investoren an Bord kommen, wollen diese oft Änderungen (etwa Anpassung des Pools). Es empfiehlt sich daher, Klauseln flexibel zu formulieren oder Änderungsmöglichkeiten vorzusehen, damit das Beteiligungsprogramm an neue Gegebenheiten angepasst werden kann, ohne jeden Mitarbeiter separat um Zustimmung bitten zu müssen.
Beim Thema Work for Equity prallen mitunter unterschiedliche Interessen und Perspektiven aufeinander. Es ist hilfreich, die Rolle der einzelnen Beteiligten näher zu betrachten, um typische Konflikte und Lösungen zu verstehen:
Für Gründer ist Mitarbeitendenbeteiligung ein zweischneidiges Schwert. Einerseits bietet sie die Chance, talentierte Mitarbeiter ins Boot zu holen, obwohl man ihnen (noch) kein marktübliches Gehalt zahlen kann. Besonders in Branchen mit Fachkräftemangel kann ein Anteilsangebot den Unterschied machen, ob ein Top-Kandidat zum unbekannten Startup wechselt oder doch ein Angebot von einem Großkonzern annimmt. Auch fördert es die Loyalität: Mitarbeiter mit Equity denken und handeln eher im Unternehmensinteresse, was die Gründer entlastet. Andererseits müssen Gründer bereit sein, ein Stück vom eigenen Kuchen abzugeben. Das erfordert Vertrauen: Vertrauen darin, dass der Mitarbeiter tatsächlich zum Erfolg beiträgt und bleibt, sowie Vertrauen in eine faire Zusammenarbeit. Gründer tun gut daran, ein durchdachtes Beteiligungskonzept zu haben, bevor sie Anteile leichtfertig verteilen. Oft wird empfohlen, von Anfang an einen bestimmten Pool (z.B. 10–15%) für Mitarbeiter einzuplanen und diese Reserve im Cap Table zu berücksichtigen, damit spätere Verwässerungen nicht überraschend kommen. Zudem sollten Gründer darauf achten, selbst Vesting-Regeln einzuhalten, um mit gutem Beispiel voranzugehen: Wenn Investoren sehen, dass auch die Founders Equity vestet, signalisiert das Commitment und Fairness im Team.
Ein potenzieller Konfliktpunkt ist das Machtgefälle: Gründer halten meist den Löwenanteil der Anteile und sitzen am längeren Hebel bei Entscheidungen. Sie sollten vermeiden, Beteiligungen als bloßes Lockmittel zu geben und die Mitarbeiter dann aber von wesentlichen Informationen oder Entscheidungen fernzuhalten. Zwar ist es legitim, die Kontrolle zu behalten, doch transparente Kommunikation ist entscheidend, damit die Beteiligung ihren Zweck erfüllt. In der Praxis heißt das: Regelmäßige Updates zum Unternehmensfortschritt, Einbindung der Mitarbeiter (zumindest informell) in strategische Überlegungen und Wertschätzung ihrer Stellung als Miteigentümer. Gründer müssen auch mit der Komplexität umgehen lernen – anfangs ist Equity ein abstraktes Versprechen, später aber real: Cap Table Management, Verwässerungsrechnungen, Bewertungsfragen für steuerliche Zwecke, all das kommt auf sie zu. Nicht zuletzt tragen Gründer die Verantwortung, dass die rechtlichen Vorgaben eingehalten werden. Versäumnisse (wie ein Verstoß gegen den Mindestlohn oder Fehler in der Vertragsgestaltung) können teuer werden und das junge Unternehmen gefährden. Insgesamt sollten Gründer Work for Equity strategisch einsetzen: Als Investment in die Teamkultur und -bindung, nicht bloß als Notlösung mangels Geld. Wenn Mitarbeiter spüren, dass ihr Beitrag ernst genommen und fair entlohnt wird – auch wenn es „nur“ in Anteilen ist – zahlt sich das in Motivation und Unternehmenswachstum aus.
Investoren beurteilen Mitarbeitendenbeteiligung vor allem unter dem Aspekt der Wertsteigerung und Risikominimierung. Ein gut konstruiertes ESOP/VSOP-Programm ist aus Sicht vieler VCs ein Qualitätsmerkmal eines Start-ups: Es zeigt, dass das Gründerteam verstanden hat, wie wichtig Mitarbeiterincentivierung ist, und bereit war, dafür Equity beiseitezulegen. Tatsächlich fordern Investoren häufig aktiv die Einrichtung eines bestimmten Option-Pools im Zuge einer Finanzierungsrunde. Nicht selten wird im Term Sheet festgelegt, dass z.B. 10% der Anteile als Pool für (gegenwärtige und zukünftige) Mitarbeiter bereitgestellt werden – und zwar meistens “pre-money“, d.h. auf Kosten der Altgesellschafter. So stellen Investoren sicher, dass nach ihrem Einstieg genug Anteile für künftige Einstellungen verfügbar sind, ohne dass ihre eigene Beteiligungsquote nachträglich schmilzt.
Außerdem achten Investoren darauf, dass bestehende und zukünftige Mitarbeiterbeteiligungen geordnet und begrenzt sind. Ein Horror für VCs wäre ein Cap Table mit Dutzenden Kleinaktionären ohne Vesting – hier sehen sie Probleme bei zukünftigen Entscheidungen oder Exit-Transaktionen. Daher verlangen Investoren häufig, dass alle vorhandenen Mitarbeiteranteile vestinggebunden werden bzw. bestehende Gesellschafter (Gründer oder Mitarbeiter) vor der Finanzierung unerwünschte Anteile zurückgeben oder in einen Pool transferieren. Investoren besteht ferner auf professionellen Vertragsklauseln: Drag-Along, Tag-Along, klare Anti-Dilution-Regelungen (zugunsten der Investoren) und keine Vetorechte für Minderheitsgesellschafter, die den Investor behindern könnten. Insbesondere sollen Mitarbeiter keine besonderen Veto- oder Zustimmungsrechte in Gesellschaftervereinbarungen erhalten, die über ihr Stimmrecht hinausgehen. Ebenso wird meist gefordert, dass Mitarbeiteranteile stimmrechtslos gestellt werden oder die Mitarbeiter ihr Stimmrecht an die Gründer/investorenfreundliche Voting Agreements binden – um sicherzustellen, dass das Voting bei den Hauptgesellschaftern bleibt.
Ein weiterer Punkt: Gesellschaftsform und Steuer. Internationale Investoren sehen gerne, wenn eine Beteiligung “clean” ist – d.h. keine drohenden Steuerprobleme. Ein ESOP in einer US-Delaware-Corp z.B. ist erprobt und steuerlich klar (Optionen werden nach §409A IRC bewertet, Mitarbeiter zahlen erst bei Ausübung/Verkauf Steuern). In Deutschland war das Pendant lange unscharf – virtuelle Optionen galten investorenseits als not perfect, da z.B. im Exitfall unklar war, ob nicht doch steuerliche Nebenwirkungen auftreten oder ob sich Mitarbeiter möglicherweise als Quasi-Gläubiger positionieren könnten. Allerdings hat sich hier viel getan; neue gesetzliche Regelungen (siehe Zukunftsfinanzierungsgesetz) und Precedent aus größeren Exits haben Standards geschaffen. Manche Investoren bevorzugen dennoch Start-ups, die als AG mit echtem ESOP firmieren, weil das dem international gewohnten Modell entspricht. Hier prallen oft Philosophien aufeinander: Traditionelle deutsche Investoren haben sich mit der GmbH+VSOP arrangiert, internationale VCs drängen Start-ups teils in Richtung “Flip to Delaware” oder zumindest deutsche AG, um ein ESOP aufzusetzen. Business Angels, die in sehr frühen Phasen investieren, sind meist etwas flexibler, fordern aber ebenso, dass wichtige Mitstreiter im Team angemessen incentiviert sind.
Zusammengefasst erwarten Investoren Mitarbeitendenbeteiligung als Motivationsinstrument, aber nur in einer Form, die investorfreundlich strukturiert ist: Mit ausreichend großem, aber begrenztem Pool, mit Vesting/Cliffs, ohne unüblichen Schutz für die Mitarbeiteranteile und möglichst mit einfacher Handhabung (z.B. gebündelt in einer KG oder als stimmrechtslose Anteile). Letztlich soll das Programm das Unternehmen wertvoller machen, nicht komplizierter. Ein positiv gesinnter Investor wird eventuell sogar helfen, das Programm auszubauen – etwa später weitere Optionen freigeben – wenn dies der Performance dient. Aber genauso werden Investoren darauf achten, dass die Mitarbeiterbeteiligung nicht zur Verwässerungsfalle für das Gründerteam wird: Denn ein zusehr verwässertes Gründerteam verliert seinerseits Motivation. Es gilt also auch hier das richtige Maß zu finden.
Für Mitarbeiter – insbesondere solche, die vor der Entscheidung stehen, zu einem Startup zu wechseln – ist Work for Equity oft Neuland. Ihre Perspektive ist geprägt von der Abwägung zwischen Sicherheit und Chancen. Auf der Habenseite steht die Aussicht, bei Erfolg überproportional zu profitieren und vielleicht einen unternehmerischen Durchbruch zu erleben, der in normalen Angestelltenjobs so nicht möglich ist. Auf der Sollseite stehen Gehaltsverzicht, höheres Risiko des Scheiterns und Ungewissheit über die Einlösbarkeit des Versprechens. Daher stellen sich Mitarbeiter einige zentrale Fragen: Ist das Equity-Angebot fair? – Also kompensiert es den niedrigen Lohn ausreichend in erwartbarem Wertzuwachs? Wie hoch ist mein prozentualer Anteil, und wieviel könnte das in Geld bedeuten, falls das Startup gängige Meilensteine erreicht (z.B. Series A, Series B, Exit)? Wie sind die Bedingungen? – Sieht der Vesting-Plan einen allzu langen Zeitraum vor? Gibt es eine Cliff, nach der ich im ersten Jahr gar nichts bekomme, was passiert, wenn ich vor einem Exit das Unternehmen verlasse? Ein verantwortungsbewusstes Startup wird hier Transparenz schaffen und dem Mitarbeiter die Mechanismen erklären. Etwa mit Berechnungsbeispielen, Szenarien und klarer Dokumentation.
Mitarbeiter sollten auch auf die vertraglichen Details achten: Ist ihre Beteiligung an ein Fortbestehen des Arbeitsvertrags gebunden? (Meist ja: ein Kündigung führt zum Verlust nicht-gevesteter Anteile.) Was passiert im Falle einer Entlassung – wird man dann Bad Leaver und verliert alles? Können die Gründer das Programm einseitig ändern (z.B. mehr virtuelle Anteile ausgeben, was meinen Anteil verwässert)? Nicht jeder Mitarbeiter ist juristisch versiert, aber es lohnt sich, diese Punkte nachzufragen. Mitunter ziehen Fachkräfte Anwälte hinzu, um Angebote zu prüfen, vor allem bei höheren Positionen. In Deutschland ist das Konzept noch nicht so verbreitet wie in den USA, sodass ein gewisses Aufklärungsbedürfnis besteht.
Aus Mitarbeitersicht ist auch relevant: Welche Stellung habe ich als Beteiligter tatsächlich? Bekomme ich regelmäßig Infos über die Firmenentwicklung (z.B. Geschäftsberichte)? Werde ich in wichtige Entscheidungen einbezogen oder zumindest vorab informiert (z.B. über eine anstehende Finanzierungsrunde, die meine Beteiligung verwässert)? Formal haben insbesondere virtuelle Beteiligte keine solchen Rechte (Virtuelle Mitarbeiterbeteiligung in Startups). Daher muss viel auf Vertrauensbasis laufen. Ein Startup, das seine Mitarbeiter als „Mit-Unternehmer“ betrachtet, wird sie intern offener behandeln – etwa quartalsweise Updates geben, die Equity-Thematik offen diskutieren – während andere vielleicht das Minimum kommunizieren. Hier kann man sich erkundigen, wie die Firmenkultur ist.
Ein weiterer Aspekt: Exit-Strategie und persönliches Risiko. Ein Mitarbeiter in den Zwanzigern ohne familiäre Lasten kann sich eher erlauben, zwei Jahre für geringes Gehalt auf eine Exit-Chance hinzuarbeiten, als jemand mit Familie oder finanziellen Verpflichtungen. Deshalb muss jeder für sich prüfen, wieviel Gehaltsverzicht verkraftbar ist. In manchen Fällen werden alternative Lösungen gesucht, z.B. zunächst Teilzeit gegen Equity arbeiten (und parallel einen Brotjob behalten) oder eine Mischung aus Gehalt und Equity (etwa geringeres Fixum plus Anteile). Der Gesetzgeber setzt – wie erwähnt – dem Totalverzicht ohnehin Grenzen (Mindestlohn). Mitarbeiter könnten jedoch auch moralisch argumentieren: Ein equity-only Angebot, das faktisch auf unter Mindestlohn hinausläuft, sollte man ablehnen, wenn nicht gleichzeitig echter Gründerstatus und entsprechend hohe Equity (20% und mehr) damit einhergehen. Ein oft zitierter Richtwert unter Gründern lautet: Wer ohne Gehalt mitarbeitet, ist eigentlich Mitgründer – alles andere wäre unfair. Dementsprechend sollte die Equity in Relation stehen. Zum Beispiel wären 0,5% für einen frühen Mitarbeiter, der jahrelang auf Großteil des Gehalts verzichtet, wohl als zu gering anzusehen, während 5–10% je nach Position und Stage eher angemessen sein könnten. Letztlich hängt das von Branche, Wertschöpfungsbeitrag und Teamgröße ab – absolute Fairness gibt es nicht, aber Transparenz und ehrliche Verhandlung können helfen, ein beidseitig vertretbares Paket zu schnüren.
Wie oben angesprochen, kann die Wahl der Gesellschaftsform erhebliche Auswirkungen auf die Umsetzung von Mitarbeiterbeteiligungen haben. Speziell die Konstruktion einer GmbH & Co. KG als Beteiligungsgesellschaft hat sich als eleganter Weg herauskristallisiert, echte Beteiligungen zu ermöglichen, ohne die Hauptgesellschaft unhandlich zu machen.
Bei der sogenannten Mitarbeiterbeteiligungs-KG gründen die Beteiligten neben der eigentlichen Startup-GmbH eine Kommanditgesellschaft. Typischerweise fungiert die Startup-GmbH selbst (oder eine von den Gründern kontrollierte UG/GmbH) als Komplementärin (geschäftsführende Gesellschafterin) der KG. Die Kommanditanteile werden zunächst von der Startup-GmbH als alleiniger Kommanditistin gehalten (sodass die KG 100% an der GmbH hält). Diese KG dient als Pool für die Mitarbeiteranteile. Fortan können Mitarbeiter nach und nach in diese KG aufgenommen werden, indem die Startup-GmbH Stück für Stück ihre Kommanditanteile an die Mitarbeitenden überträgt. Jeder Mitarbeiter wird somit Kommanditist der Mitarbeiter-KG und erwirbt einen Anteil an der KG, die wiederum Anteile an der Haupt-GmbH hält. Effektiv sind sie damit indirekt an der GmbH beteiligt, ohne dass die GmbH selbst ständig neue Anteilseigner bekommt.
Die Vorteile dieses Modells sind vielfältig: Einfachere Übertragungen – Der Eintritt eines neuen Kommanditisten in die KG erfordert lediglich einen Gesellschafterbeschluss und eine Anmeldung zum Handelsregister mit notariell beglaubigter Unterschrift, aber keine Beurkundung jedes Übertragungsvorgangs. Insbesondere müssen nicht bei jeder Mitarbeiterbeteiligung GmbH-Anteile notariell abgetreten werden, was Zeit und Kosten spart. Die KG kann zu Beginn mit allen für Mitarbeiter vorgesehenen Anteilen “befüllt” werden (durch eine einmalige Abtretung/Einlage der GmbH-Anteile an die KG, notariell). Anschließend wird intern die Verteilung über Kommanditanteile geregelt – das geht formfrei durch Vertrag unter den KG-Gesellschaftern. Bündelung der Stimmen – In der Haupt-GmbH tritt die KG als einheitliche Gesellschafterin auf. Die Mitarbeiter stimmen nur innerhalb der KG über ihr Verhalten in der GmbH ab, oder die Geschäftsführung der KG (typisch die Gründer als Komplementär-Geschäftsführer) entscheidet nach einem im KG-Vertrag festgelegten Verfahren. So bleibt die Cap Table der GmbH schlank: Egal ob 1 oder 20 Mitarbeiter beteiligt sind, es gibt aus Sicht der GmbH nur einen zusätzlichen Gesellschafter (die KG). Investoren müssen daher im Zweifel nur einen weiteren Player berücksichtigen. Flexibilität in der Ausgestaltung – Der KG-Gesellschaftsvertrag kann Vesting- und Leaver-Regelungen enthalten, die den Besonderheiten Rechnung tragen. Beispielsweise kann vereinbart werden, dass wenn ein Mitarbeiter-Kommanditist ausscheidet, er seine KG-Anteile zurück an die Startup-GmbH oder die Gründer überträgt (quasi Vesting innerhalb der KG). Auch unterschiedliche Gewinnverteilungen können festgelegt werden – z.B. dass die KG-Gewinne (die ja aus Gewinnausschüttungen der GmbH stammen) nach einem bestimmten Schlüssel an die Kommanditisten verteilt werden. Zudem lässt sich steuern, dass Mitarbeiter keinen Einfluss auf die Geschäftsführung der KG haben (Kommanditisten sind per Gesetz von der Führung ausgeschlossen, § 164 HGB), und die Komplementärin (die Gründer via GmbH) behält das Kommando. Die Mitarbeiter erhalten so wirtschaftliche Beteiligung, ohne die Kontrolle aus der Hand zu geben.
Ein weiterer Vorteil ist steuerlicher Natur: In einer KG sind die Kommanditisten Mitunternehmer und erzielen Einkünfte aus Gewerbebetrieb, während bei virtuellen Anteilen Lohnsteuer anfällt. Allerdings ist dieser Bereich komplex – es gibt Freibeträge für Mitarbeiterkapitalbeteiligungen, Unterschiede in der Besteuerung bei Zufluss etc. Da wir steuerliche Aspekte hier nur streifen, sei nur gesagt: Die KG-Lösung kann auch steuerlich attraktiv gestaltet werden, wenn man z.B. Anteile zunächst zu Nominalwert einräumt und die Wertsteigerung dann als Veräußerungsgewinn später realisiert.
Nachteile der KG-Konstruktion sind der Initialaufwand und etwas höhere laufende Compliance-Kosten: Man benötigt eine zusätzliche Gesellschaft (d.h. KG-Vertrag, Anmeldung beim Handelsregister etc.), es fallen jährlich möglicherweise zwei Abschlüsse an (für GmbH und KG), und rechtlich sind mehr Beteiligte involviert. Bei sehr kleinen Teams lohnt sich der Aufwand nicht – hier tut es ein einfaches VSOP. Aber sobald ein Unternehmen plant, mehrere Mitarbeiter über Jahre zu beteiligen und ihnen echte Equity zu geben, kann eine Mitarbeiter-KG vorteilhaft sein. Sie wird in Deutschland z.B. von Start-ups genutzt, die viele frühere Mitarbeiter am Unternehmen halten wollen, aber gleichzeitig die Investorenkompatibilität wahren möchten. Ein Beispiel ist die SkySails GmbH, die eine „SkySails Mitarbeiterbeteiligungs KG“ eingerichtet hat.
Kurz erwähnt sei: Alternativ könnte man auch gleich das gesamte Start-up als GmbH & Co. KG aufsetzen, in der Mitarbeiter direkt Kommanditisten werden. Dieses Modell wird aber selten gewählt, da dann z.B. die Gründer als Komplementäre unbeschränkt haften müssten (oder man eine GmbH als Komplementärin braucht, was dann wieder auf obiges Modell hinausläuft). Außerdem sind in einer Personengesellschaft die Entnahme- und Steuerregelungen für viele Gründer zu unübersichtlich. Daher bleibt meist die Trennung: Operative Gesellschaft als GmbH, und separate KG als Pool.
Abschließend: Die Wahl der Gesellschaftsform ist eine strategische Entscheidung. Für frühe Phasen mit unsicherer Entwicklung bietet eine einfache GmbH/UG mit VSOP die meiste Flexibilität und geringste Kosten. In späteren Phasen oder wenn man gleich international denkt, kann eine AG sinnvoll sein, um Mitarbeiter durch echte Aktienoptionen zu beteiligen. Die GmbH & Co. KG als Mitarbeiterpool ist eine kreative deutsche Lösung, die viele Vorteile vereint, aber auch mehr initialen Aufwand bedeutet. Start-ups sollten diese Optionen prüfen – oft in Abstimmung mit Investoren und juristischen Beratern – um die Struktur zu finden, die sowohl rechtssicher als auch praktikabel und attraktiv für Mitarbeiter ist.
Ein Blick ins Ausland – insbesondere in die USA – zeigt, wie Mitarbeiterbeteiligung alternativ gestaltet werden kann und wo die Grenzen einer Übertragbarkeit nach Deutschland liegen. In den USA gehört ein Employee Stock Option Plan (ESOP) zum guten Ton eines jeden Start-ups. Mitarbeiter erhalten dort typischerweise Optionen auf Unternehmensanteile, die über 4 Jahre vesten (mit 1 Jahr Cliff) und die sie bei Ausscheiden oder spätestens beim Exit ausüben können. Diese Optionen berechtigen zum Kauf von Aktien zu einem vorher festgelegten Strike Price (in frühen Phasen oft sehr niedrig, nahe dem Nominalwert). Bei einem erfolgreichen Exit liegt der Marktpreis der Aktie dann weit über dem Strike Price, sodass die Differenz den Gewinn für den Mitarbeiter darstellt. Alternativ (gerade bei einem Verkauf der Firma) werden die Optionen häufig direkt cash-settled, d.h. der Mitarbeiter erhält den Wert ausgezahlt, ohne wirklich Aktien kaufen zu müssen. Wichtig ist: Auch in den USA arbeiten normale Mitarbeiter nur selten für gar kein Gehalt. In der Regel bekommen sie ein – wenn auch oft unter dem Markt liegendes – Grundgehalt plus die Aussicht, durch Optionen reich zu werden. Rein rechtlich existiert auch in den USA ein Mindestlohn (federal minimum wage, plus evtl. höhere in Kalifornien etc.), und es gibt keine generelle Ausnahme für Start-ups, Mitarbeiter stattdessen nur in Aktien zu bezahlen. Allerdings werden dort Gründer und frühe Schlüsselkräfte häufig als “Founder” oder “Executive” eingestuft und bekommen ein symbolisches Gehalt (z.B. $1 pro Jahr oder sehr wenig), was praktisch eine Duldung findet, solange niemand klagt. Das arbeitsrechtliche Klima ist durch at-will employment und schwächeren Kündigungsschutz deutlich unternehmerfreundlicher, was solche informellen Lösungen begünstigt. Nichtsdestotrotz gab es in den USA auch Fälle, in denen ehemalige Mitarbeiter rückwirkend Lohn einklagten, wenn das Startup scheiterte und die versprochenen Optionen wertlos blieben – ganz ähnlich wie es in Deutschland denkbar ist.
Was in den USA besser funktioniert, ist die Steuer- und Regulierungssystematik: Es gibt etablierte Bewertungsverfahren (409A) um den Fair Market Value von Start-up Aktien niedrig anzusetzen, sodass Mitarbeiteroptionen keine sofortige Steuer auslösen. Zudem kennt das US-Steuerrecht Konzepte wie Qualified Small Business Stock (QSBS), die bei Halten von echten Aktien über 5 Jahre Gewinne bis zu 10 Mio. USD steuerfrei stellen, was Gründer und Mitarbeiter gleichermaßen begünstigt. Solche Regelungen fehlen in Deutschland weitgehend oder waren bis vor kurzem unzureichend (der deutsche Steuerfreibetrag für Mitarbeiterbeteiligungen wurde erst 2021 von 360 € auf 1.440 € erhöht, immer noch marginal im Vergleich zu US-Volumina). Allerdings hat der deutsche Gesetzgeber erkannt, dass das Land im Wettbewerb um Talente und Start-ups zurückfällt, wenn es nicht mithält. Mit dem Fondsstandortgesetz 2021 und dem geplanten Zukunftsfinanzierungsgesetz 2023/24 wurden und werden Schritte unternommen, um Mitarbeiterbeteiligungen attraktiver zu machen. So sollen steuerliche Nachteile (Dry Income) durch Steuerstundung entschärft werden und mehr Flexibilität für Aktienoptionen geschaffen werden. Insbesondere plant das Zukunftsfinanzierungsgesetz, wie erwähnt, die Rahmenbedingungen für echte ESOPs zu verbessern (Erhöhung des bedingten Kapitals auf 20%, Versteuerung von Mitarbeiternanteilen erst beim Exit unter bestimmten Voraussetzungen, etc.). Dieser Paradigmenwechsel orientiert sich an anglo-amerikanischen Vorbildern und könnte es deutschen Start-ups erleichtern, US-Modelle zu adaptieren.
Dennoch bleiben kulturelle Unterschiede. In den USA ist es geradezu erwartet, dass ein Start-up-Mitarbeiter über Aktienoptionen verfügt; Gehaltsverhandlungen drehen sich oft genauso um die Equity wie ums Salary. In Deutschland ist vielen Beschäftigten die Idee, auf Gehalt zu verzichten, um etwas zu „gamblen“, fremd. Das Sicherheitsbedürfnis ist höher, auch aufgrund des dichten sozialen Netzes und der tradierten Arbeitskultur. Ein Gründer, der hierzulande vorschlägt „Wir zahlen dir erstmal nichts, aber du kriegst 5% vom Unternehmen“, wird vermutlich auf Skepsis stoßen – und sie ist aus rechtlicher Sicht berechtigt, denn gesetzlich ist ein Nullgehalt in aller Regel unzulässig (Mindestlohn). In den USA hingegen ist das unter Start-up-Enthusiasten fast schon romantisiert, aber auch dort praktisch oft durch Foundershares gelöst statt durch echte Arbeitsverträge ohne Lohn.
Ein weiterer internationaler Vergleichspunkt: In vielen Ländern Europas gibt es spezielle Mitarbeiterbeteiligungs-Programme, z.B. das EMI (Enterprise Management Incentives) in Großbritannien, das steuervergünstigte Optionen ermöglicht, oder Modelle in Frankreich (BSPCE) mit ebenfalls steuerlich geförderten Mitarbeiteroptionen. Diese Modelle verfolgen alle das Ziel, Mitarbeiter am Unternehmenserfolg partizipieren zu lassen, ohne die erwähnten Nachteile (Steuer vor Liquidität, zu großer Formalaufwand). Deutschland zieht hier langsam nach. Für Start-ups, die international tätig sind oder Teams in verschiedenen Ländern haben, bedeutet das aber, dass sie eventuell mehrere Programme parallel fahren müssen – z.B. ein VSOP für deutsche Mitarbeiter, ein EMI für britische, etc. Das erhöht natürlich die Komplexität.
Zusammenfassend kann man sagen: Internationale Vorbilder zeigen, dass Mitarbeitendenbeteiligung ein Erfolgsfaktor sein kann, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Viele Mechanismen (Vesting, Option-Pools, etc.) wurden aus den USA übernommen und lassen sich grundsätzlich auch in Deutschland anwenden – sie müssen nur an hiesiges Recht angepasst werden. Was in Deutschland (noch) nicht umsetzbar ist, ist ein extremes „Sweat-Equity“-Modell, wo reguläre Mitarbeiter völlig ohne Lohn für Equity arbeiten – hier setzt der Gesetzgeber Grenzen (und das ist auch gut so, um Ausbeutung zu vermeiden). Der Trend geht aber dahin, diese Beteiligungsformen international vergleichbarer zu machen, indem rechtliche Hürden abgebaut werden. So verspricht das Zukunftsfinanzierungsgesetz u.a., dass Start-ups und Scale-ups künftig leichter Talente gewinnen und halten können, weil nachhaltige Mitarbeiterbeteiligungsprogramme weniger risikobehaftet sind und nicht mehr nur auf inoffizielle Hilfskonstruktionen angewiesen sein werden . In ein paar Jahren könnte es also deutlich selbstverständlicher sein, dass auch deutsche Mitarbeiter einen Teil ihrer Vergütung in Equity erhalten – flankiert von Gesetzen, die Fairness und legal Compliance gewährleisten.
Abschließend soll neben der rechtlichen Betrachtung die Frage der Fairness und Strategie erörtert werden. Juristisch mag manches zulässig oder unzulässig sein – unabhängig davon müssen Gründer und Mitarbeiter aber auch moralisch und langfristig sinnvoll entscheiden.
Wann ist Mitarbeitendenbeteiligung fair? Fairness ist gegeben, wenn Chancen und Risiken angemessen verteilt sind. Ein early employee trägt einen Teil des unternehmerischen Risikos, indem er auf sicheren Lohn verzichtet; im Gegenzug sollte er angemessen am Erfolg beteiligt werden, wenn dieser eintritt. „Angemessen“ heißt: Entspricht die Equity in etwa dem Wert des Gehaltsverzichts (mit Risikozuschlag)? Hier können Berechnungen helfen: Wenn jemand für 2 Jahre 30.000 € p.a. weniger Gehalt nimmt, „investiert“ er 60.000 € in das Unternehmen. Dafür sollte der erwartbare Equity-Wert bei Erfolg zumindest ein Vielfaches dessen sein, sonst lohnt sich das Risiko nicht. Fair ist es auch, offen über die Wahrscheinlichkeiten zu sprechen – Gründer sollten keine unrealistischen Reichtümer versprechen, sondern klar machen, dass Equity ein Hochrisiko-Vergütungsbestandteil ist. Der Mitarbeiter wiederum sollte verstehen, dass die Gründer selbst meist noch viel mehr unentgeltliche Arbeit leisten/geleistet haben und sein Anteil in Relation dazu steht. Fairness bedeutet auch, dass Regeln wie Vesting für alle gleichermaßen gelten – es wirkt beispielsweise gerecht, wenn auch Gründer einem Vesting unterliegen (was oft auf Investorendruck hin passiert), denn dann „sitzen alle im gleichen Boot“. Zudem sollte eine faire Beteiligung transparente Bedingungen haben: Keine versteckten Fallen im Kleingedruckten, sondern klare Absprachen, was bei verschiedenen Szenarien (Exit, Kündigung, Insolvenz) passieren soll.
Einseitige Risikoabwälzung: Kritisch wird es, wenn Mitarbeitendenbeteiligung vor allem dazu dient, das unternehmerische Risiko auf die Angestellten abzuwälzen, ohne ihnen realistische Teilhabe zu bieten. Beispiele: Ein Startup verspricht einem Entwickler 1% der Anteile, zahlt ihm dafür aber jahrelang kein Gehalt – am Ende scheitert die Firma, der Entwickler hat umsonst gearbeitet (während die Gründer ggf. ihren Lebensunterhalt aus Investorengeldern bestreiten konnten). Oder ein Mitarbeiter bekommt zwar Anteile, aber so winzig (z.B. 0,1% bei 4 Jahren Vesting), dass die Motivation daraus kaum gegeben ist, er aber trotzdem auf einiges an Gehalt verzichtet. Auch problematisch: Wenn die Beteiligung mit harten Lock-in-Klauseln verknüpft ist, die den Mitarbeiter faktisch binden, ohne dass er gehen könnte, selbst wenn sich das Arbeitsverhältnis schlecht entwickelt – z.B. ein Wettbewerbsverbot ohne adäquate Entschädigung. Dann wird Equity zu einem goldenen Käfig. Aus Sicht der Belegschaft wird eine Beteiligung als unfair empfunden, wenn das Verhältnis von Risiko zu Ertrag nicht stimmt. Oft hört man den Vorwurf, Start-ups würden junge Enthusiasten mit großen Visionen locken, um sie dann für ein Butterbrot arbeiten zu lassen – und nur die Gründer und Investoren sahnen im Erfolgsfall ab. Dieses Szenario sollte man als Gründer unbedingt vermeiden, denn es zerstört Vertrauen und Motivation, sobald die Diskrepanz erkannt wird.
Moralische Aspekte: Neben der finanziellen Fairness spielt auch die Wertschätzung eine Rolle. Ein Mitarbeiter, der beteiligt wird, nimmt am Schicksal des Unternehmens Anteil. Im Gegenzug erwartet er (zurecht), nicht wie eine austauschbare Ressource behandelt zu werden, sondern als Teil des engeren Teams. Ein respektvolles Miteinander, Teilhabe an Informationen und eine Kultur der Offenheit sind moralisch geboten, damit Work for Equity kein zynisches Ausnutzen der Arbeitskraft ist. Gründer sollten ihr Team nicht im Unklaren lassen, wo das Unternehmen steht – sonst entsteht leicht das Gefühl, man arbeite ins Leere.
Strategische Überlegungen: Für das Unternehmen strategisch ist eine faire Mitarbeiterbeteiligung meist von Vorteil: Zufriedene, motivierte Teammitglieder, die sich als Unternehmer fühlen, werden extra Meilen gehen und nicht um 17 Uhr den Stift fallen lassen. Das Startup kann so eine Kultur aufbauen, die in kritischen Phasen den Unterschied machen kann. Umgekehrt ist es strategisch fatal, wenn Mitarbeiter ihre Beteiligung als Mogelpackung sehen – dann verliert das Instrument jegliche Motivationswirkung und kann ins Negative umschlagen (Enttäuschung, Zynismus, Abwanderung zu etablierten Jobs). Gründer müssen strategisch planen, wem sie wann wieviel Beteiligung anbieten. Gibt man zu früh zuviel an jemanden, der das Unternehmen vielleicht bald verlässt, ist das Equity „verbrannt“. Gibt man zu wenig, gewinnt man vielleicht die Person nicht oder sie fühlt sich unterwertgeschätzt. Auch das Thema Neid im Team muss man bedenken: Wenn nur einzelne Mitarbeiter beteiligt werden, kann das andere demotivieren. Oft ist es ratsam, klare Kriterien zu haben, wer teilnimmt (z.B. alle Führungskräfte, oder alle ab einer bestimmten Betriebszugehörigkeit). Strategisch ist auch die Kommunikation nach außen wichtig: Ein bekanntes umfangreiches Mitarbeiterbeteiligungsprogramm kann ein Recruiting-Argument sein. Allerdings sollten Start-ups vorsichtig sein, nicht überzubewerten, was sie da anbieten – am Ende zählen für viele Kandidaten immer noch Faktoren wie Team, Technologie, Gehalt. Equity ist das Sahnehäubchen.
Fazit: Mitarbeitendenbeteiligung – Work for Equity – in Frühphasen-Startups ist ein komplexes, aber lohnendes Unterfangen. Rechtlich ist es nur in einem gewissen Rahmen zulässig und erfordert saubere Verträge unter Beachtung von Arbeits- und Gesellschaftsrecht. Gelingt diese Gestaltung, können beide Seiten profitieren: Das Start-up erhält engagierte Mitstreiter, und die Mitarbeitenden bekommen die Chance, echte unternehmerische Früchte zu ernten. Wichtig ist, juristische Fragestellungen und moralische Aspekte gleichermaßen im Blick zu haben. Nur weil etwas rechtlich möglich ist (z.B. Mitarbeiter formal als Gesellschafter ohne Gehalt zu führen), muss es nicht fair sein – und nur weil etwas fair gemeint ist, ist es nicht automatisch legal (z.B. Equity ohne Mindestlohn). Die erfolgreiche Umsetzung verlangt also einen Balanceakt: Chancen und Risiken müssen ausgewogen verteilt, Rechte und Pflichten klar geregelt und alle Beteiligten abgeholt werden. Dann wird Work for Equity von der riskanten Gratwanderung zum echten Win-Win-Modell, das aus Kollegen Mitunternehmer macht und ein Startup durch die schwierigen frühen Phasen tragen kann – in Richtung gemeinsamen unternehmerischen Erfolgs.
Marian Härtel ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für IT-Recht mit einer über 25-jährigen Erfahrung als Unternehmer und Berater in den Bereichen Games, E-Sport, Blockchain, SaaS und Künstliche Intelligenz. Seine Beratungsschwerpunkte umfassen neben dem IT-Recht insbesondere das Urheberrecht, Medienrecht sowie Wettbewerbsrecht. Er betreut schwerpunktmäßig Start-ups, Agenturen und Influencer, die er in strategischen Fragen, komplexen Vertragsangelegenheiten sowie bei Investitionsprojekten begleitet. Dabei zeichnet sich seine Beratung durch einen interdisziplinären Ansatz aus, der juristische Expertise und langjährige unternehmerische Erfahrung miteinander verbindet. Ziel seiner Tätigkeit ist stets, Mandanten praxisorientierte Lösungen anzubieten und rechtlich fundierte Unterstützung bei der Umsetzung innovativer Geschäftsmodelle zu gewährleisten.
Diese Woche geht es wieder los. Gefühlt jeder Händler hat eine Rabattaktion mit irgendwie mit der Farbe "Schwarz" assoziiert wird....
Mehr lesenDetailsIm letzten Jahr gab es bei British Airways ein Datenleck von dem über 250.000 Kunden und dabei hochsensible Daten wie...
Mehr lesenDetailsDie Problematik von Influencer Schleichwerbung Das Landgericht Hamburg schließt sich dem Reigen der Urteile zu Influencer und Schleichwerbung an. Bislang...
Mehr lesenDetailsHinter dem Begriff Metaverse verbirgt sich eine digitale Welt, die von realen Individuen kontrolliert, geformt und gelebt wird. Was für...
Mehr lesenDetailsWie gestern angekündigt, habe ich nun die erste Phase der sogenannten Content-Awareness für den Bot implementiert. Der Bot ist jetzt...
Mehr lesenDetailsIhr habt eine geniale Geschäftsidee und wollt mit eurem Startup durchstarten? Großartig! Aber habt ihr auch schon an die rechtlichen...
Mehr lesenDetailsDas Bundesverfassungsgericht hat die Möglichkeit der Führung von Gerichtsprozessen via Internet-Chat eingeschränkt. Was zunächst abwegig klingt, kommt nicht so selten...
Mehr lesenDetailsDas LG Koblenz hat entschieden, dass Influencer, die im geschäftlichen Verkehr in sozialen Medien kommerzielle Inhalte vorstellen, den kommerziellen Zweck...
Mehr lesenDetailsVor kurzem machte die GVU in der Szene der Private-Server Betreiber, also derjenigen, die Spieleserver außerhalb des Originalanbieters, für Onlinespiele...
Mehr lesenDetailsDie Wahl eines Unternehmensnamens ist für Gründerinnen und Gründer eine strategische Entscheidung – kreativ, aber vor allem auch rechtlich. Domainname,...
Mehr lesenDetails Kanzlei-SEO & Sichtbarkeit 2025: Das Content- und KI-Bundle für moderne Rechtsanwält:innen
54,99 €
Kanzlei-SEO & Sichtbarkeit 2025: Das Content- und KI-Bundle für moderne Rechtsanwält:innen
54,99 €
inkl. MwSt.
 Effiziente Arbeit mit KI in Kanzleien – Praxiswissen für die tägliche Mandatsarbeit
Effiziente Arbeit mit KI in Kanzleien – Praxiswissen für die tägliche Mandatsarbeit
inkl. MwSt.
 Kanzlei-Power-Bundle 2025: KI-Kompetenz & Sofort-Produktivität für Rechtsanwält:innen
99,99 €
Kanzlei-Power-Bundle 2025: KI-Kompetenz & Sofort-Produktivität für Rechtsanwält:innen
99,99 €
inkl. MwSt.
 120 Minuten: Videoberatung via Microsoft Teams 120 Minuten – Ausführlich, vertieft und individuell
535,50 €
120 Minuten: Videoberatung via Microsoft Teams 120 Minuten – Ausführlich, vertieft und individuell
535,50 €
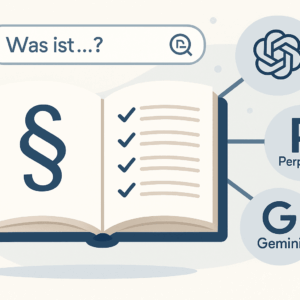 Von der Kanzlei zur KI-Quelle – LLM-SEO für Rechtsanwälte
9,99 €
Von der Kanzlei zur KI-Quelle – LLM-SEO für Rechtsanwälte
9,99 €
inkl. MwSt.
In dieser fesselnden Podcast-Episode tauche ich als IT- und Medienrechtsanwalt tief in die Welt der rechtlichen Herausforderungen ein, die mit...
Mehr lesenDetailsIn diesem Video rede ich ein wenig über transparente Abrechnung und wie ich kommuniziere, was es kostet, wenn man mit...
Mehr lesenDetails

















