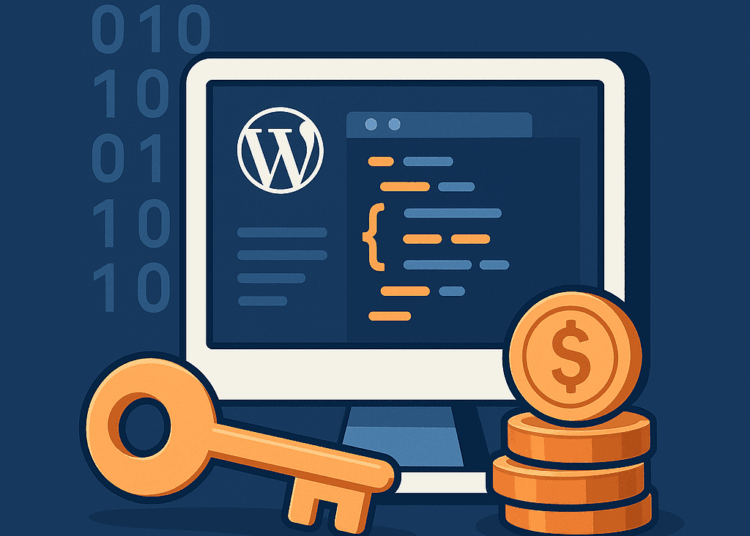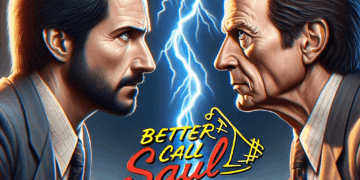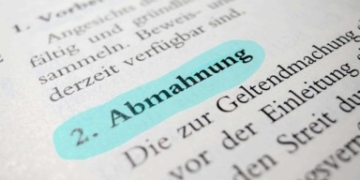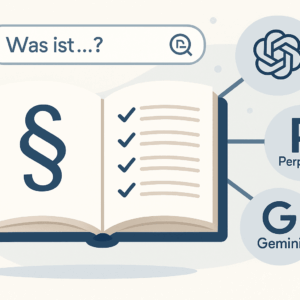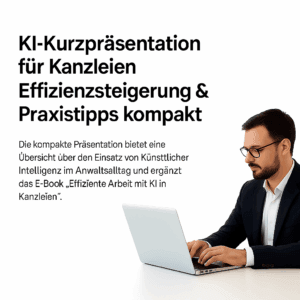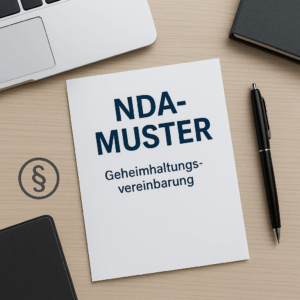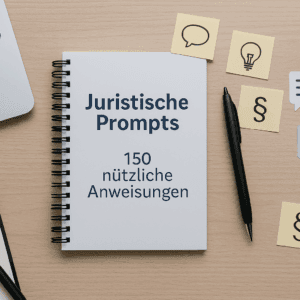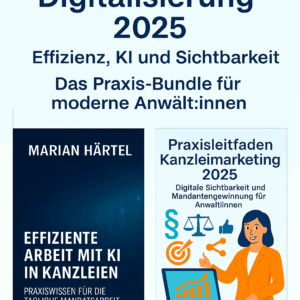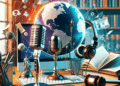Während ich an meinem eigenen WordPress-Plugin code, taucht immer wieder eine Frage auf: Gehört mir diese Software wirklich? Im Alltagsverständnis würden viele sofort sagen: „Klar, du hast es geschrieben, also ist es deine Software.“ Doch juristisch ist die Sache nicht so simpel. Software ist schließlich kein Ding, das man anfassen und physisch besitzen kann. Also: Kann man Eigentum an Software haben? Und was bedeutet das in Deutschland und Europa – im Vergleich zu den USA, wo Software oft nur „geliehen“ statt gekauft scheint? In diesem Blogpost nehmen wir diese Fragen unter die Lupe, tauchen ein in die rechtlichen Feinheiten und schauen uns an, wie das Konzept Eigentum bei Software in verschiedenen Rechtssystemen behandelt wird. Dabei dient mein WordPress-Plugin als praktischer Aufhänger: Müssen Plugins eigentlich GPL-lizenziert sein, und wie kann man mit GPL-Software Geld verdienen, wenn doch jeder den Code kopieren darf?
Eigentum vs. geistiges Eigentum: Was bedeutet es, Software zu „besitzen“?
In der Alltagssprache reden wir schnell davon, Software zu besitzen. „Ich habe mir ein Programm gekauft, also gehört es jetzt mir.“ Oder: „Das ist meine Software, ich habe sie entwickelt.“ Juristisch gesehen ist jedoch zwischen Eigentum im klassischen Sinne und geistigem Eigentum zu unterscheiden. Eigentum bezieht sich im deutschen Recht ganz konkret auf Sachen, also körperliche Gegenstände (§ 90 BGB). Digitale Inhalte – dazu zählt Software – erfüllen dieses Kriterium nicht, da sie nicht physisch greifbar sind. Folglich kann man Software nicht im sachenrechtlichen Sinn „eigentümlich“ haben. Eigentum kann nur an Sachen bestehen, Besitz erfordert eine körperliche Sache und auch eine Übereignung (Übergabe des Eigentums) ist nur bei physischen Gegenständen möglich. Bits und Bytes sind eben keine Autos oder Grundstücke, die man einfach so besitzen kann.
Aber was ist dann mit der Software, die ich entwickle oder kaufe? Hier kommt das Urheberrecht ins Spiel. Der Begriff geistiges Eigentum – so unscharf er manchmal ist – meint meist Rechte des geistigen Schöpfers eines Werkes. In Deutschland (und der EU) sind Computerprogramme urheberrechtlich geschützt, gelten also als persönliche geistige Schöpfungen. Genauer: Software ist ausdrücklich als literarisches Werk in § 69a UrhG definiert. Das bedeutet: Ab der Programmierung entsteht automatisch Urheberrechtsschutz an der Software – ohne Registrierung oder Formalitäten. Der Programmierer ist Urheber und hat umfassende Urheberpersönlichkeits- und Verwertungsrechte (z.B. Recht auf Vervielfältigung, Verbreitung, Veröffentlichung). Im Prinzip verhält sich das ähnlich wie Eigentum: Der Urheber hat ein exklusives Recht an seinem Werk, andere dürfen es nicht ohne Erlaubnis nutzen – daher sprechen viele vom geistigen Eigentum an Software. Wichtig ist aber: Juristisch ist das kein Eigentum im Sinne des Sachenrechts, sondern ein Immaterialgüterrecht (nämlich Urheberrecht).
Für Laien mag das wie Wortklauberei wirken – für Juristen ist es jedoch entscheidend: Wer eine Software kauft, erwirbt in der Regel kein Eigentum an der Software selbst, sondern eine Lizenz bzw. ein Nutzungsrecht. Anders gesagt: Man besitzt nicht den Code, sondern man hat das Recht, ihn zu benutzen (und zwar genau in dem Umfang, den der Lizenzvertrag vorsieht). Selbst wenn man eine Software auf DVD erwirbt, wird man nur Eigentümer der DVD als Sache, nicht des darauf gespeicherten Programms. Das erklärt auch, warum Software-Lizenzverträge in der Praxis so wichtig sind: Sie legen fest, was der „Lizenznehmer“ (der Käufer/Nutzer) mit der Software machen darf und was nicht. Im Grunde genommen ersetzt das Lizenzrecht hier das klassische Eigentumsrecht.
Rechtslage in Deutschland und Europa: Urheberrecht statt Sachenrecht
In Deutschland (und der EU) schützt also primär das Urheberrecht die Software. Das Urheberrechtsgesetz gewährt dem Entwickler alle wesentlichen Rechte am Programmcode. Wichtig: Urheber kann immer nur eine natürliche Person sein, keine Firma. (In meinem Fall bin also ich persönlich der Urheber meines WordPress-Plugins, auch wenn ich es vielleicht für meine Kanzlei entwickle.) Beschäftige ich als Firma Entwickler, übertragen diese per Gesetz die wirtschaftlichen Nutzungsrechte an der Software an den Arbeitgeber – der Programmierer bleibt aber Urheber. Diese Feinheit hat zur Folge, dass das Copyright in den USA z.B. oft beim Unternehmen liegt (Stichwort Work for hire), während in Deutschland der Mensch hinterm Code stets Urheber bleibt und der Firma nur Nutzungsrechte einräumen kann.
Rechtsdogmatisch wird Software in Deutschland also als immaterielles Gut behandelt. Eigentumsrechte im Sinne des BGB kann man daran nicht begründen. Trotzdem spricht man gerne von Software-Eigentum im weiteren Sinne. So werden etwa Quellcode, Programmentwürfe und sogar Zwischenschritte der Entwicklung vom UrhG erfasst und gelten als geistiges Eigentum des Entwicklers. Nicht geschützt ist dagegen die zugrundeliegende Idee oder Funktion: Wenn jemand die gleiche Programmidee in eigenem Code umsetzt, verletzt das nicht das Urheberrecht. Das heißt, das Recht gibt uns Entwicklern zwar ein mächtiges Herrschaftsrecht am konkreten Code, aber kein Monopol auf die Funktionalität dahinter – in der Hinsicht unterscheidet sich geistiges Eigentum vom Sacheigentum.
Europa vs. USA – kleine Randnotiz zum Patentrecht: Apropos Funktionalität: Die innovativen technischen Lösungen hinter Software kann man – wenn überhaupt – eher durch Patente schützen. Allerdings sind Software als solche in Europa grundsätzlich nicht patentierbar, es sei denn, es handelt sich um computerimplementierte Erfindungen mit technischem Charakter. In den USA war man traditionell großzügiger mit Software- und Geschäftsmethoden-Patenten, was man als eine Art Eigentum an Ideen ansehen könnte. Doch das nur am Rande – unser Fokus bleibt auf dem urheberrechtlichen Eigentum.
Softwarekauf und „digitales Eigentum“ in der EU
Ein interessanter Punkt ist der sogenannte „Kauf“ von Software. Viele gehen davon aus: Wer eine Software herunterlädt und bezahlt, „besitzt“ danach sein persönliches Exemplar – ähnlich wie ein Buch oder ein Auto. Juristisch ist das jedoch nicht korrekt. Denn im deutschen Recht ist Eigentum an Sachen (§ 903 BGB) ausschließlich auf körperliche Gegenstände beschränkt. Software ist kein körperlicher Gegenstand, sondern ein immaterielles Gut. Wer Software „kauft“, erwirbt daher keinen Eigentumstitel an der Software selbst, sondern lediglich eine Lizenz – also das Recht, die Software im vereinbarten Umfang zu nutzen.
Trotzdem gibt es eine wichtige Besonderheit: Das deutsche und europäische Recht kennen im Bereich urheberrechtlich geschützter Werke den Grundsatz der Erschöpfung (oft auch als First Sale Doctrine bezeichnet). Das bedeutet: Wird eine Softwarelizenz (unbefristet und gegen Einmalzahlung) mit Zustimmung des Rechteinhabers erstmals in den Verkehr gebracht – sei es auf einem Datenträger oder als Download –, so erschöpft sich das Verbreitungsrecht des Urhebers an genau diesem Exemplar. Der Erwerber kann dieses Exemplar dann weiterverkaufen, ohne dass der Rechteinhaber dies verhindern kann. Maßgeblich ist dabei nicht ein Eigentum an der Software selbst, sondern das erworbene Nutzungsrecht am konkreten Exemplar.
Der Europäische Gerichtshof hat im UsedSoft-Urteil 2012 entschieden: Auch gebrauchte Softwarelizenzen, die per Download erworben wurden, dürfen weiterveräußert werden. Voraussetzung ist, dass die Software auf dem System des ursprünglichen Käufers vollständig gelöscht wird und nicht weiter genutzt wird. Das zeigt: Während juristisch kein „Eigentum“ an Software im sachenrechtlichen Sinn besteht, entsteht aus Sicht der Nutzungspraxis ein eigentumsähnliches Recht an der Lizenz, das insbesondere das Recht zum Weiterverkauf einschließt.
Beispiel: Wird eine Office-Lizenz einmalig gekauft und dauerhaft überlassen, darf sie nachträglich auch weiterverkauft werden. In Deutschland ist daraus sogar ein Markt für gebrauchte Softwarelizenzen entstanden: Spezialisierte Händler kaufen Volumenlizenzen auf und verkaufen sie einzeln weiter – ein Vorgang, den die Gerichte ausdrücklich zulassen, solange die Bedingungen der Erschöpfung erfüllt sind.
Dieses europäische Verständnis unterscheidet sich erheblich von der Praxis etwa in den USA. Dort wird Software meist nur lizenziert, nicht verkauft, und Hersteller können über den Lizenzvertrag den Weiterverkauf weitgehend unterbinden.
Nicht zuletzt durch die sogenannte Digitale-Inhalte-Richtlinie hat die EU das Kaufrecht für digitale Produkte noch einmal gestärkt. Wer digitale Inhalte als „Kauf“ erwirbt, hat inzwischen viele Rechte ähnlich wie beim Erwerb körperlicher Sachen – etwa Ansprüche auf Gewährleistung. Dennoch bleibt es dabei: Ein echtes Eigentum an Software im klassischen Sinne kennt auch das deutsche Recht nicht. Was umgangssprachlich oft als „Eigentum an Software“ bezeichnet wird, ist in Wirklichkeit ein Lizenzrecht, das – unter bestimmten Voraussetzungen – mit eigentumsähnlichen Befugnissen wie dem Recht auf Weiterveräußerung ausgestattet ist. Ein umfassendes „Dateneigentum“ oder „Softwareeigentum“ als absolutes Recht existiert bislang nicht. Grundlage bleibt das Urheberrecht in Verbindung mit den jeweils vertraglich eingeräumten Nutzungsrechten.
Blick in die USA: Lizenz statt Kauf – „You bought it, you own it?“
In den Vereinigten Staaten zeigt sich ein etwas anderes Bild. Dort wird Software häufig nicht als verkauftes Gut betrachtet, sondern als lizenzierte Leistung. Die Praxis vieler US-Softwareunternehmen ist: Beim Installieren klickt der Nutzer einen Lizenzvertrag (EULA) weg, in dem steht, dass die Software nur lizenziert, nicht verkauft wird und dass eine Weitergabe untersagt ist. Diese berühmten „magic words“ – licensed, not sold – haben rechtlich großen Effekt: Sie sollen bewirken, dass der Käufer eben kein Eigentümer seines Softwareexemplars wird und somit keine First Sale-Rechte hat.
Ein illustrativer Fall ist Vernor v. Autodesk. Ein eBay-Händler wollte gebrauchte AutoCAD-Software weiterverkaufen. Autodesk argumentierte, die Software sei nur lizenziert, daher dürfe der Käufer sie nicht ohne Erlaubnis weiterveräußern. Tatsächlich entschied ein US-Berufungsgericht (9th Circuit) 2010 im Sinne des Herstellers: Wenn der Lizenzvertrag klar sagt „du bekommst nur eine nicht übertragbare Lizenz“ und die Nutzung/Weitergabe stark einschränkt, dann ist der Nutzer eben Lizenznehmer und nicht Eigentümer der Kopie. Mit anderen Worten: Durch ein paar geschickte Klauseln im „Kleingedruckten“ können Käufer zu Mietern degradiert werden, denen z.B. das Weiterverkaufsrecht versagt wird. Diese Rechtsprechung hat in den USA die alte Faustregel „You bought it, you own it“ empfindlich eingeschränkt. Für Verbraucher bedeutet das: Wer Software erwirbt, hat oft nur ein Nutzungsrecht, kein Eigentum – was Unternehmen u.a. nutzen, um den Gebrauchtsoftware-Markt klein zu halten.
Dieser Unterschied zwischen EU und USA ist bemerkenswert. Während ich mich in Deutschland darauf berufen kann, eine Softwarelizenz weiterverkaufen zu dürfen, riskiert man in den USA bei ähnlichem Vorgehen eine Urheberrechtsklage. Der Grundgedanke der US-Seite ist: Copyright first, consumer second – der Urheberrechtsinhaber behält möglichst lange Kontrolle. Bei uns in Europa tendiert man eher dazu, einen fairen Interessenausgleich zu schaffen: Wer legal erworbene Software nutzt, soll damit auch im gewissen Rahmen machen dürfen, was er will (inkl. Weiterverkauf).
Noch eine Differenz: In den USA können auch Unternehmen direkt als Urheber gelten (Stichwort work made for hire), sodass das Copyright von Anfang an bei der Firma liegt. In Deutschland hingegen muss immer erst der menschliche Schöpfer als Urheber das Nutzungsrecht übertragen (außer beim Arbeitnehmerurheberrecht, wo es per Gesetz an den Arbeitgeber übergeht). Und während das deutsche Urheberrecht unveräußerlich am Urheber hängt (man kann es nicht komplett „verkaufen“, nur Nutzungsrechte einräumen), kennen angelsächsische Systeme auch komplette Rechtsübertragungen des Copyrights. Man sieht: Die Vorstellung von Eigentum an kreativen Werken hat je nach Rechtssystem unterschiedliche Facetten.
Open Source und GPL: Freiheit statt exklusivem Eigentum
Während die klassische Softwareindustrie also oft versucht, Code wie Besitz zu behandeln (sprich: meins, du darfst es nur nutzen, wenn ich es erlaube), gibt es seit Jahrzehnten eine Gegenbewegung: Freie Software und Open Source. Deren Protagonisten – allen voran Richard Stallman vom GNU-Projekt – vertreten die Philosophie, dass Software teilen besser ist als besitzen. Stallman argumentierte früh, dass die Idee von Software-„Eigentümern“ der Gesellschaft mehr schade als nütze. Seine Lösung: Programme sollten unter Lizenzen gestellt werden, die jedem das Weitergeben, Verändern und Nutzen erlauben – unter der Bedingung, dass auch alle abgeleiteten Versionen wieder frei sind. So entstand die berühmte GPL (General Public License), unter der unzählige Softwareprojekte stehen – vom Linux-Betriebssystem bis eben zu WordPress.
Abb.: WordPress setzt auf die GPL-Lizenz – selbst Plugins und Themes sollen diesen „GPL-Stempel“ tragen.
WordPress ist ein hervorragendes Beispiel für die GPL-Philosophie. Die Blog- und CMS-Plattform wurde von Anfang an unter GPL gestellt. Das bedeutet: Jeder darf WordPress kostenlos nutzen, kopieren, verändern und weiterverbreiten. Diese Freiheit „vererbt“ sich auch auf Derivate: Die offizielle Haltung der WordPress-Macher (insbesondere Co-Gründer Matt Mullenweg) ist, dass Plugins und Themes als derivative Werke von WordPress anzusehen sind und daher ebenfalls GPL-Lizenz haben müssen. Auf WordPress.org heißt es sinngemäß: Wenn du damit nicht einverstanden bist, nutze besser ein anderes System – man verweist direkt darauf, dass dann etwa die Blogsoftware Serendipity (mit BSD-Lizenz) eine Alternative wäre. Mit anderen Worten: In der WordPress-Community wird Eigentum an Code bewusst aufgeweicht – was an Code auf der WP-Plattform läuft, soll gemeinschaftliches Gut sein.
Juristisch ist interessant, dass es kaum Gerichtsurteile gibt, ob ein WordPress-Plugin zwangsläufig GPL sein muss. Theoretisch könnte ein Plugin-Entwickler argumentieren, sein Code sei kein abgeleitetes Werk, weil er z.B. abstrakte Schnittstellen nutzt. Die GPL-Frage bei Plugins ist also nicht gerichtsfest geklärt. Aber praktisch gilt: Wer sein Plugin im offiziellen Repository anbieten will, kommt um GPL-kompatible Lizenz nicht herum. Automattic, die Firma hinter WordPress.com, sowie die Community, achten streng auf diese Regel. Ein berühmter Fall war der Konflikt um das Thesis-Theme 2010: Dessen Entwickler weigerte sich zunächst, sein (kommerzielles) WordPress-Theme unter GPL zu stellen. Es entbrannte ein öffentlicher Schlagabtausch mit Mullenweg – am Ende lenkte der Entwickler ein und das Theme wurde GPL-kompatibel lizenziert. Die Botschaft ist klar: In der WordPress-Welt hat proprietäre Lizenzpolitik keinen Platz.
Für mich als Plugin-Entwickler heißt das: Ja, praktisch sollten alle WordPress-Plugins GPL-kompatibel sein, schon um mit der Plattform konform zu gehen. Die PHP-Codebestandteile eines Plugins gelten nach überwiegender Ansicht als von WordPress abgeleitet und müssen daher GPL sein. (Übrigens: HTML/JS/CSS oder Bilder in Themes/Plugins könnten separat lizenziert werden – oft wird hier ein „Split License“-Modell genutzt, wo nicht-code Elemente anders lizenziert sind. Das führt aber jetzt zu weit.) Jedenfalls: Ich stelle mir vor, ich veröffentliche mein Plugin unter GPL. Dann darf es jeder kopieren, nutzen, ändern – sogar weiterverkaufen, wenn er mag, weil die GPL das erlaubt. Heißt das nun, ich verschenke mein “Eigentum“ und habe nichts mehr davon?
Mit GPL-Software Geld verdienen – Paradox oder Chance?
Die Frage aller Fragen für Entwickler freier Software lautet: Kann man damit eigentlich Geld verdienen? Schließlich darf jeder Nutzer meinen GPL-Code ohne Bezahlung nutzen oder weitergeben. Wovon soll ich als Entwickler leben, wenn mein Produkt quasi gemeinfrei scheint?
Die Praxis zeigt: Ja, es geht. Und zwar oft besser, als man denkt. WordPress selbst ist ein leuchtendes Beispiel: Trotz (oder gerade wegen) der GPL ist WordPress zur dominierenden Web-Plattform geworden – und Automattic, das Unternehmen hinter vielen WP-Diensten, wurde mit Services wie WordPress.com, WooCommerce oder VIP-Hosting hunderte Millionen schwer. Matt Mullenweg persönlich hat ein geschätztes Vermögen von etwa 400 Millionen US-Dollar aufgebaut, dank seiner Beteiligung an Automattic. Sein Erfolg beruht nicht darauf, dass er WordPress verkauft hätte – das wäre gegen die GPL – sondern darauf, dass er Dienstleistungen und Zusatzangebote rund um die freie Software monetarisiert. Ähnlich machen es viele Unternehmen in der Open-Source-Welt: Red Hat verdient an Support-Verträgen für Linux, Datenbank-Anbieter verdienen an gehosteten Lösungen, etc. Mit freier Software lässt sich also durchaus frei nach dem Motto verdienen: Support, Service, Komfort.
Konkret im WordPress-Plugin-Markt sieht das so aus: Viele Plugins werden zwar unter GPL veröffentlicht, aber als “Premium-Plugins” verkauft. Wie passt das zusammen? Nun, wenn ich ein Plugin kaufe, zahle ich eigentlich für Mehrwert drumherum, nicht für den Code an sich. Typische Einnahmequellen sind:
- Updates & Sicherheitsaktualisierungen: Wer einen Lizenzschlüssel kauft, erhält automatische Updates. Klar könnte man den Code auch irgendwo gratis finden – aber man bekäme keine bequemen 1-Klick-Updates direkt im Dashboard. Und wenn WordPress ein Core-Update ausrollt, will man sicher sein, dass das Plugin kompatibel bleibt. Die zahlenden Nutzer finanzieren diese kontinuierliche Wartung.
- Support & Dienstleistungen: Kauf-User haben Anspruch auf Support. Wenn etwas nicht läuft oder man eine Frage hat, hilft der Entwickler (oder sein Team). Nutzer von „geklauten“ oder frei verfügbaren Kopien schauen dann in die Röhre – Support gibt’s nur für zahlende Kunden. Gerade im Business-Umfeld zahlen Firmen gerne, um einen Ansprechpartner zu haben.
- Zusatz-Features über externe Services: Manche Plugins bieten Grundfunktionen lokal an, haben aber erweiterte Features, die einen Server oder Dienst des Anbieters erfordern (z.B. ein Statistik-Plugin, das komplexe Auswertungen auf einer Webplattform anbietet). Diese Dienste sind dann oft nur mit gültiger Lizenz nutzbar. Das heißt, selbst wenn der Code GPL ist, bringt einem ein Schwarzkopie nichts, weil die Premium-Features serverseitig verifiziert werden. Beispiele sind API-Zugänge, Cloud-Dienste oder Content-Abonnements im Plugin.
- Freemium-Modelle: Häufig gibt es eine abgespeckte freie Version (GPL) und eine Pro-Version mit erweitertem Funktionsumfang. Formal sind beide meist GPL, aber die Pro-Version wird nur gegen Bezahlung herausgegeben. Zwar dürfte ein Kunde auch die Pro-Version weitergeben (GPL bleibt GPL), doch die Masse der Nutzer macht das nicht, schon aus Bequemlichkeit und Fairness. Die Entwickler vertrauen hier ein Stück weit auf die Ehrlichkeit der Community – und werden erstaunlich oft bestätigt. Viele WordPress-Nutzer wollen legitime Lizenzen haben, sei es aus moralischen Gründen oder weil sie wissen, dass nur so der Fortbestand des Projekts gesichert ist.
- Keine Lust auf Hürden: Selbst technisch versierte Leute greifen oft lieber direkt beim Anbieter zu, anstatt auf zwielichtigen Seiten nach „nullted“ Plugins zu suchen, die vielleicht Malware enthalten. Die GPL-Freiheit bedeutet zwar, dass jemand das Plugin irgendwo kostenlos bereitstellen könnte – aber der Durchschnittsanwender macht sich die Mühe nicht. Er kauft lieber offiziell und bekommt dafür Gewissheit, Updates und Support.
Man sieht: Freie Lizenz heißt nicht automatisch kostenloser Nullertrag. Es verlagert nur das Geschäftsmodell. Als Entwickler verkaufe ich dann nicht mehr das Stück Software an sich (das kann ja frei kopiert werden), sondern Mehrwerte – seien es Updates, Komfort oder einfach Zeitersparnis. Das funktioniert in der Praxis so gut, dass es ein ganzer Wirtschaftszweig geworden ist. WordPress-Theme-Shops, Plugin-Marktplätze, SaaS-Extensions für Open-Source-Tools – überall zahlt man für das Drumherum, während der Kern frei bleibt.
Fazit: Wem gehört die Software?
Rechtlich gesehen gehört Software im deutschen/eurpäischen Verständnis zunächst einmal dem Urheber – allerdings nicht als Sache, sondern als Bündel von Rechten (geistiges Eigentum). Der Nutzer einer Software „besitzt“ sie nicht im dinglichen Sinn, erhält aber je nach Vertragsmodell teils eigentumsähnliche Befugnisse (insbesondere beim unbefristeten Kaufrecht, das ihm sogar den Weiterverkauf erlaubt). In den USA ist man zurückhaltender mit solchen Nutzerrechten – Software verbleibt oft unter der Kontrolle des Herstellers als bloße Lizenz.
Philosophisch stellt die Open-Source-Bewegung das klassische Eigentumsdenken auf den Kopf: Hier wird bewusst auf ausschließende Eigentumsansprüche verzichtet zugunsten einer offenen Nutzung für alle. Das Erstaunliche dabei: Dieses Modell muss nicht zum finanziellen Nachteil der Entwickler sein, wie WordPress und zahllose andere Beispiele zeigen. Man kann Software teilen und trotzdem mit ihr Erfolg haben – Eigentum an Software ist also kein Muss, um Wertschöpfung zu erzielen.
Für mein eigenes WordPress-Plugin nehme ich aus dieser Recherche jedenfalls mit: Alle Zeichen stehen auf GPL. Ja, das fühlt sich erstmal an, als würde ich mein „Baby“ in die Wildnis entlassen, wo jeder damit machen kann, was er will. Aber letztlich behalte ich als Urheber gewisse Rechte und vor allem die Urheberschaft (niemand darf meinen Namen vom Code trennen). Und vielleicht entscheide ich mich, mein Plugin zweigleisig anzubieten: eine freie Basisversion und zusätzliche Services gegen Entgelt. So oder so – Eigentum im klassischen Sinn habe ich an meinem Code nicht, aber dafür Freiheit, Kreativität und die Chance, Teil etwas Größerem zu sein. Und das ist doch auch eine Form von Bereicherung – im ideellen wie im (hoffentlich) monetären Sinn.
Quellen: Die Angaben und Zitate in diesem Beitrag stammen aus aktuellen juristischen Fachbeiträgen, Blogartikeln und Urteilen, u.a. zum Urheberrechtsschutz von Software, zum deutschen Sachenrecht und seinem Umgang mit digitalen Gütern, aus einem Interview zur Weiterveräußerung gebrauchter Software in der EU, aus den Lizenzbedingungen der WordPress-Community sowie aus US-Quellen zur „First Sale“-Problematik bei Softwarelizenzen. Diese rechtsvergleichende Betrachtung zeigt: Die Frage „Wem gehört Software?“ lässt sich nicht banal mit „dem Eigentümer“ beantworten – es kommt darauf an, welches Rechtssystem man fragt und ob man bereit ist, auch alternative Modelle wie Open Source in Betracht zu ziehen. Software mag kein Ding sein, aber Bedeutung und Wert kommt es nicht zuletzt durch die Rechte zu, die wir ihm geben. In diesem Sinne: Happy Coding – und mögen eure Rechte an eurem Code stets gewahrt bleiben, ob als Eigentum oder nicht!