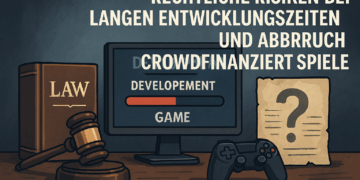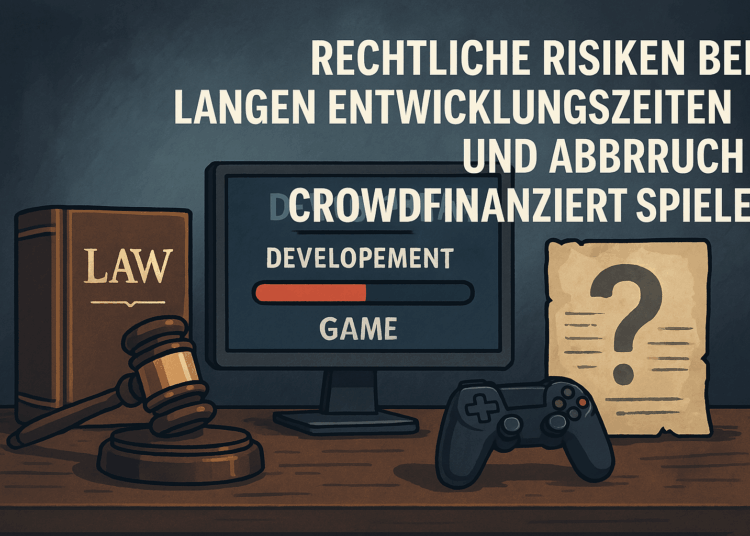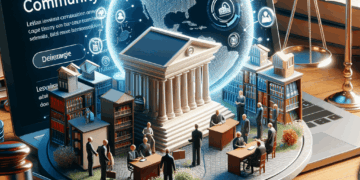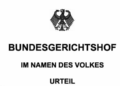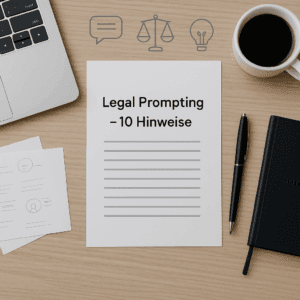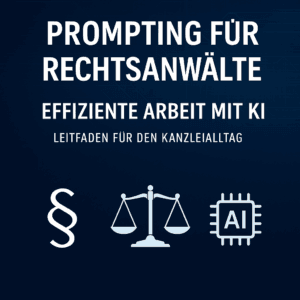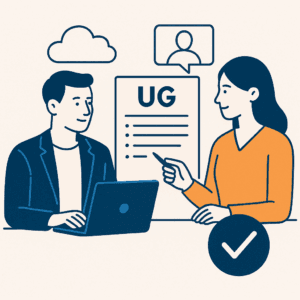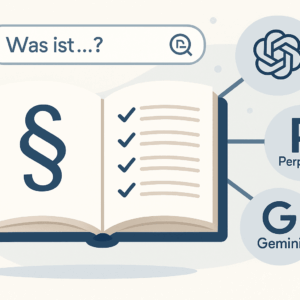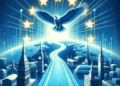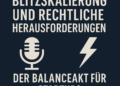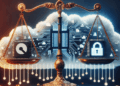Crowdfunding hat sich als Finanzierungsmodell in der Spielebranche etabliert. Entwickler sammeln Geld von Unterstützern, um die Entwicklung eines Spiels vorzufinanzieren – sei es über Plattformen wie Kickstarter oder Indiegogo, oder mittels Preorder-Optionen auf der eigenen Website. Kommt es jedoch zu erheblichen Verzögerungen in der Entwicklung oder gar zum Abbruch des Projekts, entstehen für die Entwickler erhebliche juristische Risiken. Im Folgenden wird umfassend beleuchtet, welche rechtlichen Konsequenzen drohen und welche Verpflichtungen Entwickler in solchen Situationen gegenüber den Backern (Unterstützern) haben.
Rückerstattungsansprüche der Unterstützer
Ein zentrales Risiko bei ausbleibender Fertigstellung oder überlanger Entwicklungszeit ist der Anspruch der Unterstützer auf Rückerstattung ihres Geldes. Wenn ein versprochenes Spiel nicht binnen angemessener Frist geliefert wird oder endgültig scheitert, können Backer ihr Geld zurückverlangen. Rechtlich hängt dieser Anspruch davon ab, welcher Vertragstyp dem Crowdfunding zugrunde liegt und welche Vereinbarungen getroffen wurden:
- Auf Crowdfunding-Plattformen (z. B. Kickstarter, Indiegogo): Die Nutzungsbedingungen solcher Plattformen sehen vor, dass der Vertrag über die Finanzierung direkt zwischen Entwickler (Projektinitiator) und Unterstützer zustande kommt. Wird das versprochene Produkt (das Spiel oder andere Rewards) nicht geliefert, liegt eine Nichterfüllung des Vertrags vor. Unterstützer haben dann grundsätzlich das Recht, vom Vertrag zurückzutreten und ihr Geld zurückzufordern. Praktisch bedeutet das, der Entwickler muss die erhaltenen Beiträge erstatten. Kickstarter selbst etwa formuliert in seinen Richtlinien, dass Projektinitiatoren entweder die zugesagten Rewards liefern oder die Unterstützungsgelder zurückzahlen müssen, falls die Erfüllung scheitert. Ähnliches gilt auf Indiegogo – auch wenn dort bei flexiblen Finanzierungsmodellen das Geld auch bei Nichterreichen des Finanzierungsziels ausgezahlt wird, entbindet dies nicht von der Pflicht, entweder zu liefern oder zu erstatten.
- Bei Preorder-Modellen über eigene Websites: Hier schließen Unterstützer oft einen Kaufvertrag oder einen Vertrag über die zukünftige Lieferung eines Spiels direkt mit dem Entwicklerstudio. Kommt das Studio seiner Lieferpflicht nicht nach, haben Käufer nach allgemeinem Vertragsrecht Anspruch auf Rückabwicklung. Insbesondere im Verbraucherschutzrecht (z. B. in der EU) ist vorgesehen, dass bei Nicht-Lieferung innerhalb einer vereinbarten oder angemessenen Frist der Verbraucher nach Fristsetzung vom Vertrag zurücktreten und den gezahlten Betrag zurückverlangen kann. Verzögert sich die Entwicklung übermäßig, können Unterstützer also eine letzte Nachfrist setzen. Verstreicht auch diese fruchtlos, besteht ein gesetzlicher Rücktrittsanspruch (§ 323 BGB in Deutschland) – der Entwickler muss dann den gezahlten Betrag erstatten.
Wichtig ist: Diese Rückerstattungsansprüche bestehen unabhängig davon, ob die Verzögerung auf unvorhergesehene Schwierigkeiten oder Fehlkalkulationen zurückzuführen ist. Aus Sicht der Unterstützer wurde Geld in Erwartung einer Gegenleistung gegeben. Bleibt diese aus, darf kein „Geld gegen Nichts“ stehen. Für Entwickler kann dies finanzielle Konsequenzen haben, gerade wenn die bereits eingesetzten Mittel nicht mehr verfügbar sind – im Extremfall droht die Insolvenz, wenn zahlreiche Backer gleichzeitig ihr Geld zurückverlangen.
Betrugsvorwürfe und zweckwidrige Mittelverwendung
Ein weiteres erhebliches Risiko sind Betrugsvorwürfe, insbesondere wenn der Verdacht besteht, dass eingesammelte Gelder zweckwidrig verwendet oder von Anfang an keine ernsthafte Entwicklungsabsicht bestanden hat. Juristisch steht hier der Straftatbestand des Betrugs im Raum (§ 263 StGB in Deutschland bzw. entsprechende Bestimmungen in anderen Ländern).
- Vorspiegelung falscher Tatsachen: Sollte sich herausstellen, dass ein Entwickler bereits zum Zeitpunkt der Kampagne wusste, dass das Projekt nicht realisierbar ist, oder absichtlich falsche Versprechen gemacht hat, um an Gelder zu gelangen, kann dies als Eingehungsbetrug gewertet werden. In einem solchen Fall hätten Unterstützer ihr Geld unter falschen Vorstellungen gegeben. Strafrechtlich kann dies zu Ermittlungen führen – Entwickler müssten dann damit rechnen, dass neben zivilrechtlichen Rückforderungen auch strafrechtliche Ermittlungsverfahren wegen Betrugs eingeleitet werden. In der Praxis gab es international bereits Fälle, in denen gegen Initiatoren gescheiterter Crowdfunding-Projekte wegen genau solcher Vorwürfe vorgegangen wurde.
- Zweckentfremdung der Gelder: Selbst wenn anfangs die Absicht seriös war, kann die Verwendung der Gelder zum Problem werden. Crowdfunding-Beiträge sind zweckgebunden für die Entwicklung des konkreten Projekts. Wird das Geld stattdessen in private Anschaffungen oder andere Projekte umgelenkt, fühlen sich Unterstützer getäuscht. Zwar handelt es sich bei den Beiträgen rechtlich nicht um Treuhandgelder (der Entwickler erlangt mit Auszahlung Eigentum daran), doch eine zweckwidrige Verwendung kann rückblickend als Indiz für Bereicherungsabsicht gewertet werden. In einigen Ländern haben Verbraucherschutzbehörden und Staatsanwaltschaften bereits durchgegriffen: In den USA etwa hat die Federal Trade Commission (FTC) 2015 gegen einen Kickstarter-Projektstarter Maßnahmen ergriffen, der erhaltene Gelder nicht für das beworbene Projekt verwendete. Auch lokale Staatsanwälte (z. B. der Attorney General im Bundesstaat Washington) haben in Fällen offensichtlicher Zweckentfremdung Klage eingereicht, was zu strafrechtlichen Sanktionen und zur Verpflichtung führte, die Gelder an die Unterstützer zurückzuzahlen.
- Gutgläubiges Scheitern vs. betrügerisches Scheitern: Juristisch wird differenziert, warum ein Projekt scheitert. Ein gutgläubiges Scheitern – etwa durch technische Probleme, Fehleinschätzungen oder äußere Umstände – löst zivilrechtliche Konsequenzen (Vertragsverletzung, Rückabwicklung) aus, aber in der Regel keine strafrechtlichen, solange der Entwickler transparent agiert und keine Täuschungsabsicht vorlag. Anders beim betrügerischen Scheitern: Wurden z. B. schon während der Kampagne falsche Angaben gemacht, Fortschritte vorgetäuscht oder Risiken verschwiegen, um Unterstützer zu gewinnen, kann dies im Nachhinein als Betrug gewertet werden. Entwickler müssen also größte Sorgfalt walten lassen, wahrheitsgemäße Angaben zu machen und Gelder projektbezogen einzusetzen, um nicht dem Vorwurf eines Betrugs auszusetzen zu sein.
Vertragliche Verpflichtungen des Entwicklers
Unabhängig von der strafrechtlichen Ebene bestehen vertragliche Hauptpflichten des Entwicklers gegenüber den Unterstützern. Mit dem Zustandekommen der Finanzierung entsteht ein Vertrag, aus dem beiderseitige Pflichten resultieren: Der Unterstützer stellt Geld zur Verfügung, der Entwickler schuldet im Gegenzug eine definierte Leistung (meist das fertige Spiel, oft inkl. zusätzlicher Belohnungen wie T-Shirts, Zugang zur Beta, etc.).
- Lieferung der versprochenen Leistung: Die wichtigste vertragliche Verpflichtung des Entwicklers ist es, das angekündigte Spiel (bzw. die Rewards) in der versprochenen Form zu liefern. Diese Pflicht zur vertraglichen Erfüllung steht im Zentrum. Wird das Spiel gar nicht fertiggestellt, liegt eine Nichterfüllung vor. Wird es erst mit erheblicher Verspätung fertig, kann je nach Vereinbarung auch das als Pflichtverletzung gelten, insbesondere wenn ein bestimmter Lieferzeitpunkt oder zumindest ein ungefährer Zeitraum zugesagt war. Viele Kampagnen geben einen voraussichtlichen Liefertermin an („Estimated Delivery: Oktober 2023“ etc.). Juristisch kann ein solcher Termin verbindlich oder unverbindlich sein, je nachdem wie er kommuniziert wird. Wurde er als bloße Schätzung deklariert, könnte der Entwickler argumentieren, dass keine feste Frist vereinbart war. Dennoch darf die Verzögerung nicht unangemessen sein – was unangemessen ist, beurteilt sich nach den Umständen (für ein komplexes Spiel sind einige Monate Verzögerung vielleicht hinnehmbar, mehrere Jahre hingegen kaum).
- Nebenpflichten und Sorgfalt: Neben der Hauptleistungspflicht bestehen aus dem Vertrag auch Nebenpflichten. Dazu gehört beispielsweise, alles Zumutbare zu unternehmen, um das Projekt zum Erfolg zu führen. Der Entwickler schuldet nicht nur irgendwann irgendein Produkt, sondern dasjenige, das im Kampagnenversprechen beschrieben wurde. Inhaltliche gravierende Abweichungen oder ein deutlich qualitativ minderwertiges Endprodukt könnten ebenfalls als Verletzung der vertraglichen Pflichten gewertet werden, da die erhaltene Leistung dann nicht der zugesicherten entspricht (Stichwort: Gewährleistung bei Sach- oder Rechtsmängeln, übertragen auf digitale Güter). Zudem hat der Entwickler die Pflicht, die Interessen der Unterstützer nicht zu verletzen – z. B. keine Interna der Backer zu missbrauchen, keine willkürlichen Veränderungen am Geschäftsmodell vorzunehmen, die die Unterstützer ihrer Rechte berauben, etc.
- Vertragsart – Kauf oder Werkvertrag: In rechtlicher Hinsicht ist die genaue Einordnung des Vertrags interessant. Handelt es sich bei einer Unterstützer-Zahlung um einen Kaufvertrag (Vorabkauf eines zukünftigen Spiels) oder um einen Werkvertrag (Beauftragung, ein bestimmtes Spiel herzustellen)? Diese Unterscheidung wird im deutschen Recht diskutiert. Ein Werkvertrag (§ 631 BGB) verpflichtet den Entwickler, ein versprochenes Werk herzustellen, wobei der Besteller (Unterstützer) bis zur Abnahme grundsätzlich nicht zahlen muss – im Crowdfunding wird allerdings vorab gezahlt, was eher untypisch für klassische Werkverträge ist. Ein Kaufvertrag (§ 433 BGB) verpflichtet zur Lieferung einer Sache gegen Bezahlung; hier wird im Voraus bezahlt mit Lieferung in der Zukunft. Praktisch relevant ist die Unterscheidung vor allem für rechtliche Details (etwa Gewährleistungsfristen, Abnahme, etc.), weniger für die Kernfrage der Lieferung oder Rückzahlung. In beiden Fällen gilt: Ohne Lieferung keine Gegenleistung – bleibt das Werk aus, kann der Besteller/ Käufer sein Geld zurückverlangen. Für den Entwickler bedeutet das, dass unabhängig von der genauen Vertragsqualifikation die vertragliche Verpflichtung zur Erfüllung der Leistungszusage besteht.
- Unmöglichkeit der Leistung: Scheitert das Projekt endgültig, tritt juristisch gesehen Unmöglichkeit der Leistung ein (§ 275 BGB für Deutschland: der Entwickler kann die geschuldete Leistung nicht mehr erbringen). Die Folge ist, dass der Anspruch des Entwicklers auf die Gegenleistung entfällt (§ 326 BGB) – d. h. er darf das erhaltene Geld nicht behalten, da ja die versprochene Leistung ausbleibt. Das untermauert nochmals den Anspruch der Unterstützer auf Rückerstattung und stellt klar: Der Entwickler kann sich nicht einseitig aus der Verpflichtung stehlen, indem er das Projekt abbricht; er muss dann die erhaltenen Beiträge grundsätzlich erstatten (es sei denn, individuell wird eine andere Lösung mit den Backern vereinbart, wie z. B. die Umwandlung in freiwillige Spenden).
Informations- und Rechenschaftspflichten
Während der Entwicklungszeit – vor allem wenn sie länger dauert als angekündigt – spielt die Kommunikation mit den Unterstützern eine wichtige Rolle. Rechtlich ist zu fragen, inwieweit der Entwickler verpflichtet ist, über Fortschritte, Verzögerungen oder Probleme zu informieren und Rechenschaft über die Mittelverwendung abzulegen.
- Vertragliche oder gesetzliche Informationspflichten: Anders als beispielsweise bei Aktionären oder Investoren gibt es bei Crowdfunding-Backern in der Regel keine ausdrücklich gesetzlich normierte Rechenschaftspflicht des Entwicklers. Allerdings können sich Informationspflichten aus dem Grundsatz von Treu und Glauben (§ 242 BGB) ergeben. Wenn absehbar ist, dass ein Liefertermin nicht gehalten werden kann oder Schwierigkeiten die Fertigstellung gefährden, muss der Entwickler zumindest im Rahmen des Zumutbaren die Unterstützer nicht im Unklaren lassen. Oft verpflichten bereits die Plattformregeln oder die implizite Erwartung der Community die Projektstarter zu regelmäßigen Updates. Kickstarter etwa fordert Projektinitiatoren auf, ihre Unterstützer auf dem Laufenden zu halten und offen über Probleme zu berichten. Ein völliges Abtauchen ohne Kommunikation kann nicht nur das Vertrauen zerstören, sondern wird rechtlich als Verletzung der Nebenpflichten gesehen – insbesondere wenn dadurch den Unterstützern Möglichkeiten genommen werden, ihre Rechte (z. B. Rücktritt) wahrzunehmen.
- Rechenschaft über Mittelverwendung: Viele Backer erwarten zu Recht, dass ihre Gelder auch tatsächlich ins Projekt fließen. Eine detaillierte Abrechnung schuldet der Entwickler zwar nicht automatisch jedem Backer; jedoch kann im Fall eines Scheiterns Transparenz über die Mittelverwendung entscheidend sein. Zum einen beruhigt es die Gemüter der Unterstützer, wenn sie erfahren, dass das Geld z. B. vollständig in Entwicklungsaufwand, Lizenzen und Material geflossen ist – dies kann den Vorwurf der Bereicherung entkräften. Zum anderen kann im Streitfall (etwa vor Gericht) vom Entwickler verlangt werden darzulegen, warum eine Rückzahlung nicht (vollständig) möglich ist, und wohin die Gelder geflossen sind. Plattformen verlangen in ihren Richtlinien häufig, dass bei Projektabbruch erläutert wird, was mit den Mitteln geschehen ist. Rechtlich könnte ein Backer bei totalem Scheitern argumentieren, er habe einen Anspruch auf Auskunft über die Verwendung seiner Mittel – direkt gesetzlich vorgesehen ist das zwar nicht, aber im Rahmen von Schadensersatzprozessen oder Betrugsermittlungen käme eine solche Frage ohnehin auf. Für Entwickler ist es daher ratsam, gründliche Buchführung über die eingesetzten Gelder zu führen, um im Ernstfall Rechenschaft ablegen zu können.
- Kommunikation als Prävention: Auch wenn nicht jede Verzögerung automatisch juristische Schritte nach sich zieht, ist eine offene Informationspolitik der beste Weg, um Eskalationen vorzubeugen. Viele rechtliche Konflikte entstehen erst, wenn Unterstützer sich getäuscht oder im Stich gelassen fühlen. Regelmäßige Projekt-Updates, ehrliche Eingeständnisse von Rückschlägen und das Aufzeigen eines Plans können verhindern, dass Backer voreilig rechtliche Mittel ergreifen. Zwar ersetzt eine gute Kommunikation keine vertraglichen Rechte – ein Backer behält trotz aller netten Updates seinen Rücktrittsanspruch, wenn die Leistung ausbleibt. Aber aus Entwicklersicht können Transparenz und Dialog dazu beitragen, einvernehmliche Lösungen (wie z. B. freiwillige Verlängerung der Wartezeit durch die Unterstützer oder Teil-Rückerstattungen) zu erreichen, statt sofort mit Anwalt oder Behörde konfrontiert zu werden.
Plattformbedingungen und Haftungsausschlüsse
Crowdfunding-Plattformen wie Kickstarter und Indiegogo versuchen, einen rechtlichen Rahmen vorzugeben, der ihre eigene Haftung ausschließt und die Pflichten zwischen Entwickler und Backer regelt. Entwickler müssen diese Plattformbedingungen genau kennen, da sie einerseits bestimmte Verpflichtungen festschreiben und andererseits aber auch keine vollständige Immunität bieten.
- Haftung der Plattform vs. Haftung des Entwicklers: Generell schließen Plattformen ihre eigene Haftung weitgehend aus. Kickstarter z. B. weist ausdrücklich darauf hin, dass keine Garantie für das Gelingen eines Projekts oder die Lieferung der versprochenen Belohnungen übernommen wird. Die Verantwortung liegt vollständig beim Projektinitiator. Unterstützer sollen sich bewusst sein, dass sie auf eigenes Risiko unterstützen. Für den Entwickler bedeutet dies: Er kann sich im Streitfall nicht darauf berufen, die Plattform habe irgendetwas zu verantworten – rechtlich richten sich Ansprüche der Backer direkt gegen ihn. Gleichzeitig warnt Kickstarter (wie in Wikipedia zitiert) alle Projektstarter, dass sie für eventuelle Schadensersatzforderungen der Sponsoren haften, falls sie ihre Zusagen nicht einhalten. Diese Warnung macht klar, dass die Plattform zwar nicht haftet, wohl aber der Entwickler im vollen Umfang.
- Nutzungsbedingungen und Verpflichtungen: Die Terms of Use der Plattformen enthalten meist konkrete Vorgaben. Bei Kickstarter verpflichten sich Entwickler mit dem Einstellen eines Projekts unter anderem, das Geld zweckentsprechend zu verwenden und die Rewards bei Erfolg zu erfüllen. Sollte ein Entwickler das Projekt nicht abschließen können, verlangen die Kickstarter-Richtlinien, dass er alles daran setzt, eine Lösung zu finden – hierzu zählt insbesondere, verbleibende Gelder zurückzuerstatten oder zumindest einen Plan zur teilweisen Erfüllung vorzulegen. Indiegogo hat ähnliche Regeln; dort kommt hinzu, dass bei „flexible funding“-Kampagnen (bei denen auch ohne Erreichen des Ziels Geld fließt) die Erwartung ist, dass der Kampagnenstarter die zugesagte Leistung möglichst erbringt oder andernfalls aktiv mit den Unterstützern an einer Lösung arbeitet (was oft Rückerstattungen beinhaltet). Verstöße gegen die Plattform-AGB können dazu führen, dass der Entwickler von weiteren Kampagnen ausgeschlossen wird und – sollte betrügerisches Verhalten vorliegen – möglicherweise an Behörden gemeldet wird.
- Haftungsklauseln gegenüber den Unterstützern: Manche Entwickler versuchen, in ihren Projektbeschreibungen oder eigenen AGB (insbesondere bei Preorder auf der eigenen Website) Haftungsbeschränkungen oder Ausschlüsse von Rückerstattungen zu formulieren. Hier ist Vorsicht geboten: Im Verbraucherrecht (etwa in Deutschland nach §§ 307 ff. BGB) sind Klauseln, die dem Verbraucher wesentliche Rechte nehmen – z. B. pauschal „Rückerstattung ausgeschlossen“ oder „Liefertermine unverbindlich, keine Ansprüche bei Verzögerung“ – oft unwirksam, sofern sie ihn unangemessen benachteiligen. Plattformbedingungen selbst unterliegen zwar nicht direkt der AGB-Kontrolle durch den Entwickler (da sie von der Plattform gestellt werden), aber ein Entwickler, der seine eigenen Bedingungen gestaltet (z. B. auf der eigenen Shop-Seite), muss die gesetzlichen Schranken beachten. Pauschale Gewährleistungsausschlüsse oder Haftungsfreizeichnungen sind in vielen Rechtsordnungen im B2C-Bereich unwirksam. Das heißt: Selbst wenn in einer Kampagne kleingedruckt steht, dass Verzögerungen kein Rücktrittsrecht geben, könnte ein Gericht dies anders sehen und den Verbraucherschutz höher gewichten. Entwickler sollten daher nicht darauf vertrauen, dass sie sich durch eigene Klauseln von der Verantwortung freizeichnen können.
- Governing Law und Gerichtsstand: Plattformen legen häufig fest, welches Recht auf die Vertragsbeziehung Anwendung findet (z. B. bei Kickstarter üblicherweise das Recht des US-Bundesstaats New York) und welche Gerichte zuständig sind. Allerdings gelten diese Klauseln in der Regel nur zwischen Plattform und Entwickler bzw. Plattform und Nutzer. Die eigentliche Vertragsbeziehung zwischen Entwickler und Backer kann davon unberührt sein, insbesondere wenn der Entwickler und der Unterstützer im selben Land sitzen. Beispiel: Ein deutscher Unterstützer backing ein Projekt eines deutschen Entwicklers auf Kickstarter – trotz der Plattform in den USA kann der Vertrag als in Deutschland geschlossen gelten und deutsches Recht maßgeblich sein. Für den Entwickler bedeutet das potenziell, dass er sich nicht darauf verlassen kann, bei Streitigkeiten immer in den USA unter amerikanischem Recht verklagt zu werden; ein Verbraucher könnte ihn auch im Heimatland vor Gericht ziehen, sofern Verbraucherschutzregeln dies zulassen (Stichwort EU-Verbrauchergerichtsstand). Es lohnt sich also, die Plattformbedingungen nicht nur pflichtbewusst abzunicken, sondern ihren Inhalt und ihre Grenzen zu verstehen.
Deutscher und europäischer Rechtsrahmen
Crowdfunding findet oft global statt, aber Entwickler mit Sitz in Deutschland oder der EU sowie Unterstützer aus diesen Regionen unterliegen speziellen verbraucherschützenden Vorschriften. Die rechtliche Einordnung der Unterstützerleistungen und die Frage, welche Rechte diesen zustehen, sind im deutschen und europäischen Recht besonders relevant.
Einordnung der Unterstützerleistung: Schenkung, Kauf oder Werkvertrag?
Im deutschen Recht ist entscheidend, wie die Leistung der Unterstützer rechtlich zu qualifizieren ist, denn davon hängen viele Pflichten und Rechte ab:
- Schenkung (Spende): Handelt es sich um eine unentgeltliche Zuwendung ohne Gegenleistung, könnte man von einer Schenkung (§ 516 BGB) sprechen. Einige Crowdfunding-Unterstützer wählen z. B. bewusst einen Beitrag ohne jegliche Reward, schlicht um das Projekt zu fördern. Juristisch hätte ein solcher Unterstützer tatsächlich keinen Anspruch auf eine Gegenleistung – er hat ja bewusst geschenkt. Allerdings sind reine Spenden in den großen Plattformen die Ausnahme; meist erwarten die Geldgeber zumindest eine symbolische Gegenleistung (Nennung im Abspann, T-Shirt o. ä.). Sobald aber irgendeine Gegenleistung versprochen wird, liegt gerade keine Schenkung mehr vor, sondern ein synallagmatischer (gegenseitiger) Vertrag.
- Kaufvertrag: Sehr häufig entspricht die Crowdfunding-Konstellation einem Kauf auf Vorauszahlung. Der Unterstützer „kauft“ das zukünftige Produkt (etwa das Spiel als Download oder Boxed Edition) und bezahlt sofort, obwohl geliefert erst in der Zukunft wird. Dies lässt sich unter § 433 BGB (Kaufvertrag) fassen: Der Entwickler als Verkäufer muss die Kaufsache zum vereinbarten Zeitpunkt liefern, der Käufer hat bereits gezahlt (bzw. zahlt bei Erfolg der Kampagne). Auch andere Goodies (Figuren, Artbooks etc.) sind letztlich Kaufgegenstände. Die meisten Gerichte würden einen solchen Vertrag wohl als Kauf ansehen, da ein fertiges Produkt geschuldet ist – auch wenn es erst noch produziert werden muss.
- Werkvertrag: In manchen Fällen könnte man argumentieren, es handelt sich um einen Werkvertrag (§ 631 BGB), da der Entwickler ja ein „Werk“ (das Spiel) speziell herstellt und der Unterstützer als Besteller gewissermaßen den Auftrag erteilt. Der Unterschied zum Kauf ist fließend: Werkverträge sind typisch, wenn etwas individuell für den Besteller angefertigt wird (z. B. eine Software nach Kundenwunsch). Bei Spielen aus Crowdfunding ist das Produkt allerdings für eine Vielzahl von Nutzern gleich, nicht auf einzelne Backer personalisiert. Somit spricht viel dafür, eher vom Kaufvertrag auszugehen. Dennoch hat ein Werkvertrag ähnliche Pflichten: Der Hersteller schuldet die Erstellung des versprochenen Werks. Falls man also einen solchen Vertrag annimmt, wäre die Rechtsfolge bei Scheitern die gleiche – der Anspruch auf Vergütung entfällt, bereits Geleistetes wäre zurückzuzahlen.
- Mischformen und rechtliches Neuland: Crowdfunding bewegt sich zwischen Schenkung und Kauf – oft spricht man von einem hybriden Charakter. Die Entwickler argumentieren gerne, Backer seien „Unterstützer“ und keine Käufer, um die Unsicherheit des Outcomes zu betonen. Rechtlich lässt sich aber nicht leugnen, dass bei Gegenleistungsversprechen ein entgeltlicher Vertrag vorliegt. In Deutschland existiert zwar noch keine höchstrichterliche Entscheidung, die einen Crowdfunding-Vertrag klar typisiert, doch die Tendenz in der Literatur geht dahin, ihn wie einen normalen Vorverkaufsvertrag zu behandeln. Für Entwickler heißt das: Sie können sich vor Gericht nicht darauf berufen, das Geld sei ja nur eine freiwillige Spende gewesen – jedenfalls nicht, wenn sie eine konkrete Lieferung versprochen haben.
Verbraucherschutz im Fernabsatz: Widerrufsrecht und Lieferverzug
Gerade im europäischen und deutschen Kontext greifen Verbraucherschutzgesetze bei Crowdfunding-Transaktionen, da hier regelmäßig Fernabsatzverträge zwischen einem Unternehmer (dem Entwicklerstudio) und Verbrauchern (den Backern) geschlossen werden.
- Widerrufsrecht: Im klassischen Online-Handel steht Verbrauchern ein 14-tägiges Widerrufsrecht zu (§ 312g BGB, EU-Verbraucherrechterichtlinie 2011/83/EU). Das bedeutet, ein Verbraucher kann innerhalb von 14 Tagen nach Vertragsschluss oder Erhalt der Ware den Vertrag ohne Angabe von Gründen lösen und sein Geld zurückfordern. Überträgt man das auf Crowdfunding, ergibt sich ein brisantes Szenario: Wenn ein Entwickler mit Sitz in der EU ein Spiel per Preorder verkauft oder über Kickstarter finanzierte Vorbestellungen annimmt, könnten Verbraucher theoretisch innerhalb von 14 Tagen nach Zahlungsabschluss ihren Beitrag widerrufen. In der Praxis ist dies kaum in den Plattformabläufen vorgesehen – Kickstarter beispielsweise informiert die Backer nicht aktiv über ein EU-Widerrufsrecht, und viele Backer sind sich dieser Möglichkeit gar nicht bewusst. Rechtlich aber kann ein solches Widerrufsrecht bestehen. Der Entwickler müsste also im Grunde jeden EU-Unterstützer ordnungsgemäß über das Widerrufsrecht belehren. Unterlässt er das, bleibt das Widerrufsrecht sogar über die 14 Tage hinaus bestehen (in Deutschland bis zu 12 Monate verlängert). Das stellt ein erhebliches Risiko dar: Ein Backer könnte Wochen oder Monate nach Kampagnenende den Widerruf erklären und Rückzahlung verlangen, was den Finanzierungsplan durchkreuzt. Entwickler sollten daher zumindest wissen, dass diese Regel existiert. Einige umgehen sie, indem sie argumentieren, es handle sich um digitale Inhalte, bei denen das Widerrufsrecht erlischt, sobald mit der Vertragserfüllung begonnen wurde – doch dafür müsste der Backer ausdrücklich zustimmen, dass z.B. sofort mit digitalen Lieferungen begonnen wird und er dafür auf Widerruf verzichtet. Bei einem in ferner Zukunft liegenden Spiel greift diese Ausnahme jedoch nicht, da keine sofortige Lieferung erfolgt. Kurzum: Das Widerrufsrecht gilt im Crowdfunding grundsätzlich, und ein Entwickler, der dies ignoriert, riskiert rechtliche Probleme mit Verbraucherschützern oder einzelnen Backern.
- Lieferverzug und angemessene Frist: Ein weiterer Aspekt des Verbraucherschutzes ist die rechtzeitige Lieferung. Die EU-Richtlinie sieht vor, dass, wenn kein fester Liefertermin vereinbart ist, der Unternehmer binnen 30 Tagen liefern muss, ansonsten der Verbraucher mahnen und eine Nachfrist setzen kann. Nun ist bei Crowdfunding-Projekten von vornherein klar, dass 30 Tage nicht reichen – häufig liegen Monate oder Jahre zwischen Finanzierung und geplanter Fertigstellung. Allerdings wird meist ein voraussichtlicher Lieferzeitpunkt genannt. Wenn dieser deutlich überschritten wird, kann man von Lieferverzug sprechen. Nach deutschem Recht gerät der Schuldner (hier der Entwickler) spätestens dann in Verzug, wenn der Gläubiger (Backer) nach Fälligkeit mahnt (§ 286 BGB). Praktisch könnten Unterstützer also nach dem angekündigten Liefermonat eine Mahnung schicken, die Lieferung binnen einer bestimmten Frist verlangen und bei weiterem Verstreichen vom Vertrag zurücktreten. Dieses Vorgehen entspricht weitgehend dem oben erwähnten Rücktrittsanspruch wegen Nichterfüllung – es ist aber im Verbraucherschutz ausdrücklich unterstrichen, dass derartige Verzugsfälle den Verbraucher zum Vertragsausstieg berechtigen. Für den Entwickler bedeutet das, dass überlange Entwicklungszeiten automatisch das Risiko von Vertragskündigungen und Rückzahlungsverlangen erhöhen. Selbst wenn vertraglich kein „harter“ Liefertermin fixiert war, schützt dies nicht unbegrenzt vor Ansprüchen: Irgendwann gilt eine Wartezeit als unzumutbar. Was „unzumutbar“ ist, hängt von den Umständen ab, aber man kann sicher sein, dass eine Verdoppelung oder Verdreifachung der ursprünglich prognostizierten Entwicklungsdauer kritische Fragen nach sich zieht.
- Gewährleistungsrecht bei digitalen Produkten: Neuere EU-Regularien, wie die Richtlinie über digitale Inhalte (EU 2019/770, umgesetzt in Deutschland in §§ 327 ff. BGB), verstärken den Verbraucherschutz bei digitalen Leistungen. Danach muss ein digitales Produkt (wie ein Videospiel) zum vereinbarten Zeitpunkt und in der vereinbarten Beschaffenheit bereitgestellt werden. Kommt der Entwickler dem nicht nach, stehen dem Verbraucher Gewährleistungsrechte zu – darunter letztlich auch das Recht, vom Vertrag zurückzutreten, wenn Nachfristen fruchtlos bleiben. Übertragen auf Crowdfunding bedeutet das: Auch gesetzlich anerkannte Mängelrechte könnten greifen, wenn das gelieferte Spiel stark von dem abweicht, was versprochen war (qualitativer Mangel), oder wenn es gar nicht geliefert wird (juristisch gesehen Nichterfüllung, die ähnlich behandelt wird). Zwar mag man einwenden, Crowdfunding sei ein Sonderfall – doch die Gesetzestexte machen hier keinen Unterschied zwischen einem vorab gekauften Spiel und einem normal im Handel erworbenen.
Besonderheiten im deutschen Recht: AGB-Kontrolle und Rechtsfolgen bei Scheitern
Neben dem allgemeinen Vertrags- und Verbraucherrecht gibt es ein paar spezielle deutsche Rechtsthemen, die für crowdfinanzierte Spiele relevant sind:
- AGB-Kontrolle von Risikoausschlüssen: Wie erwähnt, sind Klauseln in Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche die Haftung oder Pflichten einseitig beschneiden, der gerichtlichen Kontrolle unterworfen. Ein Entwickler, der beispielsweise in seine Nutzungsbedingungen schreibt, „Die Lieferung des Spiels erfolgt, wenn möglich. Ein Anspruch auf Lieferung besteht nicht; der Unterstützer akzeptiert das Risiko des Scheiterns“, würde vor deutschen Gerichten kaum Erfolg haben. Eine solche Klausel würde den Vertrag praktisch aushöhlen – der Backer hätte keine Rechte mehr –, was unangemessen benachteiligt. Die Folge: Die Klausel wäre nichtig, und der Entwickler könnte sich nicht darauf berufen. Ähnliches gilt für Klauseln, die Rückerstattungen generell ausschließen oder den Rechtsweg ausschließen. Entwickler in Deutschland müssen ihre Vertragsbedingungen daher fair und gesetzeskonform gestalten. Transparenz über Risiken ist zwar erlaubt und sinnvoll, aber sie ersetzt nicht die gesetzlichen Mindestrechte der Verbraucher.
- Rechtsfolgen bei Projektabbruch: Interessant ist auch, ob man einen Crowdfunding-Beitrag bei Scheitern des Projekts vielleicht in einen Schenkungsvertrag umdeuten kann, um das Geld behalten zu dürfen. Denkbar wäre, dass Entwickler argumentieren: „Ihr habt uns ja unterstützt in dem Wissen um ein Risiko; damit habt ihr uns das Geld quasi geschenkt.“ Eine solche Interpretation würde jedoch der tatsächlichen Vereinbarung widersprechen, sofern Rewards versprochen waren. Das deutsche Recht kennt zwar den Wegfall der Geschäftsgrundlage (§ 313 BGB) als Instrument, um Verträge anzupassen, wenn unvorhersehbare Umstände eintreten. Ein Entwickler könnte versuchen zu sagen: „Die Entwicklung war wesentlich aufwändiger als gedacht – Geschäftsgrundlage war, dass wir mit dem Budget X auskommen. Diese ist entfallen, daher können wir den Vertrag so nicht erfüllen.“ In der Praxis würde das aber kaum dazu führen, dass Unterstützer ihr Geld nicht zurückbekommen; eher könnte man über Anpassungen (z. B. Verlängerung der Frist, zusätzliches Funding) reden. Wenn das Projekt abgebrochen wird, bleibt es dabei: Ohne Leistung kein Geld. Sollte der Entwickler insolvent werden, sind die Unterstützer leider reguläre Insolvenzgläubiger – sie müssen ihre Forderungen anmelden und würden im schlimmsten Fall nur eine Quote (oder nichts) erhalten. Dieses Insolvenzrisiko trägt faktisch der Backer, was ein inhärenter Nachteil von Crowdfunding ist. Aber solange der Entwickler zahlungsfähig ist, wird das Recht ihn zwingen, die erhaltenen Gelder zu erstatten, anstatt sie zu behalten, ohne zu liefern.
- Fernabsatzrechtliche Informationspflichten: Nicht zu vergessen ist, dass Entwickler im eigenen Online-Shop (für Preorders) auch gesetzliche Informationspflichten haben – etwa Impressumspflicht, klare Angaben zum Produkt, und eben die Belehrung über das Widerrufsrecht. Versäumnisse hier können Abmahnungen durch Verbraucherschutzverbände oder Mitbewerber nach sich ziehen. Die sogenannten „Button-Lösung“ (§ 312j BGB) verlangt z. B., dass der Bestell-Button gut sichtbar auf die Zahlungspflicht hinweist (beschriftet etwa mit „zahlungspflichtig bestellen“). Crowdfunding-Plattformen wie Kickstarter verwenden Buttons wie „Back this project“, was für deutsche Verhältnisse grenzwertig ist – allerdings agiert Kickstarter außerhalb des deutschen Rechtsraums direkt. Ein deutscher Entwickler mit eigenem Shop muss jedoch peinlich genau solche Formvorschriften einhalten, sonst drohen neben den inhaltlichen Problemen bei Nichterfüllung noch formale Rechtsnachteile.
Internationale Perspektiven: USA, UK, Australien
Die rechtliche Behandlung von Crowdfunding-Risiken variiert je nach Jurisdiktion. Einige Länder haben bereits Erfahrungen mit Streitfällen rund um verzögerte oder gescheiterte Spiele gesammelt:
USA
In den Vereinigten Staaten gibt es kein spezielles Crowdfunding-Gesetz für Reward-basiertes Crowdfunding; man wendet allgemeine Vertrags- und Betrugsgrundsätze an. Die meisten Plattformen (Kickstarter, Indiegogo) sind US-amerikanisch und legen in ihren Bedingungen US-Recht zugrunde. Wichtig für Entwickler:
- Vertragsrecht und Klagen: Backer in den USA können zivilrechtlich wegen Breach of Contract (Vertragsbruch) klagen, wenn ein versprochener Reward nicht geliefert wird. Allerdings ist der Aufwand einer individuellen Klage bei kleineren Beträgen oft ein Hindernis. In manchen Fällen haben sich jedoch Gruppen von Unterstützern zusammengetan oder Sammelklagen angestrengt, wenn ein Projekt besonders viele Geschädigte und hohe Summen betraf. US-Gerichte haben tendenziell bestätigt, dass ein verbindlicher Vertrag zustande kommt, sobald die Kampagne erfolgreich finanziert ist und der Unterstützer belastet wurde – mit entsprechend einklagbaren Pflichten.
- Behördliche Eingriffe: Wie bereits erwähnt, hat die FTC in mindestens einem prominenten Fall interveniert. Dies geschah im Fall eines Brettspiels, dessen Macher die Kickstarter-Gelder für private Zwecke ausgab. Die FTC erwirkte eine Unterlassungsverfügung und Rückzahlungen. Auch Staatsanwälte auf Bundesstaatsebene haben vereinzelt eingegriffen. Hier greift das allgemeine Verbraucherschutzrecht der USA, das vor „unfair or deceptive acts or practices“ schützt. Wenn ein Crowdfunding-Projekt als arglistige Täuschung erscheint, kann dies als unlautere Praxis verfolgt werden.
- Mail Order Rule: Interessant ist, dass es in den USA eine FTC-Vorschrift gibt, die sogenannte Mail Order Rule (bzw. „Mail, Internet, or Telephone Order Merchandise Rule“). Diese schreibt vor, dass bestellte Waren innerhalb der zugesagten Zeit oder – falls keine Zeit angegeben – innerhalb von 30 Tagen geliefert werden müssen, oder der Verkäufer muss den Kunden benachrichtigen und gegebenenfalls eine Erstattung anbieten. Diese Regel könnte theoretisch auch für Preorder-Crowdfunding gelten, wenn man es als Warenkauf betrachtet. Allerdings ist ihre Anwendung auf Crowdfunding unklar, da es sich um eine etwas spezielle Situation handelt (meist mit angekündigten langen Lieferfristen). Nichtsdestotrotz sollten Entwickler, insbesondere wenn sie selbst Vorbestellungen von US-Kunden annehmen, diese Vorschrift kennen. Bei großen Verzögerungen könnte ein Verbraucher argumentieren, der Entwickler habe gegen diese Regel verstoßen.
- Strafrecht (Fraud): Die Schwelle zur strafrechtlichen Verfolgung (z. B. wegen Wire Fraud auf Bundesebene) wird in den USA erreicht, wenn nachweisbar ist, dass der Projektinitiator mit betrügerischer Absicht agiert hat – also z. B. nie vorhatte zu liefern oder falsche Versprechungen gemacht hat, um Geld zu erlangen. Die US-Behörden sind hier selektiv aktiv geworden, etwa in Fällen, wo Millionenbeträge im Spiel waren oder offenkundige Dreistigkeit vorlag. Für einen Entwickler heißt das: Auch in den USA ist man nicht vor Strafverfolgung sicher, wenn man das Vertrauen der Backer missbraucht.
Vereinigtes Königreich (UK)
In Großbritannien galt bis Ende 2020 das EU-Recht, und viele dieser verbraucherschützenden Grundsätze sind weiterhin im nationalen Recht verankert (teilweise identisch fortgeführt). Crowdfunding im UK-Kontext weist folgende Aspekte auf:
- Vertrags- und Verbraucherrecht: Ähnlich wie in der EU ist ein Crowdfunding-Beitrag, der auf eine Reward gerichtet ist, vermutlich als Kaufvertrag oder Auftrag zu werten. Der Consumer Rights Act 2015 sowie die Consumer Contracts Regulations 2013 (Umsetzung der EU-Richtlinie) bieten Verbrauchern auch in UK Widerrufsrechte und Rechte bei Nicht-Lieferung. Ein Unterstützer im UK könnte also ebenfalls innerhalb von 14 Tagen stornieren oder bei starker Verspätung vom Vertrag zurücktreten. Allerdings ist auch in UK die praktische Durchsetzung in Crowdfunding-Fällen selten – oft aus Unkenntnis der Verbraucher oder weil viele Projekte internationale Konstellationen haben, wo unklar ist, welches Recht greift.
- Behördliche Sicht: Die britische Advertising Standards Authority (ASA) hat sich in der Vergangenheit mit Crowdfunding befasst, insbesondere was die Werbung für solche Kampagnen angeht. Anzeigen oder Projektbeschreibungen dürfen nicht irreführend sein. Wenn ein Entwickler über Risiken hinwegtäuscht oder unhaltbare Versprechen macht, könnte dies als Verstoß gegen die Werbestandards gelten. Zwar führt die ASA selbst keine Rückzahlungen herbei, aber ein negativer Befund schädigt den Ruf und kann behördlichen Druck erhöhen.
- Praxisfälle: Ein bekannter Crowdfunding-Flop in UK war das Drohnen-Projekt „Zano“, bei dem tausende Unterstützer Geld verloren. Obwohl damals (2015) kein kollektiver Rechtsweg beschritten wurde, hat der Vorfall zu Diskussionen geführt. Die britischen Behörden setzten eher auf Aufklärung: Kickstarter beauftragte einen Journalisten, den Fall aufzuarbeiten, anstatt dass Gerichte eingeschaltet wurden. Dies zeigt die noch bestehende Lücke zwischen Rechtslage und Realität: Prinzipiell hätten die Backer Zanos Erfinder wegen Nichterfüllung haftbar machen können – doch die Firma ging insolvent, und praktische Rechtsdurchsetzung war kaum möglich.
- Unfair Terms: UK-Gerichte würden ähnlich wie deutsche sehr weitgehende Haftungsausschlüsse in den AGB kritisch sehen (Unfair Contract Terms). Ein Entwickler, der UK-Kunden bedient, sollte also keine völlige Risikoverlagerung in seinen Bedingungen versuchen.
Australien
Australien hat sich in Sachen Crowdfunding ebenfalls bemerkbar gemacht, insbesondere durch eine aktive Verbraucherschutzbehörde (ACCC) und strenge Consumer Laws:
- Australian Consumer Law (ACL): Das ACL schützt Verbraucher vor irreführenden und täuschenden Geschäftspraktiken. Ein Entwickler, der in Australien Verbraucher anspricht (z. B. australische Backer in einer Kampagne), unterliegt diesen Regeln. Sollte das Projekt scheitern, prüft die ACCC ggf., ob falsche Versprechungen gemacht wurden. Es gab Fälle, in denen die ACCC Crowdfunding-Projekte untersuchte. So wurde ein Unternehmen, das ein Produkt über Crowdfunding finanziert, aber nie geliefert hatte, von der ACCC aufgefordert, die Beiträge zurückzuzahlen und keine irreführenden Aussagen über den Fortschritt zu machen.
- Durchsetzung: In Australien können Behörden sogenannte Enforceable Undertakings von Unternehmen einfordern – schriftliche Zusicherungen, bestimmte Maßnahmen zu ergreifen (etwa Rückzahlungen zu leisten), um Gesetzesverstöße wiedergutzumachen. Für Entwickler bedeutet das: Wenn sie Gelder australischer Konsumenten erhalten haben und diese sich beschweren, könnten sie behördlichen Auflagen ausgesetzt werden, die über das hinausgehen, was ein einzelner Backer erreichen könnte. Die australischen Gerichte würden zudem ähnlich wie in UK/EU die Verträge als Verbraucherverträge betrachten, mit entsprechenden Rechten bei Nichtlieferung.
- Strafverfolgung: Betrugsfälle könnten auch in Australien strafrechtlich verfolgt werden. Zwar sind uns keine weltweit bekannten Strafprozesse in Australien zu Crowdfunding-Spielen geläufig, doch die Gesetzeslage (Betrugstatbestände, ggf. rechtswidrige Beschaffung finanzieller Vorteile) würde es hergeben, besonders dreiste Fälle auch strafrechtlich anzugehen.
Fazit der internationalen Perspektiven
Weltweit lässt sich feststellen: Kein Rechtsraum lässt Crowdfunding völlig ungeregelt. Überall greifen entweder allgemeine Gesetze oder es gibt erste Präzedenzfälle, die deutlich machen, dass Entwickler sich nicht einfach auf „Pech gehabt, war ja Crowdfunding“ zurückziehen können. In einigen Ländern sind Verbraucherrechte besonders stark (EU, UK, Australien), in anderen liegt der Fokus eher auf nachträglicher Durchsetzung durch Behörden (USA). Entwickler, die international Gelder einsammeln, müssen daher den strengsten gemeinsamen Nenner beachten – im Zweifel also die Anforderungen des EU-Verbraucherschutzes und die Möglichkeit behördlicher Intervention wie in den USA.
Fazit: Professioneller Umgang mit Risiken erforderlich
Überlange Entwicklungszeiten oder das Scheitern eines crowdfinanzierten Spiels sind nicht nur eine geschäftliche Enttäuschung, sondern bergen erhebliche rechtliche Fallstricke. Entwickler stehen in der Pflicht, ihre Unterstützer nicht rechtlos zu stellen. Rückerstattungsansprüche, vertragliche Erfüllungspflichten und Verbraucherschutzrechte setzen klare Grenzen, wie viel Verzögerung und Risiko den Backern zugemutet werden darf. Gleichzeitig müssen Entwickler mit dem Risiko leben, bei Scheitern auch persönlich haftbar zu sein – im schlimmsten Fall bis hin zu Betrugsvorwürfen.
Um diese Risiken zu managen, sollten Entwickler bereits im Vorfeld juristische Vorkehrungen treffen: etwa realistische Zeitpläne kommunizieren, Risiken transparent machen, finanzielle Polster für eventuelle Rückzahlungen einplanen und ihre Vertragsdokumente rechtskonform gestalten. Während der Entwicklung ist eine offene Kommunikation und gegebenenfalls das Angebot freiwilliger Teilerstattungen oder Kompromisse sinnvoll, wenn absehbar ist, dass Ziele nicht gehalten werden können. Letztlich zeigt die juristische Betrachtung: Crowdfunding ist kein rechtsfreier Raum. Was vertraglich versprochen wurde, muss entweder geliefert oder erstattet werden. Entwicklern, Publishern und ihren juristischen Beratern ist daher zu raten, Crowdfunding-Projekte mit derselben Sorgfalt und Verantwortlichkeit anzugehen wie traditionelle Geschäftsmodelle – denn die Unterstützung der „Crowd“ begründet rechtlich verbindliche Erwartungen, denen man professionell gerecht werden muss.