Warum sind Verträge wichtig?
Oft schreibe ich hier im Blog dazu, für wie wichtig ich es halte, dass bestimmte Branche an ihrer Professionalisierung arbeiten...
Mehr lesenDetailsKurzüberblick: Das Abrufübertragungsrecht wird seit Jahren als Begriff verwendet, um die On-Demand-Übertragung von Werken im Internet zu beschreiben. Dogmatisch ist es im deutschen Recht nicht als eigenes Verwertungsrecht kodifiziert. Die Praxis ordnet On-Demand-Streaming überwiegend dem Recht der öffentlichen Zugänglichmachung zu (§ 19a UrhG, Umsetzung von Art. 3 Abs. 1 InfoSoc-RL). Daneben greifen Vervielfältigungsrechte (Buffering, Caching) sowie Leistungsschutzrechte. Für Anbieter heißt das: Lizenzpakete für Streaming müssen mehrschichtig gedacht werden – je nach Werkart, Rechtekette, Live- oder On-Demand-Modell, Territorien und technischen Modalitäten.
Begriffsbild. „Abrufübertragung“ meint die nutzerindividuelle Übermittlung eines Werkes auf Anforderung („on demand“) vom Server zum Endgerät. Der Terminus stammt aus der Literatur zur Konvergenz von Senden (§ 20 UrhG) und öffentlicher Zugänglichmachung (§ 19a UrhG). Gemeint ist die Übertragung jenseits der bloßen Bereitstellung auf einem Server.
Kodifikation und herrschende Sicht. Das Urheberrechtsgesetz kennt kein eigenständiges „Abrufübertragungsrecht“. Der Regelungsanker für Streaming-On-Demand ist § 19a UrhG: öffentliche Zugänglichmachung liegt vor, wenn das Werk Mitgliedern der Öffentlichkeit von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl zugänglich gemacht wird. Die EuGH-Rechtsprechung zu Art. 3 Abs. 1 InfoSoc-RL abstrahiert dabei den Vorgang der „öffentlichen Wiedergabe“ in einem technologieneutralen Sinn. Aus praktischer Sicht zählt daher nicht nur das „Auf den Server stellen“, sondern die damit eröffnete Möglichkeit individuellen Abrufs.
Gegenauffassung in der Literatur. Diskutiert wird, ob die Datenübertragung selbst (der „letzte Schritt“ vom Server zum Nutzer) ein eigenständiges Verwertungsrecht darstellt – mit Argumenten zur Lizenzdurchsetzung (Kontrolle der Auslieferung, Territorialfragen, Sanktionslogik). Die überwiegende Meinung ordnet Bereitstellen und Abruf jedoch einheitlich § 19a UrhG zu; ein gesondertes „Abrufübertragungsrecht“ wird nicht benötigt. Entscheidend bleibt: On-Demand-Bereitstellung löst § 19a aus; Live-Übertragung ordnet sich regelmäßig § 20 UrhG (Senderecht) zu.
Abgrenzung zu § 20 UrhG (Senden).
Urheberrechtliche Ebene.
Leistungsschutzrechte (Auswahl).
Collecting-Societies-Praxis.
Temporäre Kopien (§ 44a UrhG). Streaming erzeugt flüchtige Kopien auf Servern, in Transcoding-Pipelines, CDNs und auf Endgeräten (RAM, Puffer). § 44a privilegiert diese nur, wenn die Kopien vorübergehend, flüchtig oder begleitend, integraler Bestandteil eines technischen Verfahrens sind und keine eigenständige wirtschaftliche Bedeutung haben und der Nutzungsvorgang rechtmäßig ist.
Private Kopie (§ 53 UrhG). Für Endnutzer ist die Privatkopie aus einer offensichtlich rechtswidrigen Vorlage nicht zulässig. Auf EU-Ebene hat die Rechtsprechung klargestellt, dass Streaming aus offensichtlich rechtswidrigen Quellen weder von Art. 5 Abs. 1 InfoSoc (vorübergehende technische Kopien) noch von nationalen Privatkopie-Regeln gedeckt ist. Für Plattformen folgt daraus: Sorgfaltspflichten zur Unterbindung rechtswidriger Quellenzugriffe (DSA-Prozesse, Hash-/URL-Blacklists, „trusted notifier“-Mechanismen).
Praxisfolgen. Anbieter rechtmäßiger Streamingdienste dürfen § 44a einpreisen und müssen nicht jede technische Kopie lizenzieren. Wer dagegen auf rechtswidrige Quellen setzt, kann sich auf § 44a nicht berufen; Endnutzer riskieren Rechtsverletzungen und Abmahnungen. Rechteinhaber können gegen Vermittler (Hardware-/Software-Seller, Add-on-Plattformen) vorgehen, wenn diese gezielt den Zugang zu illegalen Streams fördern.
Live-Übertragungen. Klassisches Livestreaming ohne nachträgliche Abruffunktion ist Senderecht (§ 20 UrhG). Sobald ein Livestream zeitgleich online geht und parallel in einer Mediathek abrufbar bleibt, werden beide Rechte genutzt: Senden für die Live-Phase, § 19a für die On-Demand-Phase.
Webradio/Internetradio. Linearer Stream = § 20; Sendearchitektur und Einbindung von Werken (Musik) erfordern Sende- und Leistungsschutzrechte; Playlist-Archiv oder „Track-Replay“ tritt in den Bereich § 19a.
Simulcast/Gap-Fill. TV-Signal oder Event-Stream wird zeitgleich via Internet verbreitet (Simulcast) und anschließend als Catch-Up bereitgestellt. Verträge: Dual-Lizenzierung (Senderecht + öffentliche Zugänglichmachung), klare Zeitfenster, Geo-Blocking, DRM.
Kurzfazit: Live- und On-Demand-Modelle sind lizenzrechtlich getrennt zu strukturieren, selbst wenn sie technisch in einer Plattform verschmelzen.
Territorialprinzip online. Für reine On-Demand-Dienste gilt kein generelles Herkunftslandprinzip; Lizenzierung erfolgt territorial. Abweichungen gibt es nur in Sonderregimen (z. B. Richtlinie (EU) 2019/789 für Online-Dienste von Sendeunternehmen, „ancillary online services“). Internationale Streaming-Projekte müssen früh Rechteportfolios (Werke, Leistungen) und Gebietsrechte abgleichen; Geo-Blocking und Rights-Enforcement (IP-Range-Steuerung, Payment-Gateways, App-Store-Gebiete) technisch enforcebar ausgestalten.
Rechteketten. Verträge mit Urhebern, ausübenden Künstlern, Produzenten und Labels müssen eindeutig definieren: Nutzungsart (On-Demand-Streaming, Download, Clipnutzung, Trailer), Endgeräte, Interaktivität, Territorien, Laufzeit, Zeitfenster, Exklusivität, Rev-Share. Wichtig: Zweckübertragungslehre (§ 31 Abs. 5 UrhG) – unklare Klauseln werden eng ausgelegt. Bei KI-gestützten Bearbeitungen Remix-/Edit-Klauseln und Moral Rights beachten.
Plattformverträge (UGC & Pro-Publisher).
Technische Durchsetzung. DRM, Token-Gates, Forensic Watermarking und Fingerprinting sind kein Ersatz für Rechte, aber Compliance-Werkzeuge (Beweis, Abuse-Mitigation). Logs und Provenance-Daten sichern die Beweisführung.
Content-Pipeline. Schon in der MVP-Phase sind Nutzungsarten („nur Live“, „Live + Catch-Up“, „reiner VoD-Katalog“), Territorien, Verfügbarkeitsfenster und In-App-Features (Clipping, Download-to-Go, Offline-Cache) festzulegen – mit direktem Einfluss auf Lizenzbedarf. Download-to-Go verlässt regelmäßig § 44a und benötigt Vervielfältigungsrechte für dauerhafte Kopien.
User-Funktionen. Clips, GIF-Export, Audiogramme, Snippets oder Screen-Record sprengen schnell die vertraglich erlaubte Nutzung. Default sollte „Narrow Rights“ sein: Clip-Funktionen nur für eigene Inhalte, Re-Uploads mit automatischer Rechteprüfung, Opt-Ins für Rechteinhaber.
KI-Features. Automatische Transkription, Kapitelung, Übersetzung oder Dub erzeugen Bearbeitungen (§ 23 UrhG) und nutzen Leistungsschutzrechte. Training/Finetuning auf Nutzermaterial erfordert separate Erlaubnisse (keine stillschweigende Train-Erlaubnis). Ausschlüsse (No-Training-Flags) und Zweckbindungen vertraglich festhalten.
Hyperlinks/Embeds. Die Linie der Unionsrechtsprechung zur „öffentlichen Wiedergabe“ unterscheidet neues Publikum/ technische Modalität:
Plattformhaftung. Für reine Hosting-/Sharing-Plattformen gelten in Deutschland UrhDaG-Spezialregeln (Filtern, mutmaßlich erlaubt, Beschwerde). Online-Marktplätze ohne Content-Sharing-Schwerpunkt sind urheberrechtlich anders zu prüfen; Haftung hängt von Zurechnung und Sorgfalt ab. DSA ergänzt das Haftungsbild prozedural (Meldewege, Transparenz, Audits).
Praxis-Konflikte.
Für die juristische Beratung ist der Begriff „Abrufübertragungsrecht“ hilfreich, um On-Demand-Übertragungen präzise zu adressieren. Rechtlich trägt den Use-Case aber § 19a UrhG in Verbindung mit § 16, § 44a und den Leistungsschutzrechten. Die wesentlichen Beratungshebel liegen in (1) klarer Lizenzarchitektur, (2) technischer Durchsetzung (DRM, Fingerprinting, Geo-Blocking), (3) DSA/UrhDaG-Prozessen gegen Over- und Underblocking sowie (4) sauberer Vertragsgestaltung für KI-Funktionen, Clips und internationale Gebietsportfolios.
Marian Härtel ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für IT-Recht mit einer über 25-jährigen Erfahrung als Unternehmer und Berater in den Bereichen Games, E-Sport, Blockchain, SaaS und Künstliche Intelligenz. Seine Beratungsschwerpunkte umfassen neben dem IT-Recht insbesondere das Urheberrecht, Medienrecht sowie Wettbewerbsrecht. Er betreut schwerpunktmäßig Start-ups, Agenturen und Influencer, die er in strategischen Fragen, komplexen Vertragsangelegenheiten sowie bei Investitionsprojekten begleitet. Dabei zeichnet sich seine Beratung durch einen interdisziplinären Ansatz aus, der juristische Expertise und langjährige unternehmerische Erfahrung miteinander verbindet. Ziel seiner Tätigkeit ist stets, Mandanten praxisorientierte Lösungen anzubieten und rechtlich fundierte Unterstützung bei der Umsetzung innovativer Geschäftsmodelle zu gewährleisten.
Oft schreibe ich hier im Blog dazu, für wie wichtig ich es halte, dass bestimmte Branche an ihrer Professionalisierung arbeiten...
Mehr lesenDetailsDas Saarländische Oberlandesgericht hat im Rahmen einer Kostenentscheidung entschieden, dass Meta für die Prüfung der Rechtmäßígkeit einer Sperrung eine angemessene Zeit...
Mehr lesenDetailsDer Zeitpunkt des Vertragsschlusses in Onlineshops und bei SaaS-Diensten ist für Anbieter von großer Bedeutung. Denn davon hängt ab, ab wann die AGB wirksam einbezogen...
Mehr lesenDetailsDie Telekom Deutschland GmbH darf das von ihr angebotene Produkt "StreamOn" in der bisherigen Form vorläufig nicht weiterbetreiben. Dies hat das Oberverwaltungsgericht...
Mehr lesenDetails„Fail fast, fail often“ – kaum ein Motto prägt die Startup-Kultur so sehr wie die Idee, schnell auszuprobieren und notfalls...
Mehr lesenDetailsIn meiner anwaltlichen Praxis im Bereich Urheberrecht, Wettbewerbsrecht und IT-Recht berate ich regelmäßig Managements von Influencern und Vermittler in komplexen...
Mehr lesenDetailsDie Entwicklung und Vermarktung moderner Videospiele ist ohne Zusammenarbeit mit externen Partnern kaum denkbar. Ob Voice Actor (Synchronsprecher), Streamer oder...
Mehr lesenDetailsEinleitung: Die Bedeutung von Commercial Courts für internationale Mandanten Als Anwalt, der eine Vielzahl von Mandanten vertritt, die international tätig...
Mehr lesenDetailsDiesen Artikel aus der BZ (Boulevardzeitung aus Berlin) von gestern sollte ich vielleicht archivieren, wenn mich wieder einmal ein Sponsor,...
Mehr lesenDetailsSoftwareentwicklung verändert sich radikal. Was über Jahrzehnte das präzise Schreiben von Code war, wird zunehmend durch Kommunikation ersetzt. „Vibecoding“ beschreibt...
Mehr lesenDetails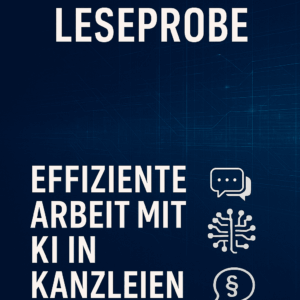 Leseprobe: KI effizient in der Kanzlei nutzen
0,00 €
Leseprobe: KI effizient in der Kanzlei nutzen
0,00 €
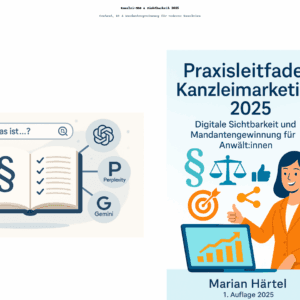 Kanzlei-SEO & Sichtbarkeit 2025: Das Content- und KI-Bundle für moderne Rechtsanwält:innen
54,99 €
Kanzlei-SEO & Sichtbarkeit 2025: Das Content- und KI-Bundle für moderne Rechtsanwält:innen
54,99 €
inkl. MwSt.
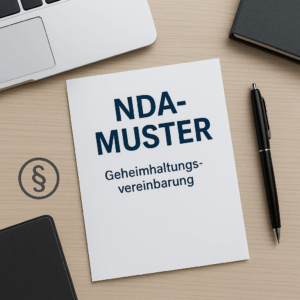 Verschwiegenheitserklärung / NDA – Muster mit Alternativen
0,00 €
Verschwiegenheitserklärung / NDA – Muster mit Alternativen
0,00 €
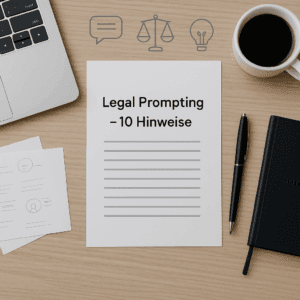 1 Pager „10 wichtigste Hinweise zum Legal Prompting
0,00 €
1 Pager „10 wichtigste Hinweise zum Legal Prompting
0,00 €
 Videoberatung via Microsoft Teams 30 Minuten – Schnell, unkompliziert und fokussiert
163,63 €
Videoberatung via Microsoft Teams 30 Minuten – Schnell, unkompliziert und fokussiert
163,63 €
In dieser fesselnden Episode des Podcasts "Der Unkonventionelle Anwalt" tauchen wir ein in die Welt eines Juristen, der die traditionellen...
Mehr lesenDetailsIn diesem Video rede ich ein wenig über transparente Abrechnung und wie ich kommuniziere, was es kostet, wenn man mit...
Mehr lesenDetails