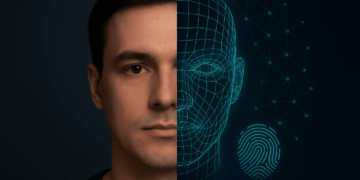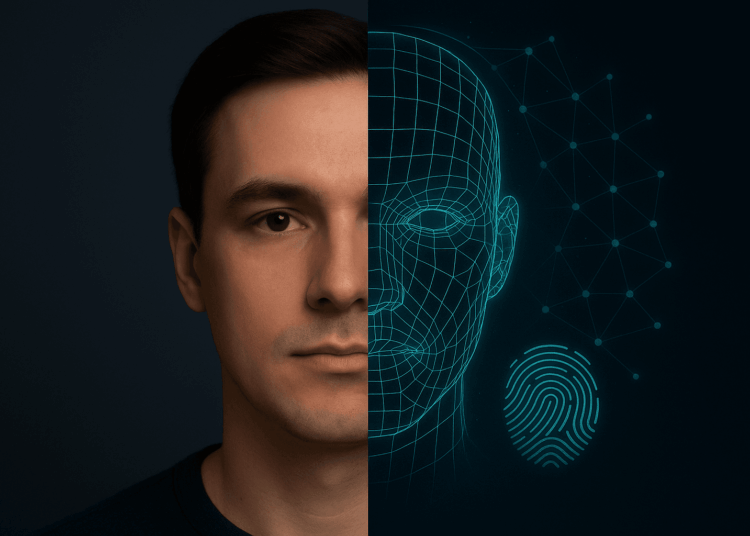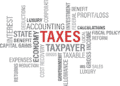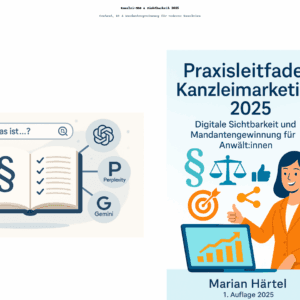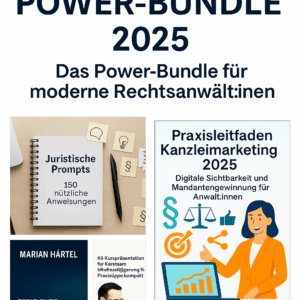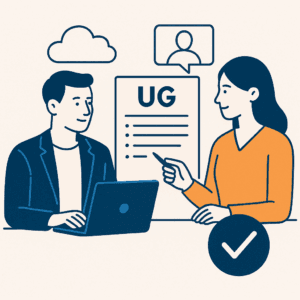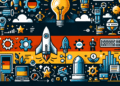Deepfakes sind längst kein theoretisches Phänomen mehr, sondern fester Bestandteil eines globalen Marktes für digitale Identität und monetarisierbaren Content. Die technische Entwicklung der vergangenen zwei Jahre hat nicht nur dazu geführt, dass Gesichter, Stimmen und Körper täuschend echt rekonstruiert werden können, sondern auch dazu, dass Influencer, OnlyFans-Creator, Agenturen und Marken mit diesen virtuellen Abbildern arbeiten, als seien sie physisch produzierter Content. Gleichzeitig hat kein anderes Instrument der digitalen Contentproduktion so weitreichende rechtliche Implikationen wie KI-generierte oder KI-manipulierte Darstellungen realer Personen. Jede Nutzung berührt unmittelbar das allgemeine Persönlichkeitsrecht, das Recht am eigenen Bild, das Recht an der eigenen Stimme, das Urheberrecht, datenschutzrechtliche Vorgaben und zunehmend auch regulatorische Vorgaben aus dem AI Act.
Der Einsatz von Deepfakes bewegt sich damit in einem Spannungsfeld aus wirtschaftlicher Effizienz, kreativen Chancen und erheblichen juristischen Risiken. Gerade Agenturen und Creator, die im kommerziellen Bereich tätig sind, stehen vor der Aufgabe, die technischen Möglichkeiten mit klaren vertraglichen Strukturen zu verbinden. Während der Markt im Influencer-Marketing, im Erotikbereich, in der Werbung und in der digitalen Produktion längst boomt, bleibt die Rechtslage komplex und in Teilen dynamisch. Im Folgenden werden die wesentlichen rechtlichen Grundlagen, die praktische Relevanz für Creator und Agenturen sowie die notwendige Vertragsarchitektur aufgearbeitet, die den Einsatz von Deepfakes rechtssicher gestaltet.
Rechtliche Zulässigkeit von Deepfakes: Persönlichkeitsrecht, Bildnisschutz und die ökonomische Dimension digitaler Identität
Der Einsatz von Deepfakes berührt in nahezu jedem Fall das Persönlichkeitsrecht der dargestellten Person. Dieses umfasst sowohl das allgemeine Persönlichkeitsrecht als auch das Recht am eigenen Bild und das Recht an der eigenen Stimme. Durch die Generierung oder Manipulation von Inhalten mittels KI entsteht ein Abbild oder Eindruck einer Person, das deren Identität nutzt, modifiziert oder in einen Kontext setzt, der ohne diese technische Manipulation nicht entstanden wäre. Dies gilt selbst dann, wenn der Deepfake auf synthetischen Daten basiert oder wenn kein einzelnes Foto konkret kopiert wird. Entscheidend ist die Erkennbarkeit der Person. Die Rechtsprechung knüpft diese Erkennbarkeit nicht an absolute Identität, sondern an eine ausreichende Ähnlichkeit der Darstellung, die dazu führt, dass ein durchschnittlicher Betrachter die Person wiedererkennt.
Damit ist in nahezu allen kommerziellen Deepfake-Konstellationen eine Einwilligung erforderlich. Diese Einwilligung muss freiwillig, informiert und ausdrücklich erfolgen. Sie muss den Zweck, den Umfang und vor allem den Einsatz künstlicher Manipulation oder Generierung umfassen, da klassische Foto-/Videorechte eine KI-Nutzung nicht automatisch einschließen. Besonders im Influencer-Business, in dem Identität selbst ein wirtschaftliches Gut darstellt, gewinnt die Vermögenskomponente des Persönlichkeitsrechts an Bedeutung. Creator monetarisieren Wiedererkennbarkeit, Stimme, Körpersprache, visuelle Merkmale und typische Ausdrucksweisen. Wenn diese Merkmale in Deepfakes reproduziert werden, wird nicht nur das Persönlichkeitsrecht tangiert, sondern auch ein erheblicher wirtschaftlicher Wert genutzt.
Hinzu kommt, dass die Verletzung des Persönlichkeitsrechts durch Deepfakes zu weitreichenden Ansprüchen führen kann. Neben Unterlassung und Beseitigung können Schadensersatzansprüche geltend gemacht werden. Bei schwerwiegenden Eingriffen in die Intim- oder Privatsphäre, etwa bei erotischen oder sexualisierten Deepfakes, kommen Geldentschädigungen („Schmerzensgeld“) in Betracht. Gerade im OnlyFans- und Erotikbereich ist der Einsatz von Deepfakes ohne vertraglich gesicherte Einwilligungen hochriskant. Nicht der technische Ursprung ist rechtlich entscheidend, sondern der Eindruck, dass die dargestellte Person an einer bestimmten Handlung beteiligt gewesen sei.
Der Einsatz unautorisierter Deepfakes kann darüber hinaus in strafrechtliche Bereiche hineinreichen. § 201a StGB schützt die Intimsphäre und verbietet die Herstellung und Verbreitung bestimmter Darstellungen. Der geplante neue § 201b StGB soll den unbefugten Einsatz realistisch wirkender Deepfakes unter Strafe stellen. Im Bereich politischer oder reputationsschädigender Deepfakes können zudem Tatbestände wie üble Nachrede oder Verleumdung erfüllt sein. Die rechtlichen Konsequenzen sind damit nicht nur zivilrechtlicher Natur; die Grenze zum Strafrecht ist schnell überschritten.
Urheberrechtliche Fragen bei KI-generierten Medien: Nutzungsrechte, Vorlagen, Trainingsdaten und die Frage, wem der Output gehört
Abseits der Persönlichkeitsrechte ist das Urheberrecht ein zentrales Regelungsfeld beim Einsatz von Deepfakes. KI-Modelle basieren häufig auf existierendem Material. Fotoshoots, Videoaufnahmen, Archivmaterial oder Content aus Social-Media-Profilen dienen als Grundlage für das Training oder die Manipulation. Die Nutzung solcher Vorlagen setzt Nutzungsrechte voraus. Wer nur ein einfaches Nutzungsrecht an einem Bild besitzt, darf dieses in der Regel nicht verändern oder für KI-Modelle verwenden. Eine Bearbeitungsbefugnis nach § 23 UrhG ist zwingend erforderlich. Diese wird in der Praxis jedoch selten vertraglich adressiert.
Viele Creator und Agenturen gehen davon aus, dass die Rechte aus einem klassischen Fotoshooting ausreichen, um daraus Deepfakes zu erstellen. Diese Annahme ist oftmals falsch. Fotografen, Videografen oder Marken besitzen häufig Rechte an den Aufnahmen, die eine Weiterverwendung einschränken. Wenn Teile des Materials an Drittagenturen weitergegeben oder als Trainingsdaten für KI-Systeme genutzt werden, ohne dass die entsprechenden Rechte existieren, liegt regelmäßig eine Urheberrechtsverletzung vor. Auch die Verwendung fremder Social-Media-Posts oder Stockmaterial für Trainingszwecke kann problematisch sein.
Zudem stellt sich die Frage, wem der Output gehört. Der KI-Output kann urheberrechtlich geschützt sein, wenn menschliche Gestaltungshöhe vorliegt. Diese kann durch Regieanweisungen, kreative Szenenarchitektur oder eine konzeptionelle Steuerung des KI-Tools entstehen. Wenn Agenturen Deepfakes produzieren, sollte daher ausdrücklich geregelt werden, wem die Nutzungsrechte an dem Output zustehen. Ohne klare Regelung besteht das Risiko, dass Influencer den Content nicht frei verwenden dürfen oder dass Agenturen ihn auch nach Vertragsende verwerten könnten.
Besonders komplex ist der Umgang mit Trainingsdaten. Wenn das Gesicht, die Stimme oder der Körper einer Person als Datensatz in ein KI-Modell einfließt, entstehen langfristige Verwertungsmöglichkeiten, die ohne präzise vertragliche Begrenzung kaum kontrollierbar sind. Es muss klar festgelegt werden, ob das KI-Modell ausschließlich für ein spezifisches Projekt genutzt werden darf oder ob das virtuelle Double später auch für andere Kampagnen eingesetzt werden kann. Die wirtschaftlichen Folgen sind erheblich: Ein nicht eingeschränktes Trainingsdatensatzrecht könnte es Agenturen ermöglichen, ein digitales Abbild einer Person unabhängig vom realen Creator weiterzuvermarkten – ein Szenario, das schon mehrfach zu juristischen Auseinandersetzungen geführt hat.
Regulatorische Vorgaben und Transparenzpflichten: Der kommende AI Act, Plattformregeln und die Frage der Kennzeichnung von KI-Inhalten
Der regulatorische Rahmen verschärft sich erheblich. Mit dem AI Act entstehen ab 2026 weitreichende Transparenzpflichten für KI-generierte oder KI-manipulierte Inhalte. Realistische Deepfakes müssen klar als solche kenntlich gemacht werden. Für Influencer bedeutet dies, dass ein KI-Video, ein KI-Foto oder ein synthetisches Voice-Over künftig nicht mehr ohne Kennzeichnung veröffentlicht werden darf. In der Werbung kann eine fehlende Kennzeichnung zudem eine Irreführung im Sinne des UWG darstellen.
Plattformregeln entwickeln sich parallel. Instagram, TikTok, Meta und X haben Pläne oder bereits implementierte Systeme, die KI-Content automatisch labeln. Verstöße gegen diese Regulierungen können zu Sichtbarkeitsverlust, Content-Deletion oder Account-Sperrungen führen. Dies betrifft insbesondere Accounts, die ein wirtschaftliches Modell auf der Plattform aufgebaut haben.
Auch in rechtlicher Hinsicht ist die Kennzeichnungspflicht nicht lediglich eine formale Anforderung. Sie dient dem Schutz der Rezipienten, die ohne Kennzeichnung getäuscht werden könnten. Fehlende Transparenz kann – insbesondere im Bereich Meinungsäußerungen, politischer Statements oder Health Claims – eine unzulässige Irreführung darstellen. Für Agenturen bedeutet dies, dass jeder Workflow, der KI-Inhalte produziert, dokumentiert und nachweisbar gekennzeichnet werden muss.
Die regulatorischen Vorgaben sind damit nicht nur eine juristische Pflicht, sondern ein Compliance-Thema, das unmittelbar über die wirtschaftliche Tragfähigkeit von Kampagnen entscheidet. Marken werden künftig verlangen, dass Content-Produzenten sowohl die Herkunft des Materials als auch den Grad der KI-Manipulation nachweisen können. Ohne diese Nachweise wird die Zusammenarbeit insbesondere mit größeren Unternehmen und internationalen Marken zunehmend schwierig.
Vertragsmodelle für Influencer, Agenturen und Creator: Einwilligung, IP-Zuordnung, Haftung, Trainingsdaten und Rechteketten
Die vertragliche Gestaltung ist der zentrale Baustein, um Deepfakes rechtssicher im Influencer-Marketing einzusetzen. Klassische Model-Release-Formulare oder Influencer-Agenturverträge reichen hierfür nicht aus. Erforderlich ist eine eigenständige Vertragsarchitektur, die alle Bereiche abdeckt, in denen Deepfakes rechtliche Auswirkungen haben.
Eine wirksame Einwilligung muss ausdrücklich auf KI-Nutzung erweitert werden. Dies umfasst sowohl die Generierung als auch die Modifikation von Bildern, Stimmen und Körperdarstellungen. Der Zweck muss konkret definiert werden. Eine Einwilligung für „Social-Media-Nutzung“ allein ist nicht ausreichend, wenn Deepfakes in Werbung, internationale Lokalisierungen, Paywall-Systeme wie OnlyFans oder synthetischen Kampagnen genutzt werden sollen. Die Einwilligung muss zudem die Dauer und die geografische Ausdehnung der Nutzung abdecken.
Die Rechtezuweisung ist ebenfalls ein kritischer Faktor. Der Vertrag sollte eindeutig festlegen, wem die Rechte am Output gehören und wie diese genutzt werden dürfen. Dies umfasst Veröffentlichungsrechte, Archivnutzung, Unterlizenzierungen, Adaptationen und Bearbeitungen. Ebenso muss geregelt werden, was nach Vertragsende geschieht. Deepfakes haben ein anderes Persistenzrisiko als traditionelle Medien, da das KI-Modell selbst eine Reproduktion ermöglicht. Ohne Löschungs- und Deaktivierungsregelungen verbleibt das digitale Double dauerhaft verfügbar.
Die Haftungsregelung ist unabdingbar. Agenturen müssen garantieren, dass sie alle erforderlichen Rechte eingeholt haben. Creator müssen abgesichert werden, falls Dritte Ansprüche erheben. Die Freistellungsklausel muss weit formuliert sein und Urheberrechte, Persönlichkeitsrechte, Datenschutz und regulatorische Verstöße abdecken.
Schließlich sind Trainingsdaten ein besonders sensibler Bereich. Der Vertrag muss definieren, ob das KI-Modell ausschließlich projektbezogen genutzt werden darf oder ob eine spätere Nutzung zulässig ist. Unklarheiten führen zu erheblichen Risiken, da Creator keine Kontrolle über spätere Verwertungen ihres digitalen Abbilds haben.
Agenturen, die ohne klare Verträge Deepfakes einsetzen, riskieren enorme wirtschaftliche Schäden, insbesondere wenn das digitale Abbild einer Person in nicht genehmigten Kontexten auftaucht oder wenn Marken Verstöße gegen Persönlichkeitsrecht oder Urheberrecht geltend machen.
Wirtschaftliche Chancen und klare rote Linien: Effizienzgewinne, virtuelle Creator, skalierbare Contentproduktion und die Grenzen rechtlicher Belastbarkeit
Trotz der erheblichen Risiken bieten Deepfakes wirtschaftliche Chancen, die traditionelle Produktion nicht abbilden kann. Influencer können Content skalieren, ohne physisch anwesend zu sein. OnlyFans-Creator können parallele Personas entwickeln, ohne persönlichen Aufwand. Marken können Kampagnen in mehreren Sprachen veröffentlichen, ohne dass mehrere Drehs notwendig werden. Agenturen können synthetische Testimonials erstellen, die hohe Wiedererkennbarkeit besitzen.
Deepfakes sind damit ein Werkzeug, das Produktionskosten reduziert und Reichweite erhöht. Gleichzeitig existieren klare rechtliche Grenzen. Deepfakes ohne Einwilligung sind unzulässig. Deepfakes im intimen Kontext ohne dokumentierte Zustimmung sind besonders riskant. Deepfakes, die politische Meinungen simulieren oder Gesundheitsversprechen darstellen, können irreführend und rechtswidrig sein. Deepfakes, die fremde Markenrechte tangieren oder suggestiv Aussagen einer Person simulieren, überschreiten schnell die Grenze zu unzulässiger Werbung oder Persönlichkeitsrechtsverletzung.
Der professionelle Einsatz von Deepfakes ist daher keine rein technische, sondern primär eine rechtliche Aufgabe. Wer Deepfakes einsetzen möchte, benötigt nicht nur kreative Konzepte, sondern eine rechtsbeständige Grundlage, die wirtschaftliche Flexibilität ermöglicht, ohne die Rechte Dritter zu verletzen.
Die Praxis zeigt, dass die erfolgreichsten und risikofreiesten Deepfake-Projekte diejenigen sind, die frühzeitig juristisch strukturiert wurden. Eine klare Rechtekette, geprüfte Einwilligungen, sauber formulierte Lizenzbedingungen, dokumentierte Trainingsdaten und ein transparenter Umgang mit KI-Inhalten bilden die Grundlage für nachhaltige Nutzung.
Je stärker Deepfakes in Zukunft in die Produktion von Influencer-, Werbe- und Erotikcontent integriert werden, desto wichtiger wird ein professioneller Rahmen. Wer rechtzeitig investiert, sichert nicht nur rechtliche Compliance, sondern schafft einen Wettbewerbsvorteil gegenüber Akteuren, die improvisieren und dadurch erhebliche Risiken eingehen.