Private AI use in the company
Private accounts on ChatGPT & Co. for corporate purposes are a gateway to data protection breaches, leaks of secrets and...
Mehr lesenDetailsBitte, jederzeit gern! Wenn bei der Umsetzung noch Detailfragen auftauchen, stehe ich natürlich weiter zur Verfügung. Mit einem klaren Scope, eindeutigen Verträgen und sorgfältigem Datenschutzmanagement lässt sich das Risiko bei Penetration Tests gut beherrschen.
Absolut, das Haftungsrisiko bei einem versehentlichen Überschreiten des festgelegten Testumfangs ist nicht zu unterschätzen. Empfehlenswert ist daher eine vertraglich klar definierte „Scope of Work“ mit eindeutigen Ausschlüssen. Sollten bestimmte Bereiche oder Systeme tabu sein, muss das Sicherheitsteam dies genau wissen und nachweislich bestätigen. Sie können zudem in den Verträgen festhalten, dass bei einem Verstoß gegen diese Regeln etwaige Schadenersatzpflichten oder Vertragsstrafen greifen. So schützen Sie sich vor ungewollter Ausweitung des Tests und wahren die Vertraulichkeit Ihrer sensiblen Daten.
Gern geschehen. Achten Sie auf einen sauberen Scope, eindeutige schriftliche Vereinbarungen und einen transparenten Umgang mit möglichen Datenschutzvorfällen. Dann lassen sich die meisten Rechtsrisiken beim Penetration Testing gut eindämmen. Wenn noch Fragen offenbleiben, melden Sie sich einfach wieder – ich helfe Ihnen gerne weiter.
Sobald personenbezogene Daten tatsächlich kompromittiert werden, kann das ein meldepflichtiger Datenschutzvorfall nach der DSGVO sein – konkret Art. 33 DSGVO. Ob eine Meldung nötig ist, hängt unter anderem von der konkreten Gefährdungslage ab: Wer hatte Zugriff, wurden die Daten weitergegeben, besteht ein Risiko für Betroffene? In vielen Fällen sollten Sie aber zumindest eine interne Dokumentation erstellen. Eine unmittelbare Meldung an die Aufsichtsbehörde kann entfallen, wenn sichergestellt ist, dass kein erhebliches Risiko für Betroffene besteht. Das ist jedoch eine Einzelfallabwägung und sollte juristisch geprüft werden.
Das „Black-Box“-Verfahren ist zwar üblich, aber rechtlich besonders heikel. Einerseits sollen Sie realitätsnahe Bedingungen schaffen, andererseits müssen Sie sicherstellen, dass Sie nicht versehentlich Daten Dritter kopieren oder Rechte unbeteiligter Personen verletzen. Um strafrechtliche Risiken zu vermeiden, sollten Sie klar abstecken, welche Systeme getestet werden dürfen und welche nicht. Es braucht vorab ein schriftliches Mandat für den Test, in dem der Umfang (Scope) exakt definiert ist. Auch Ihre IT-Abteilung sollte zumindest einige Verantwortliche ins Bild setzen, damit sie nicht versehentlich eine Strafanzeige stellen.
Guten Tag, danke für die Frage. Grundsätzlich muss für Penetration Testing immer eine klare Rechtsgrundlage oder Einwilligung des Betreibers vorliegen. Ein formloses „Ja, testet mal“ kann zu Missverständnissen führen, besonders wenn bei der Durchführung Grenzen überschritten werden. Empfehlenswert ist daher ein detaillierter Vertrag, in dem sowohl Art und Umfang des Tests als auch Haftungsfragen geregelt werden. Dadurch wird klargestellt, dass das Test-Team im Rahmen eines autorisierten Sicherheitstests handelt und nicht gegen § 202a StGB (unerlaubtes Verschaffen von Daten) oder ähnliche Vorschriften verstößt.
Genau, letztlich geht es darum, verantwortungsvoll mit KI-Generierungen umzugehen – sowohl inhaltlich als auch rechtlich. Ob diese Unterhaltung zu 100 Prozent authentisch oder teils KI-generiert ist, ändert nichts an den Prinzipien: Wir müssen mögliche Urheberrechtsverletzungen, Haftungsfragen und Datenschutzaspekte im Blick behalten. Vielen Dank für den interessanten Schlagabtausch, Herr Fischer. Falls weitere Fragen auftauchen – menschlich, KI-basiert oder beides – stehe ich gern für eine Beratung zur Verfügung.
Na gut, ich gebe zu, die Grenzen verschwimmen manchmal. Tatsächlich sind viele dieser Threads in letzter Zeit entstanden, und es könnte durchaus sein, dass sie – zumindest in Teilen – mit Unterstützung einer KI erstellt wurden. Zu meiner Verteidigung: So wie KI generierte Bilder meist nur Teilwerke sind, können auch textbasierte Diskussionen eine Mischung aus menschlichen und KI-generierten Passagen sein. Entscheidend ist, wie wir sie nutzen und kontrollieren. Also ja, Herr Fischer, ich fürchte, Sie haben den Verdacht leider bestätigt bekommen.
Ähm, das ist eine interessante Frage, Herr Fischer. Ich kann Ihnen versichern, dass ich als Rechtsanwalt tatsächlich real und kein Roboter bin. Oder zumindest war ich das, bevor ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe. Sollten unsere bisherigen Diskussionen tatsächlich Ergebnisse einer KI sein, wäre das schon ziemlich ironisch – „Ach ne, oder?“ Aber gut, das KI-Zeitalter überrascht uns immer wieder.
Hallo Herr Fischer, beim Einsatz einer KI, die automatisiert Texte oder Bilder erzeugt, stellen sich verschiedene rechtliche Fragen. Zunächst ist festzuhalten, dass die KI selbst kein Urheber im Sinne des Gesetzes sein kann, da dies nur natürlichen Personen vorbehalten ist. Das bedeutet, dass Nutzungsrechte und Haftungsfragen stets bei den Menschen oder Unternehmen liegen, die die KI einsetzen. Allerdings kann es vorkommen, dass eine KI unabsichtlich geschütztes Material übernimmt oder fremde Werke nachahmt, was zu urheberrechtlichen Konflikten führen kann. Zudem ist das Wettbewerbsrecht zu beachten, wenn etwa fremde Inhalte kopiert oder täuschende Elemente verwendet werden. Eine sorgfältige Überwachung der KI-Generierungen und eine klare vertragliche Regelung der Verantwortlichkeiten sind daher empfehlenswert, um rechtliche Risiken zu minimieren.
Das klingt nach einem vernünftigen Vorgehen. Eine transparente und faire Gestaltung des Bewertungssystems ist nicht nur aus rechtlicher, sondern auch aus vertrieblicher Sicht zu empfehlen, denn ein glaubwürdiges Portal stärkt das Vertrauen aller Beteiligten. Falls im Detail noch Fragen auftauchen, helfe ich Ihnen gerne weiter. Nutzen Sie dazu einfach mein Kontaktformular oder schreiben Sie mir eine E-Mail. Dann können wir eine individuelle Lösung für Ihr Projekt erarbeiten.
Im Wettbewerbsrecht ist vor allem das UWG relevant, hier kann es schnell um unlauteren Wettbewerb gehen, wenn falsche oder irreführende Angaben über Mitbewerber verbreitet werden. Grundsätzlich sind Bewertungen und Scoring-Ergebnisse zulässig, wenn sie auf einem sachlichen Fundament beruhen und korrekt dargestellt werden. Zeigen Sie zum Beispiel deutlich, wie der Score zustande kommt und ermöglichen Sie es dem bewerteten Händler, Stellung zu nehmen oder rechtswidrige Bewertungen melden zu lassen. Eine neutrale Gestaltung des Bewertungsportals verringert das Risiko einer Rufschädigungsklage. Schwierig wird es, wenn Sie absichtlich manipulierte oder unfaire Bewertungen veröffentlichen oder den Eindruck erwecken, der Score sei objektiver, als er ist.
Wenn Sie zusätzliche Daten wie Lieferzeit oder Retourenquote erheben, verknüpfen und diese letztlich auf einzelne Transaktionen zurückführen können, dann verarbeitet das Portal durchaus personenbezogene Daten. Eine präzise Datenschutzerklärung ist hier entscheidend. Sie sollten erläutern, welche Daten gesammelt werden, zu welchem Zweck das Scoring erfolgt und wie lange die Daten gespeichert werden. Soweit Sie sich auf die Einwilligung als Rechtsgrundlage berufen, muss diese freiwillig und informiert sein. Dabei sollte eine klare Opt-in-Lösung verwendet werden, sodass der Nutzer ausdrücklich zustimmt, bevor Sie die zusätzlichen Daten für das Scoring verwenden. Zudem sollten Sie ein Widerrufsrecht einräumen.
Guten Tag und danke für die Frage. Sobald personenbezogene Daten verarbeitet werden – was bei Bewertungen in der Regel der Fall ist, da zumindest indirekt Rückschlüsse auf den Bewerter oder den Bewerteten möglich sind – spielt die DSGVO eine wesentliche Rolle. Ein automatisiertes Scoring kann zudem in den Anwendungsbereich von Art. 22 DSGVO fallen, insbesondere wenn daraus rechtliche oder ähnlich erhebliche Auswirkungen entstehen. Parallel ist auch das UWG (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb) zu berücksichtigen, etwa wenn die Darstellung der Bewertungen und Scores für den Verbraucher irreführend sein könnte. Wichtig ist daher eine transparente Kommunikation gegenüber den Nutzern: welche Daten werden erhoben, wie wird der Score gebildet, und welche Rechte haben die Betroffenen?
Das klingt sinnvoll. Gern stehe ich Ihnen für weitere Fragen oder für eine Detailprüfung zur Verfügung. Gerade bei der Kombination mehrerer Lizenzen ist die genaue Prüfung entscheidend, um Abmahnungen oder Lizenzverletzungen zu vermeiden. Melden Sie sich einfach wieder, wenn Sie Unterstützung benötigen – Sie finden meine Kontaktdaten und ein Anfrageformular direkt auf meiner Website. Ich freue mich, Ihnen weiterhelfen zu können.
Private accounts on ChatGPT & Co. for corporate purposes are a gateway to data protection breaches, leaks of secrets and...
Mehr lesenDetails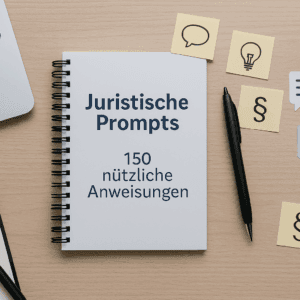 Juristische Prompts - 150 nützliche Anweisungen für jedes LLM
5,99 €
Juristische Prompts - 150 nützliche Anweisungen für jedes LLM
5,99 €
inkl. MwSt.
 Videoberatung via Microsoft Teams 30 Minuten – Schnell, unkompliziert und fokussiert
163,63 €
Videoberatung via Microsoft Teams 30 Minuten – Schnell, unkompliziert und fokussiert
163,63 €
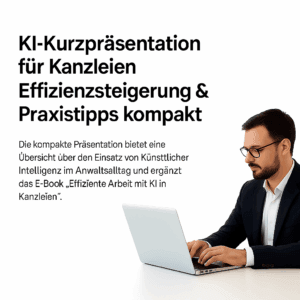 KI-Kurzpräsentation für Kanzleien – Effizienzsteigerung & Praxistipps kompakt
9,99 €
KI-Kurzpräsentation für Kanzleien – Effizienzsteigerung & Praxistipps kompakt
9,99 €
inkl. MwSt.
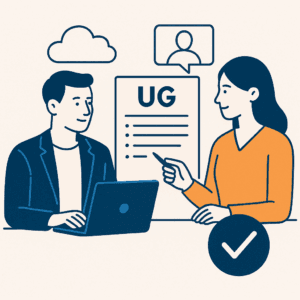 Mustersatzung für eine UG (haftungsbeschränkt)
0,00 €
Mustersatzung für eine UG (haftungsbeschränkt)
0,00 €
 120 Minuten: Videoberatung via Microsoft Teams 120 Minuten – Ausführlich, vertieft und individuell
535,50 €
120 Minuten: Videoberatung via Microsoft Teams 120 Minuten – Ausführlich, vertieft und individuell
535,50 €
In this exciting episode of the itmedialaw podcast, we take a deep dive into the legal developments that will shape...
Mehr lesenDetailsIn this video, I talk a bit about transparent billing and how I communicate what it costs to work with...
Mehr lesenDetails