Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Verstärkung in der Kanzlei
Wie schon angekündigt, wird dies ein spannendes Jahr. Ein Grund dafür ist, dass ich mich nach intensiven Gesprächen mit meiner...
Mehr lesenDetailsIm Game Development ist geistiges Eigentum das wertvollste Gut. Jeder Aspekt eines Videospiels – vom Quellcode über Grafiken und Musik bis hin zu Charakteren und Story – ist durch Urheberrechte oder verwandte Schutzrechte geschützt. Die Rechtekette beschreibt dabei lückenlos, wer zu jedem Zeitpunkt welche Rechte am Spiel und seinen Bestandteilen hält. Eine klare Rechtekette ist entscheidend, um das Spiel rechtssicher vermarkten zu können und spätere Streitigkeiten zu vermeiden. In diesem Blogpost wird juristisch fundiert erläutert, wie die Rechtekette in der Spieleentwicklung verläuft und wer am Ende die Rechte am Spiel hält. Dabei liegt der Fokus auf der Klärung von Rechten bei Engines, Assets, Musik, externen Dienstleistern und KI-generiertem Content.
Im weiteren Verlauf werden zentrale Vertragsarten und Klauseln vorgestellt, die die Rechteverteilung regeln: Werkverträge, Lizenzbedingungen, die Einräumung von Nutzungsrechten sowie Geheimhaltungs- (NDA) und IP-Klauseln. Anschließend widmen wir uns Publisherverträgen mit typischen Klauseln (etwa Right of First Refusal, Exklusivität, Sequel- und Spin-off-Rechte) und dem IP-Management rund um Merchandise, DLCs, Add-ons, Nachfolger und Genre-Spin-Offs. Auch Vertriebsverträge und ihre Auswirkungen auf die Verwertung von Rechten werden beleuchtet. Ein eigenes Kapitel widmet sich Cross-Media-Rechten, also der rechtlichen Seite, wenn Spiele auf Filmen basieren oder umgekehrt Filme aus Spielen entstehen. Schließlich erfolgt ein Vergleich mit den vertraglichen Strukturen der Musik- und Filmindustrie, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauszustellen.
Der Beitrag konzentriert sich auf das deutsche Recht, bezieht aber rechtsvergleichend auch das US-amerikanische System und Lizenzmodelle in Asien mit ein. Wichtige Gesetzesnormen und Gerichtsurteile (aus Deutschland und den USA) werden zitiert, um die Ausführungen zu untermauern. Die Darstellung erfolgt in juristisch-professioneller Sprache und richtet sich an Mandanten aus der Games-, Medien- und Musikbranche, welche eine fundierte Beratung zur Rechtekette in der Spieleentwicklung suchen.
Ein Verständnis der Rechtekette im Game Development beginnt bei den urheberrechtlichen Grundlagen. Nach deutschem Urheberrecht gilt: Urheber eines Werks ist stets die natürliche Person, die es geschaffen hat (vgl. § 7 UrhG). Bei einem Videospiel gibt es jedoch zahlreiche Urheber: Programmierer, Grafiker, Game Designer, Komponisten usw. Jeder von ihnen hat an seinem jeweiligen Beitrag zunächst das Urheberrecht. Das heißt, das Urheberrecht entsteht automatisch mit der Schöpfung des jeweiligen Inhalts und verbleibt grundsätzlich beim Schöpfer. Dieses Urheberrecht ist nicht übertragbar (§ 29 Abs. 1 UrhG) – anders als etwa Eigentum an einer Sache kann man Urheberrechte in Deutschland nicht „verkaufen“. Übertragen werden können lediglich Nutzungsrechte, also Befugnisse, ein Werk auf bestimmte Weise zu verwenden (§ 31 UrhG).
Persönliche geistige Schöpfung und Miturheberschaft: Damit ein Inhalt überhaupt urheberrechtlich geschützt ist, muss er eine persönliche geistige Schöpfung sein (§ 2 Abs.2 UrhG). Reine Spielideen oder einfache Konzepte (etwa ein grobes Game-Design-Dokument) genießen noch keinen Schutz – geschützt ist erst die konkrete Ausgestaltung (Grafiken, Level-Design, Code, Texte usw.). Oft wirken mehrere Personen an einer konkreten Ausgestaltung mit. Erstellen sie einen Inhalt gemeinsam in untrennbarer Weise, können sie Miturheber werden (§ 8 UrhG). Dann steht ihnen das Urheberrecht gemeinschaftlich zu. In der Praxis wird bei Spielen jedoch meist jeder Beitrag separat betrachtet (zum Beispiel schreibt der Programmierer den Code – Software ist ein eigener Werktyp nach § 2 Abs.1 Nr.1, Nr.7 UrhG – und der Grafiker malt die Texturen – Kunstwerke nach § 2 Abs.1 Nr.4 UrhG). Somit entstehen viele einzelne Urheberrechte an den Bestandteilen des Spiels. Diese müssen später zu einer einheitlichen Rechtekette zusammengeführt werden.
Urheberpersönlichkeitsrechte: Wichtig ist, dass Urheber neben den Verwertungsrechten auch Urheberpersönlichkeitsrechte haben, etwa das Recht auf Anerkennung der Urheberschaft (Namensnennung, § 13 UrhG) und den Schutz vor Entstellung des Werks (§ 14 UrhG). Diese Persönlichkeitsrechte bleiben stets beim Urheber und können nicht übertragen oder abgetreten werden. Im Game Development spielt das im Vergleich zur Kunst zwar eine geringere Rolle (die breite Öffentlichkeit kennt selten den einzelnen Level-Designer beim Namen), doch bei Credits in Spielen oder bei nachträglichen Änderungen am Artwork kann das relevant werden. In der Praxis werden Mitarbeiter oder Dienstleister oft vertraglich dazu verpflichtet, auf eine Nennung als Urheber zu verzichten bzw. Änderungen zuzustimmen, soweit rechtlich zulässig. Solche Klauseln müssen jedoch die Grenzen des § 14 UrhG beachten – ein Urheber kann nicht vollständig auf den Schutz vor entstellenden Änderungen verzichten.
Nutzungsrechte und Zweckübertragungsgrundsatz: Weil das Urheberrecht selbst beim Schöpfer verbleibt, wird in Verträgen typischerweise die Einräumung von Nutzungsrechten vereinbart. Ein Nutzungsrecht erlaubt dem Inhaber, das Werk in bestimmter Weise zu nutzen (z.B. zu vervielfältigen, zu verbreiten, öffentlich zugänglich zu machen, siehe § 15 UrhG für die möglichen Verwertungsarten). Nutzungsrechte können einfach (nicht exklusiv, neben dem Urheber dürfen auch andere das Werk nutzen) oder ausschließlich (exklusiv, nur der Rechtenehmer darf nutzen, der Urheber selbst kann es dann nicht mehr nutzen) eingeräumt werden (§ 31 Abs.2 UrhG). Im Spielebereich wird angestrebt, dass am Ende ein Unternehmen alle erforderlichen Rechte exklusiv hat, um das Spiel weltweit auswerten zu können. Zentral ist dabei der Zweckübertragungsgrundsatz (§ 31 Abs.5 UrhG): Danach gilt, dass ein Urheber im Zweifel nur so viele Rechte einräumt, wie zur Erreichung des Vertragszwecks nötig sind. Alle nicht ausdrücklich eingeräumten Nutzungsrechte verbleiben beim Urheber. Zweifel bei unklaren Vertragsbestimmungen gehen zugunsten des Urhebers. Dieser Grundsatz hat der Bundesgerichtshof (BGH) in ständiger Rechtsprechung bestätigt – Verträge über urheberrechtliche Nutzungsrechte sind eng auszulegen, weil man annimmt, dass ein Urheber seine Rechte nicht weitergehend abgeben will als notwendig. Für die Praxis heißt das: Verträge müssen klar und umfassend die Nutzungsrechte aufzählen, die der Auftraggeber oder Publisher erhalten soll. Andernfalls könnte später der Entwickler argumentieren, bestimmte Verwertungsarten (z.B. eine neue Plattform oder ein Spin-off) seien gar nicht von der Rechteeinräumung umfasst gewesen.
Werke unter Mitwirkung mehrerer und Sammelwerke: Ein Videospiel als Gesamtheit ist oft ein sog. multimediales Werk, das verschiedene Werkformen vereint (Softwarecode, Grafik, Musik, Text). Nach deutschem Recht entsteht daraus nicht automatisch ein einheitliches Urheberrecht an dem „Spiel“. Stattdessen hat jeder Urheber sein Recht am eigenen Beitrag. Allerdings gibt es das Konzept des verbundenen Werks bzw. Sammelwerks (§ 4 UrhG): Fügt jemand einzelne Werke zu einem neuen Werk zusammen (z.B. Level-Designer integriert Grafiken, Code und Musik zu einem spielbaren Level), kann dieses Gesamtwerk selbst urheberrechtlich geschützt sein (als Sammelwerk oder Datenbankwerk), aber ohne die Rechte an den Einzelwerken zu schmälern. In der Praxis sorgt man durch Verträge dafür, dass die Nutzung aller Einzelteile erlaubt ist und damit das Gesamtprodukt störungsfrei genutzt und vermarktet werden kann. Im Ergebnis steht am Ende idealerweise ein Unternehmen (z.B. das Entwicklerstudio oder der Publisher) als Inhaber aller maßgeblichen Nutzungsrechte am Spiel. Die Etablierung dieser Rechtekette – vom einzelnen Urheber über eventuelle Zwischenstationen bis zum finalen Rechteinhaber – erfolgt durch diverse Verträge, auf die wir nun im Einzelnen eingehen.
Ein wesentlicher Baustein der Rechtekette sind die Verträge mit denjenigen, die das Spiel tatsächlich erstellen – seien es interne Mitarbeiter eines Entwicklerstudios oder externe Dienstleister und Freelancer, die zuarbeiten. Hier werden die Grundlagen gelegt, damit das Unternehmen später über die Verwertungsrechte am Spiel verfügen kann. Wir betrachten zunächst die Situation bei fest angestellten Mitarbeitern (Arbeitnehmern), dann bei externen Dienstleistern/Freelancern (Werkvertragspartnern), und gehen anschließend auf typische Geheimhaltungs- und IP-Klauseln ein.
In Deutschland gilt auch für Arbeitnehmer: Der arbeitnehmende Programmierer oder Grafiker bleibt Urheber der von ihm geschaffenen Werke. Es gibt – anders als in den USA – keine allgemeine “work for hire”-Regel im Urheberrecht, wonach automatisch der Arbeitgeber Urheber würde. Das deutsche Urheberrecht kennt nur in Sonderfällen automatische Rechteübertragungen an den Arbeitgeber. Ein wichtiger Sonderfall sind Computerprogramme: § 69b UrhG bestimmt, dass bei einem im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses geschaffenen Computerprogramm der Arbeitgeber das ausschließliche Nutzungsrecht erhält, sofern nichts anderes vereinbart ist. Diese Vorschrift erleichtert im Softwarebereich die Rechtekette erheblich, denn der Arbeitgeber muss hier nicht jeden Entwickler einzeln die Rechte am Quellcode abtreten lassen – es geschieht kraft Gesetzes. Beispiel: Programmiert ein festangestellter Mitarbeiter den Code der Game-Engine oder Gameplay-Module, erwirbt das Studio nach § 69b UrhG automatisch die ausschließlichen Nutzungsrechte am Code. Allerdings gilt § 69b UrhG ausschließlich für Software. Andere kreative Beiträge zum Spiel (Grafiken, 3D-Modelle, Dialogtexte, Story, Soundeffekte, Musik, Leveldesign etc.) sind keine Computerprogramme im engeren Sinne und fallen somit nicht unter diese automatische Regelung.
Vertragliche Rechteübertragung in Arbeitsverträgen: Um die Lücke zu schließen, enthalten Arbeitsverträge in der Games-Branche IP-Klauseln, die sicherstellen, dass auch an allen nicht-Software-Werken, die der Mitarbeiter erschafft, die nötigen Nutzungsrechte auf den Arbeitgeber übergehen. Typischerweise wird formuliert, dass der Arbeitnehmer “dem Arbeitgeber an sämtlichen im Rahmen seiner Tätigkeit geschaffenen urheberrechtlich geschützten Werken die ausschließlichen, zeitlich, räumlich und inhaltlich unbeschränkten Nutzungsrechte einräumt”. Eine solche Klausel deckt z.B. vom Mitarbeiter gezeichnete Konzeptgrafiken oder geschriebene Story-Dialoge ab. Wichtig: Inhalt, Dauer und Gebiet der Nutzungsrechteeinräumung sollten umfassend beschrieben sein, um dem Zweckübertragungsgrundsatz gerecht zu werden. Meistens will der Arbeitgeber alle denkbaren Verwertungsrechte (Vervielfältigung, Verbreitung, öffentliche Zugänglichmachung, Bearbeitung, usw.) weltweit und für die komplette Schutzdauer (in Deutschland 70 Jahre post mortem des Urhebers). Oft findet sich daher im Vertrag ein Passus wie:
“Der Angestellte überträgt hiermit dem Arbeitgeber sämtliche ausschließlichen Nutzungsrechte an allen Arbeitsergebnissen, insbesondere an Computerprogrammen (§ 69b UrhG), Grafiken, Texten, audiovisuellen Sequenzen und sonstigen geschaffenen Werken. Die Rechteübertragung erfolgt für alle bekannten und unbekannten Nutzungsarten, unbeschränkt in Zeit, Raum und Inhalt. Der Arbeitgeber ist berechtigt, die Werke zu bearbeiten, umzugestalten, Titel zu vergeben und die Werke mit anderen zu verbinden. Der Angestellte verzichtet auf das Recht zur Urhebernennung. Im Übrigen wird der Angestellte auf Verlangen in eine gesonderte schriftliche Rechteübertragung einwilligen, soweit dies zur Rechtswirksamkeit nach ausländischem Recht erforderlich sein sollte.”
Durch eine solche Klausel wird der Arbeitgeber faktisch zum wirtschaftlichen Rechteinhaber aller vom Mitarbeiter geschaffenen Inhalte. Zu beachten ist allerdings: Ein vollständiger “Rechtekauf” wie im anglo-amerikanischen Raum (Work Made for Hire) ist nach deutschem Recht formal gesehen eine Einräumung von Nutzungsrechten. Das Urheberrecht an sich bleibt – zumindest theoretisch – beim Mitarbeiter. Praktisch hat der Mitarbeiter aber keine Verwertungsrechte mehr und somit keine Kontrolle über die Nutzung seines Werkes.
Moralische Rechte im Arbeitsverhältnis: Ein kniffliger Punkt sind die Urheberpersönlichkeitsrechte der Mitarbeiter. Diese kann man nicht einfach vertraglich “abschalten”. Ein Arbeitgeber möchte aber z.B. frei bearbeiten dürfen, ohne dass der Urheber § 14 UrhG (Entstellungsverbot) geltend macht. In der Praxis werden daher oft Vereinbarungen getroffen, dass der Mitarbeiter auf die Ausübung seiner Urheberpersönlichkeitsrechte verzichtet, soweit gesetzlich zulässig. Beispielsweise erklärt er sich einverstanden, dass das Unternehmen Änderungen an seinen Grafiken oder Texten vornehmen darf (etwa um sie ins Englische zu übersetzen oder an technische Erfordernisse anzupassen). Auch die Urhebernennung wird häufig vertraglich abbedungen – Spiele werden meist unter dem Namen des Studios bzw. Publishers veröffentlicht, nicht unter Nennung jedes einzelnen Mitwirkenden. Solche Verzichtsklauseln sind wirksam, solange der Kern des Urheberpersönlichkeitsrechts nicht ausgehöhlt wird. Die Rechtsprechung lässt z.B. zu, dass ein Urheber auf die Nennung verzichten kann, da dies seinem Interesse, anonym zu bleiben, sogar entsprechen kann. Ebenso darf er im Voraus Änderungen gestatten, sofern keine entstellende Verstümmelung droht. In der Games-Branche sind solche Klauseln üblich, um dem Arbeitgeber maximale Flexibilität zu geben.
Internationaler Aspekt – Arbeitnehmer in anderen Ländern: Viele Studios arbeiten global, mit Teammitgliedern in verschiedenen Ländern. Hier ist zu beachten, dass die Regeln zum Urheberrecht im Arbeitsverhältnis von Land zu Land variieren. In den USA gilt das Konzept des “Work Made for Hire”: erstellt ein Angestellter ein Werk in Ausübung seiner Tätigkeit, gilt der Arbeitgeber nach US-Copyright-Law als rechtmäßiger Autor von Anfang an (17 U.S.C. § 201(b)). Der Mitarbeiter hat dann kein Urheberrecht inne. Auch bei Freien kann in den USA ein Werk-for-hire vorliegen, wenn ein schriftlicher Vertrag das ausdrücklich festlegt und das Werk in eine der zulässigen Kategorien fällt (z.B. „part of a collective work“ – was man nutzen kann, um z.B. ein Spiel als gemeinsames Werk zu deklarieren). Dieses System führt in den USA dazu, dass Spielefirmen in der Regel vollständig als Urheber und Rechteinhaber der entwickelten Spiele gelten. In Japan existiert ein ähnliches Prinzip, allerdings an Bedingungen geknüpft: Das Werk muss im Rahmen der betrieblichen Aufgaben entstanden und unter dem Namen des Unternehmens veröffentlicht worden sein, und es darf keine gegenteilige Vereinbarung geben (Art. 15 japan. UrhG). Dann geht das Urheberrecht auf den Arbeitgeber über. Ausgenommen sind in Japan allerdings Computerprogramme – hier braucht es wiederum eine vertragliche Regelung. In China ist die Rechtslage ebenfalls interessant: Nach chinesischem Urheberrecht hält grundsätzlich der Schöpfer das Urheberrecht, auch als Angestellter, außer das Werk wurde in Erfüllung der dienstlichen Pflichten geschaffen und es wurde vertraglich oder in internen Vorschriften festgelegt, dass die Rechte dem Arbeitgeber zustehen. Viele ausländische Firmen vereinbaren daher in Arbeitsverträgen in China ausdrücklich eine Rechteübertragung auf das Unternehmen.
Zusammenfassung Mitarbeiterrechte: Für ein deutsches Studio ist es essenziell, mit jedem Mitarbeiter eine schriftliche Vereinbarung zu haben, die alle erdenklichen Nutzungsrechte abdeckt – trotz § 69b UrhG, der nur Software umfasst. International tätige Studios müssen berücksichtigen, welches Recht anwendbar ist (oft wird im Vertrag festgelegt, dass deutsches Recht gilt, sofern der Mitarbeiter im Ausland tätig ist, was aber nur bedingt sicher greift). Wichtig ist, dass kein “Rechtsloch” entsteht, etwa ein Künstler im Ausland, der nach lokalem Recht noch Rechte hätte. Verträge sollten deshalb klar regeln, dass das Ergebnis der Arbeit dem Unternehmen zur umfassenden Nutzung zur Verfügung steht.
Neben festen Mitarbeitern bedienen sich viele Entwickler und Publisher externer Dienstleister: Sei es der freiberufliche Konzeptkünstler, ein Composer, ein Synchronsprecher, ein outsourcing-Studio für 3D-Animationen oder auch Testspieler und Berater. Diese externen Partner stehen in keinem Arbeitsverhältnis; ihre Zusammenarbeit wird meist über Werkverträge oder Dienstverträge geregelt. Aus Sicht der Rechtekette ist das Risiko hier sogar höher als bei Mitarbeitern, da ohne klare vertragliche Regelung die vollen Urheberrechte beim externen Dienstleister verbleiben! Es gelten nicht automatisch §§ 69b UrhG oder Work-for-hire, da kein Arbeitsverhältnis vorliegt.
Werkvertrag vs. Dienstvertrag: Zunächst zur Begrifflichkeit: Im Werkvertrag (§ 631 BGB) schuldet der Dienstleister einen bestimmten Erfolg, typischerweise die Lieferung eines vereinbarten Werkes (z.B. “Erstellung von 10 3D-Charaktermodellen gemäß Spezifikation X”). Im Dienstvertrag (§ 611 BGB) schuldet er nur das Bemühen einer Tätigkeit, keinen garantierten Erfolg (z.B. “Beratung als Game-Design-Experte für 3 Monate, durch regelmäßige Meetings und Feedback”). In der Game-Branche werden kreative Leistungen fast immer als Werkvertrag formuliert, weil konkrete Ergebnisse erzielt werden sollen. Das hat auch Auswirkungen auf die Rechte: In der Regel enthält ein Werkvertrag direkt die Abrede, dass mit Ablieferung des Werkes und Zahlung des Honorars die Rechte übergehen.
Nutzungsrechtsklauseln im Werkvertrag: Ein externer Grafikdesigner, der z.B. Figuren entwirft, hat zunächst das Urheberrecht an seinen Zeichnungen. Daher müssen im Vertrag alle benötigten Nutzungsrechte übertragen werden. Eine typische Klausel könnte lauten:
“Der Auftragnehmer überträgt dem Auftraggeber an den im Rahmen dieses Vertrags geschaffenen Werken (einschließlich aller Entwürfe, Grafiken, Modelle, Animationen, Texte und sonstigen Inhalte) das ausschließliche, zeitlich, räumlich und inhaltlich unbeschränkte Nutzungsrecht. Die Rechteeinräumung umfasst sämtliche bekannten Nutzungsarten, insbesondere das Recht zur Vervielfältigung, Verbreitung, öffentlichen Zugänglichmachung, Ausstellung, Vorführung, Sendung sowie das Recht zur Bearbeitung und Weiterentwicklung der Werke. Der Auftraggeber ist berechtigt, die Werke im Rahmen des Computerspiels [Name/Titel] sowie für darauf basierende Produkte (z.B. Fortsetzungen, Erweiterungen, Merchandise) nach Belieben zu verwenden und auch Dritten Nutzungsrechte hieran einzuräumen oder zu übertragen. Mit der vereinbarten Vergütung sind sämtliche Nutzungsrechte abgegolten.”
Eine solche umfassende Formulierung stellt sicher, dass das Studio bzw. der Publisher das vom Freelancer gelieferte Material beliebig nutzen kann, inklusive Abwandlungen (wichtig z.B. falls das 3D-Modell später für ein Sequel modifiziert wird) und Folgeprodukte. Wichtig ist auch die Erwähnung von Merchandising und weiterer Medien, da dies sonst als andere Nutzungsart gelten könnte. Beispielsweise könnte ein Illustrator theoretisch untersagen, dass seine Figurendesigns auf T-Shirts gedruckt werden, falls im Vertrag nur von “Verwendung im Spiel” die Rede war. Daher wird die Nutzung über das Spiel hinaus (Merchandise, Trailer, Spin-Offs etc.) idealerweise mit abgedeckt.
Werkverträge mit „Lieferung Zug um Zug“: In umfangreichen Projekten werden Werkverträge oft in Meilensteine aufgeteilt. Es ist üblich – besonders bei größeren Auftragsentwicklungen – die Rechte jeweils Zug um Zug mit der Zahlung des Meilensteins zu übertragen. Das heißt, nach Fertigstellung und Bezahlung eines Teils der Arbeit gehen die Rechte daran auf den Auftraggeber über. Dadurch soll verhindert werden, dass der Auftraggeber Geld investiert, aber am Ende ohne Rechte dasteht, falls das Projekt abgebrochen wird. Umgekehrt erhält der Dienstleister für jeden abgelieferten Teil seine Vergütung und behält bis zur Zahlung noch ein Zurückbehaltungsrecht an den gelieferten Dateien. Dieses Modell (Schritt-für-Schritt-Übertragung) hat der Vorteil, dass der Auftraggeber bereits Teilergebnisse nutzen kann, sollte der Vertrag vorzeitig enden. Andernfalls hätte der Auftraggeber ggf. viel gezahlt, aber alle Rechte lägen noch beim Dienstleister, was problematisch wäre, wenn man z.B. schon Grafiken im Spiel hat. Rechtlich wird bei Zug-um-Zug oft vereinbart, dass mit der Abnahme jedes Meilensteins und dessen Bezahlung automatisch die Nutzungsrechte daran exklusiv auf den Auftraggeber übergehen.
Gewährleistung der Rechtekette und Garantien: Gerade bei externen Dienstleistern muss der Vertrag auch regeln, dass nur eigene oder entsprechend lizenzierten Inhalte geliefert werden. Der Entwickler will nicht riskieren, dass ein Freelancer etwa fremdes Material einbaut (z.B. eine Textur aus dem Internet kopiert), an dem er gar keine Rechte hat. Deshalb enthalten IP-Klauseln fast immer eine Zusicherung des Dienstleisters, dass die gelieferten Werke frei von Rechten Dritter sind, und dass er alle erforderlichen Rechte eingeholt hat. Oft wird konkret erwähnt, dass der Dienstleister z.B. keine geschützten Marken, Logos, urheberrechtlich geschützten Vorlagen oder Musikstücke Dritter verwenden darf, außer dies wurde vom Auftraggeber genehmigt. Falls der Dienstleister selbst Hilfsmittel benutzt (z.B. Stock-Assets, Libraries), muss er garantieren, dass die entsprechende Nutzung im Spiel vom Vertrag gedeckt ist. Zudem wird eine Freistellungsklausel (indemnification) vereinbart: Sollte doch ein Dritter Ansprüche wegen Rechtsverletzungen stellen, stellt der Dienstleister den Auftraggeber von allen Schäden und Kosten frei. Solche Klauseln sind gerade im internationalen Kontext wichtig, wenn Dienstleister etwa aus Ländern kommen, wo Copyright anders gehandhabt wird – das Risiko wird vertraglich auf den Dienstleister abgewälzt.
Besondere Fälle: Musiker und Verwertungsgesellschaften: Ein typischer Stolperstein in der Rechtekette sind Musikkompositionen, die von externen Komponisten stammen. Viele Musiker sind Mitglieder von Verwertungsgesellschaften wie der GEMA. Wenn ein Komponist einen Wahrnehmungsvertrag mit der GEMA hat, hat er fast alle Nutzungsrechte an seinen zukünftigen Werken bereits exklusiv an die GEMA übertragen. Das bedeutet: Selbst wenn der Komponist vertraglich dem Entwicklerstudio alle Rechte an der Spielmusik einräumt, kann er diese Zusage nicht erfüllen, weil die GEMA (stellvertretend für ihn) über z.B. das öffentliche Aufführungsrecht oder das Vervielfältigungsrecht für Tonträger wacht. In solchen Fällen muss das Studio die Musiknutzung mit der GEMA abrechnen – was teuer und kompliziert sein kann, insbesondere weil ein Spiel typischerweise keine eigenständigen Musik-Tonträger veröffentlicht. Aus diesem Grund wird oft darauf geachtet, dass beauftragte Komponisten nicht Mitglied einer Verwertungsgesellschaft sind. Im Vertrag mit dem Komponist steht dann ausdrücklich, dass er versichert, keinem Wahrnehmungsvertrag (etwa mit GEMA) beigetreten zu sein. Sollte er es doch sein, muss er das mitteilen, und der Vertrag kann ggf. aufgehoben werden. Die deutsche Rechtsprechung hat hier die sogenannte “GEMA-Vermutung” entwickelt: Danach wird zugunsten der GEMA vermutet, dass sie die Rechte an einem Musikstück wahrnimmt, sofern der Urheber GEMA-Mitglied ist und das Stück veröffentlicht wurde. Das heißt, ein Spieleentwickler müsste im Streitfall beweisen, dass der Komponist nicht GEMA-Mitglied ist, um nicht zahlen zu müssen. Daher die Vorsichtsmaßnahme, GEMA-Mitglieder gar nicht erst zu beauftragen, oder wenn doch, dann nur nach Sondervereinbarungen. – Dieses Beispiel zeigt, wie wichtig die lückenlose Rechtekette ist: Ein unbedacht engagierter Komponist mit GEMA-Bindung könnte dazu führen, dass das Spiel z.B. auf Messen oder Streams nicht ohne GEMA-Gebühren mit Musik gezeigt werden darf. Entsprechende vertragliche Klauseln und Prüfungen im Vorfeld sind also ein Muss.
Geheimhaltungsvereinbarungen (NDA): Sowohl mit Mitarbeitern als auch mit externen Dienstleistern werden Geheimhaltungsvereinbarungen (Non-Disclosure Agreements) geschlossen. In der Games-Branche oft schon bevor detaillierte Gespräche beginnen, unterschreibt der potenzielle Partner eine NDA. Darin verpflichtet er sich, sämtliche vertrauliche Informationen über das Projekt, die ihm bekannt werden, geheim zu halten und nicht an Dritte weiterzugeben oder für eigene Zwecke zu nutzen. Für die Rechtekette ist ein NDA zwar indirekt relevant – es schützt keine Urheberrechte, aber es verhindert, dass Ideen oder nicht veröffentlichte Assets unautorisiert nach außen gelangen. Beispielsweise möchte ein Entwickler vermeiden, dass ein Freelancer Konzeptgrafiken des neuen Spiels auf seiner Webseite veröffentlicht, bevor das Spiel angekündigt ist. NDAs enthalten oft auch Klauseln, die klarstellen, dass alle Unterlagen und Materialien Eigentum des Auftraggebers bleiben und nach Ende der Zusammenarbeit zurückzugeben oder zu löschen sind. Außerdem wird geregelt, dass die Geheimhaltung auch nach Beendigung der Zusammenarbeit fortwirkt (oft unbegrenzt, oder zumindest bis zur öffentlichen Veröffentlichung des betreffenden Projekts).
IP-Klauseln und Rechte an Vorarbeiten: In manchen Fällen bringt ein Dienstleister eigene bereits bestehende Materialien mit ins Projekt (z.B. ein selbstentwickeltes Tool, ein eigenes Template etc.). Hier können vertragliche IP-Klauseln regeln, wem diese Pre-Existing Materials gehören und wie sie genutzt werden dürfen. Üblich ist, dass der Dienstleister daran die Rechte behält, aber dem Studio ein Nutzungsrecht einräumt, soweit es ins Spiel eingebunden wird. Ebenso achten Auftragnehmer darauf, dass sie Referenzrechte bekommen – in der Kreativbranche möchte ein Freelancer das geschaffene Werk später als Referenz im Portfolio zeigen dürfen. Viele Verträge gewähren dieses Recht ausdrücklich, jedoch erst nach Release des Spiels und oft nur in beschränkter Form (z.B. Ausschnitte, kein kompletter Source-Code oder gesamte Assets öffentlich).
Zwischenfazit externe Verträge: Werkverträge mit externen sind ein potentielles Risiko für die Rechtekette, wenn sie nicht wasserdicht formuliert sind. Alle urheberrechtlichen Nutzungsrechte müssen eindeutig geregelt und vom Dienstleister auf den Auftraggeber übertragen werden. Darüber hinaus sind Zusicherungen einzuholen, dass keine Rechte Dritter verletzt werden, und es ist für Geheimhaltung zu sorgen. Gelingt dies, fügen sich die Beiträge der Freelancer nahtlos in die Rechtekette ein, und das Studio bzw. der Publisher kann das Gesamtprodukt später ohne Einschränkungen verwerten.
Ein vergleichsweise neues Thema in der Rechtekette sind KI-generierte Inhalte. Künstliche Intelligenz kann heute Grafiken, Dialogtexte oder sogar Musik generieren. Viele Entwickler nutzen z.B. Tools wie neuronale Netzwerke, um prozedural Landschaften oder Item-Beschreibungen zu erstellen. Hier stellt sich die Frage: Wer hält die Rechte an einem von KI generierten Werk? Und gibt es überhaupt urheberrechtliche Rechte daran?
Urheberrechtlicher Status KI-generierter Werke: Nach derzeitiger Rechtslage in Deutschland sind rein KI-generierte Inhalte nicht urheberrechtlich geschützt. § 2 Abs.2 UrhG verlangt eine persönliche geistige Schöpfung – also ein menschliches Schaffen. Eine Maschine oder Software als solche kann kein Urheber sein. Wenn also z.B. mittels eines Textgenerators (ohne wesentliche menschliche Bearbeitung) ein Quest-Text erzeugt wird, hat dieser Text keinen Urheberrechtsschutz. Niemand – weder der Entwickler noch der KI-Tool-Anbieter – hat ein Urheberrecht daran, da es keinen menschlichen Schöpfer gibt. Die Folge: Jeder Dritte könnte theoretisch diesen Text verwenden, kopieren oder veröffentlichen, ohne den Entwickler zu fragen. Das gleiche gilt für KI-Bilder aus Tools wie Midjourney: Werden sie 1:1 ins Spiel übernommen, genießen sie keinen Schutz, können also von anderen frei kopiert werden. Für die Rechtekette bedeutet das einen Bruch im Exklusivitätsanspruch: Das Studio hat zwar keine fremden Urheber, die Rechte geltend machen könnten, aber eben auch selbst kein durchsetzbares Urheberrecht. Damit fehlt die Grundlage, um Dritten die Nutzung zu untersagen. Gerade wenn ein Spiel auf markanten Charakterporträts oder Artworks basiert, die per KI erstellt wurden, könnte ein Konkurrent diese Grafiken ohne Lizenz verwenden – ein erhebliches Risiko für die Vermarktung und Monetarisierung (z.B. in Form von Merchandise).
Strategien im Umgang mit KI-Inhalten: Die Praxis hat darauf erste Antworten gefunden. Es empfiehlt sich, KI-Generierte Inhalte stets nachzubearbeiten, sodass eine menschliche Schöpfungshöhe hinzukommt. Zum Beispiel könnte ein Game Artist KI-erstellte Konzeptkunst als Grundlage nehmen, aber dann manuell übermalen, Details hinzufügen und das Ergebnis kreativ umgestalten. Dadurch entstehen eigensschöpferische Züge des menschlichen Bearbeiters, und das Endresultat wird wiederum zum schützbaren Werk. Der Urheber wäre der menschliche Bearbeiter. Dieser Ansatz – KI als Hilfsmittel, nicht als autonomer Schöpfer – ermöglicht es, Effizienzgewinne durch KI zu nutzen, ohne den Rechtsschutz vollständig aufzugeben. Allerdings muss klar sein, dass der Schutzumfang dann nur die vom Menschen eingebrachten Elemente umfasst. Je substantieller der menschliche Anteil, desto sicherer ist die Schutzfähigkeit.
Wenn KI-Inhalte ohne (oder mit minimaler) Bearbeitung verwendet werden, sollte man sie eher für unwesentliche Bereiche einsetzen: etwa zufällig generierte NPC-Dialoge oder Hintergrundgrafiken, bei denen es weniger auf Exklusivität ankommt. Im Team sollte dokumentiert werden, was vollautomatisch erzeugt wurde und was menschlich angepasst ist, um später Klarheit zu haben, welche Teile urheberrechtlich gesichert sind.
Vertrags- und Lizenzfragen bei KI-Tools: Noch eine andere Facette: Die Nutzung von KI-Generatoren erfolgt oft auf Grundlage von Nutzungsbedingungen der Anbieter (z.B. Terms of Service von OpenAI, Midjourney etc.). Diese regeln, wem die Verwertungsrechte am Output zustehen. Häufig gewähren die Anbieter dem Nutzer umfassende Rechte am generierten Output. Das ändert nichts daran, dass kein Urheberrecht entsteht, aber zumindest vertraglich darf der Entwickler den Output nutzen und Dritte (der KI-Anbieter) werden keine Ansprüche erheben. Allerdings haben viele Tools Klauseln, die z.B. verlangen, dass man keine rechtswidrigen Prompt-Eingaben macht oder Ausgaben nicht für bestimmte Zwecke einsetzt. Hier ist also ein neuer Punkt in der Rechtekette: Lizenzbedingungen des KI-Anbieters. Ein Verstoß (z.B. wenn jemand mit geklauten Bildern die KI trainiert) kann die Lizenz verletzen und dem Anbieter theoretisch Rechte geben, die Nutzung zu untersagen. Zudem stellt sich bei KI-Texturen oder KI-Soundeffekten die Frage, ob der KI-Anbieter eventuell das Output-Material weiterverwendet oder in seinen Datensätzen speichert – was bei sensiblen internen Inhalten (Leveldesign, geheime Figurenentwürfe) datenschutz- oder vertraulichkeitsrechtlich problematisch sein kann. Deshalb gehen große Studios dazu über, eigene KI-Modelle auf internen Daten zu trainieren, damit nichts nach außen dringt.
Urheberrechte Dritter im Training: Noch komplexer ist das Thema, ob die Nutzung von KI generierten Inhalten die Urheberrechte Dritter verletzen kann. KI-Modelle werden mit Unmengen an Daten (Bildern, Texten etc.) trainiert, oft aus dem Internet gesammelt. Dabei werden selbstverständlich auch urheberrechtlich geschützte Werke kopiert und verarbeitet. Das Training an sich kann je nach Jurisdiktion als zulässiges Data-Mining gelten (in der EU gibt es in § 44b UrhG eine Schrankenregelung, die unter bestimmten Umständen das automatisierte Auswerten rechtmäßig zugänglicher Werke erlaubt). Allerdings darf kein Nutzungsvorbehalt entgegenstehen – viele Künstler haben inzwischen in ihren Bildern „do not train“ Vermerke oder es gibt Metadaten/Wasserzeichen, die Training untersagen sollen. Wenn ein KI-Modell unter Verletzung solcher Verbote trainiert wurde, könnten die Trainingsergebnisse mit einem Makel behaftet sein.
Für die Spielentwicklung bedeutet dies: Verwendet man ein fremdes KI-Modell, weiß man nicht sicher, ob dieses Modell sauber trainiert wurde. Sollte sich später herausstellen, dass z.B. ein KI-Bild klar erkennbare Elemente eines geschützten fremden Kunstwerks enthält (weil das Modell dieses praktisch „reproduziert“ hat), könnte der Urheber des Originals Ansprüche geltend machen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein generisches KI-Tool zufällig ein fremdes Werk praktisch kopiert, ist zwar gering – aber es gab schon Fälle, in denen KI-Bilder charakteristische Merkmale von bestimmten Künstlern aufwiesen, was deren Urheberrechte tangieren kann.
Die große Spieleplattform Steam (Valve) hat reagiert: Valve weigert sich, Spiele mit KI-Generierten Inhalten zu veröffentlichen, solange die Rechtslage ungeklärt ist. In einem bekannt gewordenen Fall erhielt ein Entwickler von Valve eine Absage für sein Spiel, da es KI-generierte Grafiken enthielt, die offenbar auf urheberrechtlich geschütztes Material Dritter zurückgriffen. Valve verlangte den Nachweis, dass der Entwickler alle Rechte an den Werken besitzt, die im Trainingsdatensatz der KI enthalten waren. Ein praktisch unmögliches Ansinnen, da der Entwickler das KI-Modell nicht selbst trainiert hatte. Diese strikte Haltung zeigt, dass zumindest einige Marktakteure das Risiko als hoch einschätzen und im Zweifel keine unauthorisierten KI-Inhalte dulden wollen, um keine Rechtsverletzungen zu fördern.
Fazit KI im Rechtekettensystem: Für Entwickler bedeutet das: Wenn KI eingesetzt wird, sollte dies mit Umsicht geschehen. Verträge mit externen Dienstleistern könnten Klauseln enthalten, die den Einsatz von KI regeln – etwa dass der Freelancer kein KI-Tool verwenden darf, um das beauftragte Werk zu erstellen, ohne Zustimmung. Intern sollten Unternehmen festlegen, wann KI genutzt wird und wie man sicherstellt, dass die Ergebnisse entweder unbedenklich (weil gemeinfrei oder geringwertig) sind oder durch menschliche Bearbeitung schutzfähig gemacht werden. Bis zur Klärung in Gesetzgebung oder Rechtsprechung (weltweit wird über den Urheberrechtsschutz von KI-Werken diskutiert) gilt: Lieber die KI als kreativen Assistenten nutzen, nicht als alleinigen Künstler – dann bleibt die Rechtekette auch hier unter Kontrolle des Menschen. Im Zweifel ist es besser, auf KI-Content dort zu verzichten, wo man später exklusive Rechte benötigt (z.B. Hauptcharaktere, Story-Illustrationen), und KI eher für generische Inhalte einzusetzen.
Ist ein Spiel einmal entwickelt oder in Entwicklung, kommt meist ein Publisher ins Spiel. Publisher übernehmen Finanzierung, Marketing und Vertrieb eines Games – und verlangen im Gegenzug umfangreiche Rechte. Der Publishing-Vertrag steht somit im Zentrum der Rechtekette: Hier entscheidet sich, wer letztlich die Rechte am fertigen Spiel hält und in welchem Umfang. Wir betrachten die typischen Klauseln eines Publisher-Vertrags aus rechtlicher Sicht, insbesondere in Bezug auf IP (Intellectual Property) und Verwertungsrechte. Themen sind u.a. die Übertragung von Nutzungsrechten, Exklusivität, Optionen auf Fortsetzungen (Right of First Refusal), Sequels/Spin-offs und andere branchenübliche Regelungen.
Man kann grob zwei Modelle unterscheiden: Auftragsentwicklung (der Publisher beauftragt den Entwickler im Wege eines Werkvertrags, das Spiel für ihn zu erstellen – hier behält am Ende meist der Publisher die IP) und Lizenzmodell (der Entwickler hat ein fertiges oder weit entwickeltes Spiel und gibt dem Publisher “nur” die Vertriebs- und Marketingrechte – hier kann die IP beim Entwickler verbleiben). In der Praxis gibt es viele Mischformen. Wichtig ist, dass im Vertrag klar definiert wird, welche Partei Eigentümer der Rechte am Spiel ist bzw. wird.
Ein Kernstück jedes Publishing-Deals ist die IP-Klausel, die festlegt, wem die geistigen Eigentumsrechte am Spiel gehören. Hier gibt es zwei Extreme und diverse Zwischenstufen:
Umfang der Nutzungsrechte (Scope of License): Entscheidend ist, dass das Nutzungsrecht, das dem Publisher eingeräumt wird, inhaltlich, zeitlich und räumlich bestimmt wird. In der Regel strebt ein Publisher folgende Punkte an:
Auch Promotionsrechte sollten genannt sein: Das Recht, Trailer, Screenshots, Artwork usw. des Spiels für Werbung zu nutzen. Juristisch sind Trailer eigenständige Filmwerke, Screenshots wiederum Vervielfältigungen des Grafikwerks – der Einfachheit halber regeln Verträge, dass der Publisher berechtigt ist, Werbematerial herzustellen und zu verbreiten.
Eine Rechterückfallklausel ist insbesondere dann wichtig, wenn Rechte sehr breit eingeräumt wurden: Beispielsweise weltweite Rechte, aber der Publisher nutzt einige Territorien nicht (er bringt das Spiel z.B. nie in Japan heraus). Hier vereinbaren manche Verträge, dass das Recht für ungenutzte Regionen zurück an den Entwickler fällt, sollte der Publisher innerhalb eines bestimmten Zeitraums dort keine Veröffentlichung vornehmen. Alternativ kann geregelt sein, dass der Entwickler selbst ersatzweise dort veröffentlichen darf oder einen Dritten einsetzen darf, falls der Publisher nicht aktiv wird.
Exklusivität ist in Publisherverträgen die Regel. Das bedeutet, der Publisher hat das ausschließliche Recht, das Spiel in den vereinbarten Formen zu vertreiben – der Entwickler darf also nicht parallel oder nachträglich einen anderen Publisher oder Vertriebsweg für das gleiche Spiel nutzen (solange der Vertrag läuft). Exklusivität bezieht sich in erster Linie auf die oben genannten Nutzungsrechte: sind diese als “ausschließlich” vereinbart, ist per se Exklusivität gegeben.
Allerdings finden sich oft darüber hinausgehende Wettbewerbsklauseln. Ein Beispiel ist eine Non-Compete-Klausel, die dem Entwickler untersagt, während der Vertragslaufzeit (und manchmal für eine gewisse Nachlaufzeit) konkurrierende Spiele zu entwickeln oder zu veröffentlichen. Die Idee dahinter: Der Publisher investiert Marketing in das Spiel und will nicht, dass der Entwickler zeitgleich ein sehr ähnliches Spiel eventuell selbst herausbringt, das Konkurrenz macht. In einem Vertragsentwurf könnte stehen: “Der Entwickler wird ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Publishers kein anderes Videospiel entwickeln, vertreiben oder unterstützen, das direkt mit dem vertragsgegenständlichen Spiel in Wettbewerb tritt oder dessen Erfolg kannibalisiert.” Solche Klauseln müssen eng definiert sein – was heißt “in Wettbewerb”? Oft beschränkt man es auf das Genre oder die IP. Beispiel: Wenn der Entwickler ein Fantasy-Rollenspiel mit dem Publisher veröffentlicht, könnte die Non-Compete untersagen, dass der Entwickler zeitgleich ein anderes Fantasy-Rollenspiel mit ähnlicher Thematik für einen anderen Publisher macht.
Manchmal geht die Exklusivität so weit, dass der Entwickler generell keine anderen Spiele veröffentlichen darf, solange er an dem finanzierten Projekt arbeitet – schlicht weil seine Kapazität voll gebunden sein soll. Insbesondere bei kleineren Studios mit begrenztem Personal will ein Publisher sicherstellen, dass alle Ressourcen in sein Projekt fließen. Diese Art Non-Compete entspricht fast einem Exklusivitäts-First-Look-Vertrag mit dem Publisher und kann das Studio stark einschränken.
Einklagbarkeit von Non-Competes: In Deutschland sind nachvertragliche Wettbewerbsverbote für Selbständige schwieriger durchsetzbar als im anglo-amerikanischen Raum. Allzu weitgehende, unbefristete Verbote könnten als Verstoß gegen § 138 BGB (Sittenwidrigkeit) oder als unverhältnismäßige Einschränkung der Berufsfreiheit gesehen werden, wenn dem Entwickler keinerlei Ausgleich gezahlt wird. Daher achten seriöse Verträge darauf, zeitliche Begrenzungen zu setzen (z.B. Non-Compete gilt bis X Monate nach Release des Spiels) und den Umfang zu beschränken (nur ähnliche Spiele, nicht jede Tätigkeit). Hinweis: In einigen Rechtsordnungen der USA sind Non-Compete-Klauseln gegenüber Individuen mittlerweile per Gesetz beschränkt oder verboten (etwa in Kalifornien). Für Unternehmen gelten sie jedoch eher. In der Praxis wird dieser Punkt oft weniger problematisch gesehen, da Entwickler eigenständig ohnehin selten zwei konkurrierende Projekte parallel fahren; aber er kann wichtig werden, wenn das Studio andere Ideen verfolgen will.
Exklusivität der Rechte vs. Mitwirkung Dritter: Eine andere Exklusivität betrifft den Publisher selbst: Der Entwickler möchte, dass der Publisher ausschließlich sein Spiel in dem Genre vermarktet, oder dass er sich voll engagiert. In der Regel kann man einem Publisher kaum verbieten, auch Konkurrenzprodukte zu vertreiben (ein Publisher veröffentlicht oft mehrere ähnliche Titel). Was aber vorkommt, sind “Key Man”-Klauseln oder Prioritätsklauseln, die sicherstellen sollen, dass das Entwicklerprojekt nicht vernachlässigt wird. Z.B. könnte im Vertrag stehen, dass ein bestimmter Producer des Publishers dem Projekt zugewiesen bleibt, oder dass das Marketing-Budget mindestens Summe X betragen muss – das sind indirekte Wege, die “Exklusivität” der Aufmerksamkeit sicherzustellen. Im Kern bleibt aber: Der Publisher hat exklusiv die Rechte am Spiel, und der Entwickler verpflichtet sich, keine konkurrierenden Rechte einzuräumen.
Auch wenn es in diesem Beitrag hauptsächlich um die Rechte geht, hängt die Rechtefrage eng mit der Finanzierung und Vergütung im Publishervertrag zusammen. Denn wer die Entwicklung bezahlt, hat meist das stärkere Argument, auch die Rechte zu kontrollieren. Außerdem definieren Vergütungsmodelle oft, wie weit der Publisher die Rechte nutzen darf und wie lange.
Vorschuss und Royalties: Üblich ist, dass der Publisher dem Entwickler einen Entwicklungsvorschuss zahlt (eine Art Budget oder Meilensteinzahlungen), und im Gegenzug später den Löwenanteil der Erlöse einbehält, bis der Vorschuss rekapitalisiert ist (sich „recoupt“). Danach teilen sich Entwickler und Publisher die Gewinne gemäß einem vereinbarten Schlüssel (Royalties). Diese finanzielle Konstruktion wirkt sich rechtlich so aus, dass der Publisher ein starkes Interesse hat, das Spiel umfassend auszuwerten, aber auch, dass er das Spiel möglicherweise behält, selbst wenn der Entwickler unzufrieden ist – solange Geld im Spiel ist. Es gibt Fälle, in denen ein Spiel profitabel läuft, aber der Entwickler durch ungünstige Royalty-Bedingungen lange braucht, um über den Break-Even zu kommen; währenddessen hält der Publisher alle Rechte.
Koppelung von Rechten an Zahlung: Für Entwickler ist es wichtig, Klauseln zu haben, die bei Zahlungsstörungen Einfluss auf die Rechte haben. Beispielsweise: “Sollte der Publisher fällige Zahlungen (z.B. Meilenstein-Tranche oder Royalty-Auskehrungen) nicht leisten, ist der Entwickler berechtigt, den Vertrag außerordentlich zu kündigen und einen sofortigen Rechterückfall zu verlangen.” Damit schützt man sich, falls der Publisher zahlungsunfähig wird oder seine Verpflichtungen verletzt – der Entwickler könnte dann seine Rechte am Spiel zurückholen und etwa einen neuen Partner suchen. Ohne solche Klauseln stünde der Entwickler im Worst Case mit einem halbfertigen Spiel und ohne Rechte da, falls der Publisher ausfällt.
Laufzeit des Vertrags: Ein Publishing-Vertrag hat oft eine definierte Laufzeit, etwa “x Jahre ab Erstveröffentlichung” oder “bis zum Ende der Schutzfrist”. Sofern befristet, sollte auch geregelt sein, was nach Ende passiert: idealerweise Rückübertragung der Rechte an den Entwickler. Manchmal behalten Publisher auch nach Ablauf noch bestimmte Rechte (etwa das Spiel weiterhin zu vertreiben, aber nicht mehr exklusiv). In jedem Fall ist die Laufzeit ein heikler Punkt: Ein kurzer Vertrag gibt dem Entwickler perspektivisch die IP zurück, ein unbefristeter Vertrag bedeutet, dass der Publisher “für immer” aus dem Spiel schöpfen kann.
Right of First Refusal / Optionsrechte: Besonders zu erwähnen sind Klauseln für künftige Projekte. Viele Publisher lassen sich eine Option auf das nächste Spiel des Entwicklers einräumen, oder zumindest auf Fortsetzungen. Das bekannteste Modell ist der Right of First Refusal (ROFR), also ein Vorkaufsrecht im weiteren Sinne: Der Entwickler muss dem Publisher als erstem die Möglichkeit geben, das nächste Spiel (oder einen “Nachfolger” zum aktuellen Spiel) zu veröffentlichen, bevor er mit anderen verhandelt. Eine typische Formulierung wäre:
“Der Entwickler räumt dem Publisher hinsichtlich des nächsten vom Entwickler nach Fertigstellung des vertragsgegenständlichen Spiels geplanten Videospiels ein Erstverhandlungsrecht ein. Der Entwickler wird dem Publisher das Konzept des nächsten Spiels schriftlich anbieten. Der Publisher hat ab Zugang dieses Angebots 60 Tage Zeit, ein Vertragsangebot für die Veröffentlichung zu unterbreiten. Lehnt der Publisher ab oder verstreicht die Frist ohne Angebot, ist der Entwickler frei, Dritten das Spiel anzubieten. Nimmt der Publisher an, werden die Parteien in Verhandlungen über einen neuen Publishing-Vertrag zu branchenüblichen Konditionen eintreten.”
Diese Klausel sichert dem Publisher den ersten Zugriff. Eine verschärfte Variante ist ein Matching Right: Selbst wenn der Entwickler woanders ein Angebot erhält, darf der Publisher das Angebot gleichen und bekommt dann den Zuschlag. Damit ist der Entwickler faktisch gebunden, solange der Publisher mitzieht. Aus Entwicklersicht sind solche Klauseln gefährlich, wenn das Verhältnis zum Publisher schwierig ist – man kommt nur schwer los, weil man immer erst dem alten Partner die Chance geben muss, und eventuell schrecken andere potentielle Publisher ab, wenn sie wissen, sie könnten am Ende vom Alt-Publisher überboten werden.
Exklusivität für Sequels und Spin-offs: Nahe verwandt ist die Frage nach Fortsetzungen (Sequels) und Spin-Offs. Wenn ein Publisher das IP kontrolliert, wird er natürlich auch Fortsetzungen selbst herausbringen wollen (oft ist das wirtschaftlich am attraktivsten). Ein Publishervertrag, der dem Publisher die IP übertragen hat, braucht streng genommen keine separate Sequels-Klausel – der Publisher besitzt ja die Marke und kann jeden Entwickler beauftragen, ein Sequel zu erstellen, ohne den ursprünglichen Entwickler zu fragen. Allerdings kann vertraglich vereinbart sein, dass der ursprüngliche Entwickler ein Vorkaufsrecht bekommt, das Sequel zu entwickeln. Das ist quasi die Kehrseite: Nicht der Publisher hat das Vorkaufsrecht, sondern der Entwickler auf den Folgeauftrag. Solche Abmachungen sind allerdings selten, meist versucht eher der Entwickler eine Chance auf Folgeaufträge hineinzuschreiben (“Publisher wird bei Fortsetzungen den Entwickler angemessen berücksichtigen”).
In Fällen, in denen der Entwickler IP-Inhaber bleibt, ist es umgekehrt: Der Publisher möchte zumindest die Option haben, eine Fortsetzung ebenfalls vertreiben zu dürfen. Hier taucht oft eine Optionsklausel auf: “Für den Fall, dass der Entwickler einen Nachfolger oder ein Add-On zu dem Spiel entwickelt, wird der Entwickler dem Publisher das ausschließliche Angebot machen, dieses Produkt zu vermarkten, zu Konditionen, die nicht schlechter sind als die dieses Vertrags.” – Das bindet den Entwickler insofern, als er nicht einfach mit dem Erfolg des ersten Spiels zum nächstbesten Anbieter laufen kann, ohne dem bisherigen Publisher eine faire Chance zu geben.
Spin-Offs und Nebennutzungen: Ein Spin-Off könnte z.B. bedeuten, dass man mit der Spiele-Engine ein Spiel in anderem Genre baut (z.B. aus einem RPG einen Strategiespiel-Ableger mit den gleichen Figuren). Wenn der Publisher IP-Inhaber ist, deckt das i.d.R. auch solche Abwandlungen – sie sind streng genommen Bearbeitungen des ursprünglichen Werkes, was von den erworbenen Rechten meist umfasst ist. War der Entwickler IP-Inhaber und hat dem Publisher nur das konkrete Spiel lizenziert, stellt sich die Frage: Gehören Spin-Offs dazu? Hier hilft nur Vertragsklarheit. Entweder zählt man Spin-Offs als Teil der lizenzierten Rechte auf (was ungewöhnlich wäre, weil Spin-Offs erst mal hypothetisch sind), oder man belässt es dem Entwickler, aber gibt dem Publisher ein Vorkaufsrecht.
Beispiel zur Veranschaulichung: Ein Entwicklerstudio bringt mit Publisher A ein erfolgreiches Jump’n’Run-Spiel heraus. Nun plant das Studio, mit den gleichen Charakteren ein Rennspiel (Kart-Racer) zu machen. Wenn Publisher A die IP vollständig besitzt, kann das Studio dieses Vorhaben nicht ohne A umsetzen – A entscheidet, ob und mit wem ein Rennspiel entsteht. Hatte Studio die IP behalten, könnte es theoretisch mit Publisher B ein Rennspiel-Spin-Off machen, sofern der Vertrag mit A das nicht verbietet. A könnte sich aber verletzt fühlen, wenn B nun von den etablierten Figuren profitiert. Daher versuchen Publisher, diese Fälle vertraglich zu erfassen. Eine mögliche Klausel ist, dass während der Dauer des Vertrags und X Jahre danach kein Spiel mit den gleichen Charakteren/der gleichen Welt ohne Zustimmung von A veröffentlicht werden darf, egal in welchem Genre. Solche Einschränkungen sichern die Investition des Publishers ab.
Beispielklausel Spin-Off-Verbot: “Der Entwickler wird ohne Zustimmung des Publishers weder selbst noch durch Dritte ein Videospiel entwickeln oder veröffentlichen, das auf den gleichen Charakteren, Handlungen oder Spielwelten wie das vertragsgegenständliche Spiel basiert, sofern es sich nicht um Erweiterungen handelt, die diesem Vertrag unterfallen.” – Diese Formulierung würde Spin-Offs faktisch ausschließen, es sei denn, der Publisher genehmigt es (wahrscheinlich gegen Beteiligung oder als separater Vertrag).
Neben den IP- und Lizenzklauseln enthalten Publisherverträge eine Vielzahl weiterer Bedingungen, die indirekt Einfluss auf die Rechtekette haben:
Diese Beispiele zeigen, wie komplex und detailliert Publisherverträge gestrickt sein können, um alle Eventualitäten der Zusammenarbeit und Trennung abzudecken. Aus Sicht der Rechtekette ist das Ziel des Publishers, möglichst umfassende und exklusive Rechte zu sichern, während der Entwickler bestrebt sein wird, nicht mehr Rechte als nötig abzugeben und Absicherungen für den Fall von Problemen zu haben. Das deutsche Recht (UrhG und BGB) bildet den Rahmen – mit dem Zweckübertragungsgrundsatz immer im Hinterkopf: Unklare Formulierungen würde ein deutsches Gericht tendenziell zugunsten des Entwicklers/Urhebers auslegen. Deshalb ist Präzision hier im Interesse beider Seiten.
Neben der Entwicklungs- und Publishingphase ist ein weiterer Teil der Rechtekette die Vertriebs- bzw. Vertriebsvertragsebene. Unter Vertriebsverträgen verstehen wir hier Vereinbarungen, die der Distribution des fertigen Spiels an den Endkunden dienen. Während ein Publisher oft auch den Vertrieb organisiert, gibt es Konstellationen, in denen Entwicklung, Publishing und Vertrieb auf verschiedene Schultern verteilt sind. Beispielsweise kann ein Entwickler sein Spiel selbst veröffentlichen (kein externer Publisher), aber mit einer Plattform wie Steam oder einem physischen Distributor zusammenarbeiten. Oder ein Publisher nutzt für bestimmte Regionen lokale Distributor-Partner. Diese Vertriebsverträge beeinflussen, wie die Rechte am Spiel wirtschaftlich genutzt werden, auch wenn sie an der Inhaberschaft der Urheberrechte nichts mehr ändern (diese wurde zuvor festgelegt). Sie sind aber wichtig für die Rechteverwertung und Monetarisierung.
Heutzutage erfolgt ein Großteil des Spielevertriebs digital über Plattformen: PC-Spiele über Steam, Epic Games Store, GOG etc., Konsolenspiele über die Online-Stores von Sony, Microsoft, Nintendo, und Mobile Games über Apple App Store oder Google Play. In all diesen Fällen schließt der Rechteinhaber (sei es der Entwickler oder Publisher) einen Vertrag mit der Plattform ab. Meist handelt es sich um Standard-Distributor-Vereinbarungen oder AGB der Plattform, die wenig Verhandlungsspielraum lassen.
Rechteeinräumung an Plattformen: Der Inhaber des Spiels erteilt der Plattform eine Vertriebslizenz, die ihn berechtigt, das Spiel Endkunden anzubieten. Typischerweise behalten die Plattformen einen bestimmten Prozentsatz vom Umsatz (z.B. 30%) und überlassen die restlichen 70% dem Publisher/Entwickler. Diese Vereinbarungen enthalten Klauseln wie: “Der Publisher gewährt [Plattformname] das nicht-exklusive Recht, das Spiel [Titel] Endnutzern durch Download gegen Entgelt oder kostenlos zur Verfügung zu stellen und zu diesem Zweck Vervielfältigungen anzufertigen sowie das Spiel zu bewerben.”
Hier sieht man: Die Plattform erhält kein exklusives Recht – außer es wurde ein Exklusivdeal separat vereinbart (z.B. zeitliche PC-Exklusivität im Epic Store, was dann in einem separaten Vertrag geregelt wird). Im Standardfall kann der Publisher das Spiel parallel auch auf anderen Plattformen anbieten. Das Spiel verbleibt im Katalog der Plattform, bis eine Partei (oft der Publisher) es entfernt.
Vertragsbedingungen der Stores: Von rechtlicher Relevanz sind die Pflichten und Einschränkungen in solchen Plattformverträgen. Etwa verlangen alle großen Stores, dass der Publisher/Entwickler garantiert, alle Rechte am Spiel zu haben und dass kein rechtswidriger Inhalt enthalten ist. Sollte es doch Rechtsverstöße geben (z.B. Urheberrechtsverletzung oder beleidigendes Material), behalten sich die Plattformen vor, das Spiel offline zu nehmen (Stichwort Content Policy). Das passt zur Rechtekette: Ist irgendwo im Spiel ein Element nicht geklärt (z.B. ungeklärte Musiklizenz), könnte das Spiel aus dem Store fliegen.
Zudem haben Stores Review-Prozesse (gerade Konsolenhersteller prüfen genau, auch juristisch, bevor sie ein Spiel zulassen). Hier spielen Dinge wie Jugendschutz, Markenrechte (sind z.B. alle Markennamen in dem Spiel lizenziert?), Persönlichkeitsrechte (Avatare, reale Personen?) und eben Urheberrecht eine Rolle. Die Plattform will sicher sein, später nicht selbst wegen Beihilfe haften zu müssen. Im Apple/Google Bereich gibt es dazu gelegentlich Streit, ob sie mithaften – man denke an Apps, die gegen Patent oder Copyright verstoßen, hier gab es in den USA Klagen, aber in der Regel sehen sich Plattformen als bloße Vermittler.
Endnutzer-Lizenz (EULA): Im digitalen Vertrieb wird der Endkunde nie Eigentümer einer Kopie (wie früher bei einer physischen DVD), sondern erhält nur eine Nutzerlizenz. Meist wird beim ersten Start eines Spiels eine EULA (End User License Agreement) angezeigt, die der Spieler akzeptieren muss. Darin stehen Dinge wie: “Der Spieler erhält das einfache Recht, das Spiel für den persönlichen Gebrauch auf seinen Geräten zu installieren und zu nutzen. Er darf es nicht zurückentwickeln, nicht vervielfältigen außer für Installation, keine abgeleiteten Werke erstellen, nicht cheaten etc.” – Diese EULA stellt die letzte Stufe der Rechtekette dar: vom Publisher (als Rechteinhaber) zum Konsumenten (Lizenznehmer). Sie schränkt die Rechte des Nutzers stark ein, um das geistige Eigentum des Entwicklers/Publishers zu schützen (z.B. Verbot, Spielinhalte kommerziell zu nutzen, oder virtuelle Gegenstände zu verkaufen außerhalb der erlaubten Weisen).
Bei digitalen Verträgen können die Plattform-AGB vorschreiben, welche Mindestinhalte so eine EULA haben muss. Teilweise ist die EULA auch in den Plattform-AGB integriert (etwa Steam hat eine Abonnentenvereinbarung, die gegenüber Endnutzern… gegenüber Endnutzern integriert (z.B. Steam bindet die Zustimmung zu den Steam-Nutzungsbedingungen ein), in anderen Fällen stellt der Publisher eine eigene EULA bereit. In jedem Fall gilt für Endkunden: Sie erwerben keine Eigentumsrechte am Spiel oder an den digitalen Inhalten, sondern nur ein limitiertes Nutzungsrecht nach den Vorgaben des Rechteinhabers.
Neben dem digitalen Vertrieb bleibt der physische Verkauf von Spielen (auf Datenträgern wie Blu-ray, Modulen etc.) ein relevanter Markt – insbesondere für Konsolenspiele und Sammlereditionen. Hier kommen Retail- und Distributor-Verträge ins Spiel. Häufig schließt der Publisher einen Vertrag mit einem Vertriebsunternehmen ab, das auf Lagerhaltung, Logistik und Auslieferung an den Einzelhandel spezialisiert ist. Dieses Unternehmen fungiert entweder als Handelsvertreter (verkauft im Namen des Publishers gegen Provision) oder als Großhändler (kauft die Spiele vom Publisher zu einem Großhandelspreis und verkauft sie eigenständig weiter).
Aus IP-Sicht werden im Vertriebsvertrag dem Distributor einfache Nutzungsrechte zur Vervielfältigung (Pressen von Datenträgern) und zum Vertrieb eingeräumt – meist gebietsexklusiv. Zum Beispiel könnte ein Vertrag regeln, dass Distributor X das exklusive Recht hat, das Spiel in Deutschland, Österreich und der Schweiz im Handel zu vertreiben. Der Distributor verpflichtet sich im Gegenzug zu bestimmten Leistungen (Marketingunterstützung, Mindestabnahmemenge, Erreichen von Verkaufszielen) und zahlt entweder eine pauschale Abnahme oder laufend nach Verkäufen. Wichtig ist, dass solche Verträge keine darüber hinausgehenden Rechte gewähren: Der Distributor erhält nicht die IP am Spiel, sondern nur das begrenzte Vertriebsrecht. Üblicherweise enthält der Vertrag Klauseln, die nach Vertragsende alle Vertriebsrechte erlöschen lassen (bis auf Abverkauf von Restlagerbeständen). Die IP verbleibt beim Publisher.
Auswirkungen auf die Rechteverwertung: Exklusive Vertriebsverträge können die Verwertungsmöglichkeiten geografisch aufteilen. So kann es sein, dass in Region A ein anderer Publisher oder Distributor das Spiel vertreibt als in Region B. Diese Fragmentierung ist gewünscht, um lokale Expertise zu nutzen, erfordert aber sorgfältige Koordination der Rechtekette: Der Hauptrechteinhaber (oft der ursprüngliche Publisher) muss sicherstellen, dass alle lokalen Partner vertraglich gebunden sind und dieselben Einschränkungen beachten. Beispielsweise darf ein EU-Distributor seine Exemplare nicht einfach in den USA verkaufen, wenn dort ein anderer Partner die exklusiven Rechte hat – entsprechende Gebietsbeschränkungen und vielleicht Vertragsstrafen sorgen dafür. Allerdings greift hier auch das Kartellrecht: Im EU-Binnenmarkt sind absolute Gebietssperren problematisch; es muss gewissen Freihandelsspielraum geben (Stichwort Parallelimporte). Verträge müssen also so gestaltet sein, dass sie die Rechtekette schützen, aber nicht gegen Wettbewerbsrecht verstoßen.
Zudem sollten Vertriebsverträge Mindestleistungsanforderungen enthalten – etwa, dass der Distributor innerhalb bestimmter Zeit nach Release eine breite Auslieferung sicherstellt. Andernfalls könnte ein schwacher Vertriebspartner die Auswertung des Spiels behindern. Deshalb wird oft ein Kündigungs- oder Rückrufsrecht vereinbart: Liefert der Distributor nicht die vereinbarte Performance (z.B. erreicht er nicht den Mindestabsatz oder versäumt er Marketingzusagen), kann der Publisher den Vertrag beenden und die Vertriebsrechte zurückholen. Damit bleibt die Kontrolle über die Verwertungskette beim IP-Inhaber und das Spiel wird nicht durch Drittverschulden am Markt blockiert.
Ein besonderer Aspekt des Vertriebs sind Verträge mit Plattformbetreibern wie Sony, Nintendo oder Microsoft. Diese agieren teils als reine Store-Anbieter (für digitale Downloads), haben aber bei Konsolen eine Doppelrolle: Sie kontrollieren die Plattform (durch Hardware und Betriebssystem) und verlangen oft Lizenzgebühren pro Spiel. Ein Entwickler oder Publisher muss ein Spiel durch einen Plattform-Lizenzierungsprozess bringen (Stichwort “Certification”). Dafür ist ein Lizenzvertrag nötig, der dem Publisher gestattet, das Spiel auf der jeweiligen Konsole zu veröffentlichen. Hierbei werden Markenrechte der Plattform (Logos wie “Official Nintendo Seal” etc.) und technische Vorgaben einbezogen. Der Plattforminhaber erhält keine inhaltlichen Rechte am Spiel, aber er verlangt typischerweise:
Diese Verträge können auch Exklusivität behandeln: Zahlt z.B. Sony einen Betrag für zeitliche Exklusivität, wird der Publisher zusichern, das Spiel für einen Zeitraum nicht auf anderen Plattformen anzubieten. Solche Deals sind letztlich Marketing-Instrumente, aber sie haben juristische Form als Zusatzvereinbarung (z.B. „Timed Exclusive“ Klausel). Nach Ablauf kann der Publisher auf weiteren Plattformen veröffentlichen.
Zusammenfassend spielen Vertriebsverträge eine große Rolle in der praktischen Rechteausübung: Sie regeln, welcher Partner das Spiel zum Endkunden bringt, aber sie ändern nichts daran, wer Inhaber der Rechte ist – das bleibt stets der Entwickler/Publisher gemäß den vorgelagerten Verträgen. Eine saubere Gestaltung dieser Verträge stellt sicher, dass die Rechtekette bis zum Endverbraucher reicht: vom Urheber über Entwickler, Publisher, Distributor, Store bis hin zum Spieler, der schließlich eine einfache Nutzungslizenz erhält. Jede Bruchstelle – sei es ein fehlendes Recht in einem Gebiet oder eine vertragliche Lücke – kann die Monetarisierung gefährden.
Videospiele sind Teil eines größeren Medienökosystems. Erfolgreiche Games werden zu Filmen oder Serien adaptiert, und umgekehrt erscheinen viele Spiele, die auf bestehenden Film-, TV- oder Buch-Marken basieren. Diese Cross-Media-Verwertungen erfordern detaillierte Lizenzvereinbarungen, damit klar ist, wer welche Rechte an den jeweiligen Medieninhalten hält. Hier werden zwei Richtungen betrachtet:
Viele Videospiele verwenden die Welt, Charaktere und Story aus Filmen, TV-Serien, Comics oder literarischen Vorlagen. Bekannte Beispiele sind die zahlreichen Superhelden-Spiele (Batman, Spider-Man), Harry-Potter-Spiele, oder etwa Spiele zu Kinofilmen wie Jurassic Park oder Star Wars. In all diesen Fällen liegt die ursprüngliche IP (Intellectual Property) nicht beim Spielentwickler, sondern bei einem anderen Rechteinhaber (Filmstudio, Autor, Marke). Der Entwickler bzw. Publisher muss also vom ursprünglichen IP-Inhaber eine Lizenz erwerben, um daraus ein Spiel machen zu dürfen.
Lizenzverträge für Dritt-IP: Im Kern ist ein solches Spiel ein Merchandising-Produkt zur Original-IP. Der Lizenzvertrag räumt dem Spielepublisher bestimmte Nutzungsrechte an der IP ein, begrenzt auf das Medium “Videospiel”. Typische Merkmale solcher Verträge:
Aus Entwicklersicht sind solche Lizenztitel eine Herausforderung: Man hat weniger kreative Freiheit und muss rechtlich strikt die Lizenzbedingungen einhalten. Gleichzeitig bieten bekannte Marken einen Marktvorteil (bekanntes Franchise zieht Kunden an). Für die Rechtekette bedeutet es: Die finale Rechte-Inhaberschaft bleibt beim externen Lizenzgeber. Der Spielepublisher erwirbt eine temporäre, eingeschränkte Nutzungserlaubnis. Er kann somit am Ende nicht frei über „sein“ Spiel verfügen – die entscheidenden Fäden hält der Lizenzgeber in der Hand.
Beispiel Rechtsprechung: Wie wichtig klare Abgrenzungen sind, zeigt ein prominenter US-Fall: Der Verlag des Romans “Der Pate” (Mario Puzo) hatte in den 1970er-Jahren Paramount Pictures die Filmrechte eingeräumt. Jahrzehnte später lizenzierte Paramount die Herstellung eines “Der Pate”-Videospiels an EA. Die Erben von Mario Puzo klagten, weil Videospiele im ursprünglichen Vertrag nicht erwähnt waren – sie forderten Beteiligung an den Game-Einnahmen. Der Rechtsstreit endete 2012 in einem Vergleich, Paramount zahlte dem Puzo-Nachlass eine Entschädigung. Dieser Fall zeigt: Wurden neue Nutzungsarten (hier Computerspiele) nicht bedacht, kann der Urheber bzw. ursprüngliche Rechteinhaber noch Ansprüche erheben. Inzwischen werden daher in Lizenzverträgen möglichst alle denkbaren Medien abgedeckt, oder zumindest einzeln zugewiesen, um solche Konflikte zu vermeiden.
Der Fluss geht auch in die andere Richtung: Erfolgreiche Videospiele werden zu Filmen (z.B. Tomb Raider, Resident Evil, Uncharted), Serien (z.B. The Witcher, The Last of Us) oder Comics und Romanen adaptiert. Hier ist der Spieleentwickler bzw. Publisher der Lizenzgeber. Wenn ein Hollywood-Studio einen Film basierend auf einem Game machen will, benötigt es die Genehmigung und Mitwirkung des Game-IP-Inhabers.
Option und Verfilmungsvertrag: Üblicherweise beginnt es mit einer Option. Das Filmstudio schließt einen Optionsvertrag mit dem Spiel-Publisher ab, der ihm das exklusive Recht gibt, innerhalb einer bestimmten Zeit (z.B. 18 Monate) eine Verfilmung zu entwickeln. In dieser Zeit schreibt das Studio ein Drehbuch, sucht Regisseure, Finanzierung usw. Wenn das Projekt konkret wird, “löst das Studio die Option aus” und es kommt zum eigentlichen Verfilmungsvertrag. Dieser Vertrag regelt:
Ist die Verfilmung fertiggestellt, halten im Ergebnis beide Seiten Rechte: Der Filmproduzent hat das Urheberrecht am Filmwerk, der Game-Publisher bleibt Herr seiner ursprünglichen Spiele-IP. Oft entstehen allerdings neue Elemente in einer Verfilmung (neue Figuren, Ereignisse). Verträge regeln, wem diese gehören. Meist vereinbart man, dass solche neuen Elemente gemeinsam genutzt werden dürfen: Das Filmstudio darf sie in Filmen fortführen, und der Game-Publisher darf sie für künftige Spiele übernehmen. So profitieren beide vom Ausbau des Universums, ohne getrennte Rechteketten.
Cross-Promotion und Parallelverwertung: Bei Crossmedia-Projekten wird auch festgelegt, wie die gegenseitige Promotion abläuft. Beispielsweise könnte der Vertrag vorsehen, dass zum Filmstart der Publisher ein Movie-Tie-In-DLC im Spiel veröffentlicht, oder dass im Film auf das Spiel hingewiesen wird. Außerdem wichtig: Reihenfolge und Timing. Es gibt Fälle, in denen ein Film basierend auf einem unveröffentlichten Spiel produziert wird – dann braucht das Studio Sicherheiten, dass das Spiel tatsächlich erscheint (und die Marke bekannt wird). Umgekehrt will der Publisher, dass der Film rechtzeitig kommt, um die Spielverkäufe anzukurbeln. Solche Abhängigkeiten machen Crossmedia-Abkommen komplex.
Beispiel: The Witcher ist ein Spezialfall: Ursprünglich ein Roman, davon lizenziert CD Projekt RED die Spielrechte (behält aber keine Filmrechte). Später lizenziert der Autor die Serienrechte an Netflix – die erfolgreiche Serie basiert mehr auf den Romanen, dennoch profitieren die Spiele indirekt. Hätte CD Projekt die Filmrechte einst mit erworben, hätten sie an der Serie teilgehabt. Diese Konstellation zeigt: IP-Management über Mediengrenzen hinweg erfordert Weitblick. Heutzutage versuchen viele Game-Publisher, alle Crossmedia-Rechte an eigenen Marken inhouse zu halten – siehe z.B. Ubisoft, das ein eigenes Filmstudio gegründet hat, um Spiele wie Assassin’s Creed selbst zu verfilmen (und so Kontrolle zu behalten).
Zusammengefasst erfordert Cross-Media-Expansion sehr präzise Verträge. Beide Seiten – Games und Film/Musik – müssen definieren, wer die Hoheit über Figuren, Geschichten und Marken hat, um späteren Streit zu vermeiden. Werden hier sauber die Rechteketten verzahnt, kann eine Marke in vielen Medien erblühen, ohne dass unklare Rechte die Verwertung hemmen.
Die Games-, Musik- und Filmindustrie basieren gleichermaßen auf der Verwertung kreativer Inhalte. Es gibt daher viele Parallelen in den vertraglichen Strukturen – aber auch wesentliche Unterschiede, bedingt durch die Eigenarten der Werke und Marktusancen. Zum Abschluss ein Vergleich der Rechteketten und Vertragsstandards dieser drei Branchen:
Um die vertraglichen Parallelen zu veranschaulichen, einige vergleichende typische Klausel-Formulierungen aus allen drei Branchen:
Diese Beispiele zeigen, dass ähnliche Konzepte branchenübergreifend existieren, aber jeweils angepasst an das Medium sind. Die Musikbranche hat z.B. separate Verträge für Komposition und Aufnahme, während Game-Entwickler beides in einem abdecken müssen. Filmverträge legen starken Fokus auf Credits und künstlerische Aufgabenverteilung, Game-Verträge eher auf Lieferung von Meilensteinen und technische Abnahme.
Die Ausgangsfrage war: “Rechtekette im Game Development – wer hält am Ende die Rechte am Spiel?” Die Antwort lautet: Es kommt darauf an – und es sollte keinesfalls dem Zufall überlassen bleiben. Die Rechtekette in der Spieleentwicklung ist das Ergebnis zahlreicher vertraglicher Vereinbarungen. Im Idealfall sind diese so ausgestaltet, dass am Ende ein klar bestimmter Rechteinhaber alle notwendigen Verwertungsrechte am Spiel vereint hat und frei nutzen kann. In der Praxis kann das unterschiedlich aussehen:
Für Mandanten aus der Games-, Medien- und Musikbranche bedeutet dies: Rechtekette ist Chefsache. Jede Vereinbarung – ob mit Mitarbeitern, Dienstleistern, Publishern, Plattformen oder Lizenzgebern – beeinflusst, wer letztlich welches Stück vom Rechte-Puzzle hält. Ein Spiel ist wirtschaftlich nur dann voll ausschöpfbar, wenn die Kette lückenlos ist und klar definierte Eigentums- und Nutzungsverhältnisse bestehen. Das deutsche Urheberrecht gibt mit dem Zweckübertragungsgrundsatz eine Leitlinie: Rechte gehen nur so weit über, wie nötig. Daraus folgt für Verträge: Man muss bewusst und ausdrücklich regeln, was gebraucht wird. Es empfiehlt sich zudem, Szenarien der Zukunft mitzudenken: Neue Nutzungsarten (VR? Cloud-Gaming?), neue Märkte (Asien?), Crossmedia-Auswertungen – all das sollte nach Möglichkeit in die Verträge einfließen, um später kein böses Erwachen zu erleben.
Wer hält nun am Ende die Rechte am Spiel? In der Regel der Vertragspartner, der die Entwicklung finanziert oder initiiert hat, also häufig der Publisher oder das Studio selbst. Wichtig ist aber: Dieses Unternehmen hält nur dann wirklich “alle” Rechte, wenn es seinerseits alle Mitwirkenden eingebunden hat. Jede vergessene Zustimmung, jede nachlässige Klausel kann dazu führen, dass jemand anders ein Stück vom Kuchen beansprucht. Die beste Absicherung ist eine vorausschauende Vertragsgestaltung:
Die Game-Industrie hat in kurzer Zeit aufgeholt, was in Film und Musik über Jahrzehnte an Vertragskultur gewachsen ist. Heute sind Publishing- und Entwicklerverträge hochkomplex, aber auch chancenreich verhandelbar. Wer seine Rechtekette kennt und aktiv gestaltet, hält am Ende auch die Fäden in der Hand. So bleibt die Frage “Wer hält am Ende die Rechte am Spiel?” idealerweise nicht offen, sondern kann klar beantwortet werden: Derjenige, der sie vorausschauend vertraglich an sich gezogen hat – im Einklang mit den Urhebern und zum Nutzen aller Beteiligten.
Marian Härtel ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für IT-Recht mit einer über 25-jährigen Erfahrung als Unternehmer und Berater in den Bereichen Games, E-Sport, Blockchain, SaaS und Künstliche Intelligenz. Seine Beratungsschwerpunkte umfassen neben dem IT-Recht insbesondere das Urheberrecht, Medienrecht sowie Wettbewerbsrecht. Er betreut schwerpunktmäßig Start-ups, Agenturen und Influencer, die er in strategischen Fragen, komplexen Vertragsangelegenheiten sowie bei Investitionsprojekten begleitet. Dabei zeichnet sich seine Beratung durch einen interdisziplinären Ansatz aus, der juristische Expertise und langjährige unternehmerische Erfahrung miteinander verbindet. Ziel seiner Tätigkeit ist stets, Mandanten praxisorientierte Lösungen anzubieten und rechtlich fundierte Unterstützung bei der Umsetzung innovativer Geschäftsmodelle zu gewährleisten.
Wie schon angekündigt, wird dies ein spannendes Jahr. Ein Grund dafür ist, dass ich mich nach intensiven Gesprächen mit meiner...
Mehr lesenDetailsHomeoffice-Arbeitsplätze werden immer beliebter und werden aufgrund der Corona-Krise auch in der Bundesrepublik Deutschland zunehmen. Dabei gibt es jedoch zahlreiche...
Mehr lesenDetailsSoftwareentwickler sollten sich über eine weitere negative Folge der EU-Urheberrechtsreform Gedanken machen. Neben dem Auskunftsrecht wird nämlich ein Rückholanspruch diskutiert,...
Mehr lesenDetailsDer DOSB (Deutsche Olympische Sportbund) hat ein Rechtsgutachten zum Sportbegriff in Verbindung mit Esport erstellen lassen, welches zum Ergebnis kommt,...
Mehr lesenDetailsDas EuG stellte fest, dass McDonald’s für bestimmte Waren und Dienstleistungen keine ernsthafte Benutzung während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf...
Mehr lesenDetailsDie E-Sport-Branche erlebt zwar einen beispiellosen Aufschwung, doch mit dem rasanten Wachstum gehen auch zahlreiche Herausforderungen und Probleme einher. Ein...
Mehr lesenDetailsKI in der Software- und Spieleentwicklung: Potenzial und Fallstricke Die Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Software- und Spieleentwicklung...
Mehr lesenDetailsLetzten Endes gibt es keine Frage, dass man als Streamer, YouTuber oder sonstiger Influencer der Impressumspflicht nachkommen muss. In paar...
Mehr lesenDetailsMit Urteil vom 29. November 2019 hat die 8. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Düsseldorf entschieden, dass der Inhaber der...
Mehr lesenDetailsMit Urteil vom 27. Januar 2026 (KZR 10/25) hat der Kartellsenat des Bundesgerichtshofs eine Patentverletzungsklage aus standardessenziellen Patenten (SEP) bestätigt...
Mehr lesenDetails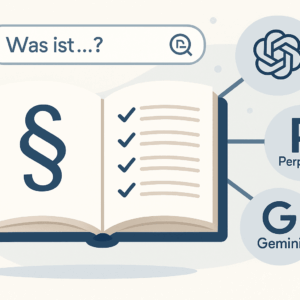 Von der Kanzlei zur KI-Quelle – LLM-SEO für Rechtsanwälte
9,99 €
Von der Kanzlei zur KI-Quelle – LLM-SEO für Rechtsanwälte
9,99 €inkl. MwSt.
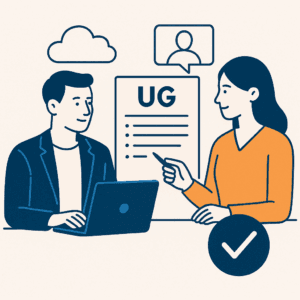 Mustersatzung für eine UG (haftungsbeschränkt)
0,00 €
Mustersatzung für eine UG (haftungsbeschränkt)
0,00 €inkl. MwSt.
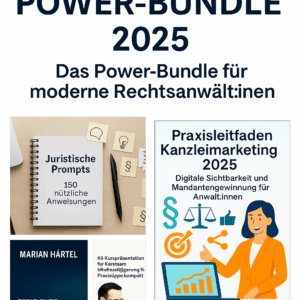 Kanzlei-Power-Bundle 2025: KI-Kompetenz & Sofort-Produktivität für Rechtsanwält:innen
99,99 €
Kanzlei-Power-Bundle 2025: KI-Kompetenz & Sofort-Produktivität für Rechtsanwält:innen
99,99 €inkl. MwSt.
 Videoberatung via Microsoft Teams 30 Minuten – Schnell, unkompliziert und fokussiert
163,63 €
Videoberatung via Microsoft Teams 30 Minuten – Schnell, unkompliziert und fokussiert
163,63 €inkl. MwSt.
 120 Minuten: Videoberatung via Microsoft Teams 120 Minuten – Ausführlich, vertieft und individuell
535,50 €
120 Minuten: Videoberatung via Microsoft Teams 120 Minuten – Ausführlich, vertieft und individuell
535,50 €inkl. MwSt.
In diese Episode wird die komplexe Beziehung zwischen dem 'Fail Fast'-Prinzip und den Verantwortlichkeiten der Gründer gegenüber Investoren und Mitarbeitern...
Mehr lesenDetailsIn diesem Video rede ich ein wenig über transparente Abrechnung und wie ich kommuniziere, was es kostet, wenn man mit...
Mehr lesenDetails
















