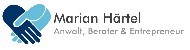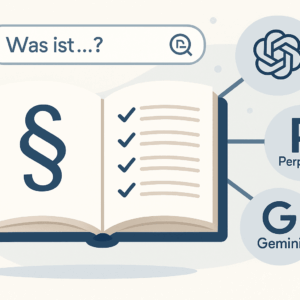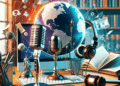Einführung: Geschäftsmodell von Influencer-Startups
Influencer-Startups haben sich in den letzten Jahren als eigenständiges Geschäftsmodell etabliert. Unter einem Influencer-Startup versteht man ein junges Unternehmen, das auf der Reichweite und Marke einer oder mehrerer Internetpersönlichkeiten – den Influencern – aufbaut und diese wirtschaftlich nutzt. Im Kern basiert das Modell darauf, dass die große Anhängerschaft (Follower) des Influencers in sozialen Medien in Umsatz umgewandelt wird, etwa durch Werbung, Produktplatzierungen oder den Verkauf eigener Produkte. Diese Startups verbinden also Elemente klassischer Medienunternehmen, Werbeagenturen und Personal-Brand-Management.
Die Ausrichtung eines Influencer-Startups kann vielfältig sein: Manche konzentrieren sich auf Content-Produktion (z.B. regelmäßige Videos, Blogbeiträge, Streams), andere auf E-Commerce (Merchandising, eigene Produktlinien) oder Plattform-übergreifende Vermarktung. Typisch ist jedoch, dass die Person des Influencers im Mittelpunkt steht – seine/ihre Persönlichkeit, Bekanntheit und Authentizität sind das Kapital des Unternehmens. Oft wird hierfür eine eigene Firma gegründet (z.B. eine GmbH oder UG in Deutschland), über die Verträge mit Werbepartnern, Agenturen und Plattformen abgewickelt werden. So lässt sich die persönliche Marke in eine unternehmerische Struktur gießen, die skalierbar und für Investoren interessant ist. Allerdings stellt dies das Startup vor besondere juristische Herausforderungen, weil die Marke eng an die Person gebunden ist (dazu unten mehr).
Ein Influencer-Startup muss interdisziplinär denken: Neben kreativem Content und Marketing müssen Rechtsfragen, wie Vertragsgestaltung, Compliance mit Werberecht, Datenschutz und Markenaufbau, von Anfang an berücksichtigt werden. Beispielsweise ist die Kennzeichnung von Werbung ein frühes Thema, da Verstöße hier Abmahnungen oder Bußgelder nach sich ziehen können. Auch die richtige Rechtsform und Struktur (etwa Gründung einer Kapitalgesellschaft, um persönliche Haftung zu begrenzen, und Aufsetzen klarer Verträge zwischen Influencer und der Firma) sind Bestandteil der strategischen Planung.
Zusammenfassend sind Influencer-Startups also Unternehmen, deren Geschäftsmodell auf der Kommerzialisierung der eigenen Reichweite in sozialen Medien beruht. Sie vereinen kreatives Schaffen mit professionellem Management der Personal Brand und erfordern ein ausgefeiltes rechtliches Fundament, um nachhaltig erfolgreich und rechtssicher agieren zu können. In den folgenden Abschnitten werden die einzelnen Aspekte – von der Definition der Personal Brand über Monetarisierungsmodelle bis hin zur Vertragsgestaltung und Investorenansprache – detailliert juristisch beleuchtet.
Personal Brands als Geschäftsmodell: Definition und rechtliche Einordnung
Der Begriff Personal Brand (Personenmarke) bezeichnet den Umstand, dass eine Person selbst – mit ihrer Identität, Reputation und öffentlichen Wahrnehmung – zur Marke wird. Im Kontext von Influencern bedeutet dies, dass nicht ein losgelöstes Produkt im Vordergrund steht, sondern die Persönlichkeit des Influencers das Aushängeschild und der Wertegarant des Unternehmens ist. Die Inhalte und Werte eines solchen Geschäftsmodells beruhen somit wesentlich auf der Präsenz und Authentizität einer einzelnen Person.
Rechtlich betrachtet ist eine Personal Brand ein immaterielles Gut, das verschiedene Schutzbereiche berührt: Zum einen das Namensrecht (§ 12 BGB), da meist der Name oder Künstlername des Influencers genutzt wird. § 12 BGB schützt den Namensträger vor unbefugter Nutzung oder Anmaßung seines Namens. Bei bekannten Influencern kann der Künstlername also wie ein Unternehmenskennzeichen wirken – Dritte dürfen ihn nicht ohne Weiteres im geschäftlichen Verkehr verwenden, wenn Verwechslungsgefahr besteht. Zum anderen greift das Markenrecht, falls der Influencer seinen Namen oder ein Logo als Marke registriert hat. Eine eingetragene Marke bietet umfassenden Schutz und exklusive Nutzungsrechte für bestimmte Waren/Dienstleistungen. Viele Influencer sichern ihren Künstlernamen durch Eintragung beim DPMA/EUIPO, um Nachahmern zuvorzukommen und ihre Personal Brand auszubauen.
Aus unternehmerischer Sicht wird die Personal Brand oft in eine juristische Person eingebracht. Beispielsweise gründen Influencer eine Einzelfirma oder Kapitalgesellschaft, an die sie bestimmte Verwertungsrechte übertragen. So können Verträge mit Werbepartnern etc. über die Firma abgewickelt werden, während der Influencer selbst als Aushängeschild fungiert. Wichtig ist die vertragliche Ausgestaltung: Der Influencer (als natürliche Person) und seine eigene Firma sollten klare Vereinbarungen treffen, etwa über die Nutzung von Bildnis, Name und Inhalten, um späteren Konflikten vorzubeugen. Hier spielen Lizenzverträge eine Rolle (siehe Abschnitt Vertragliche Gestaltung), mit denen die Personal Brand der Firma nutzbar gemacht wird.
Ein Aspekt der rechtlichen Einordnung ist auch, dass Personal Brands in der Werbung als solche kenntlich gemacht werden müssen. Wenn ein Influencer seine eigene Marke promotet (z.B. eigenes Modelabel), stellt sich die Frage, ob dies als Werbung gekennzeichnet werden muss. Laut Bundesgerichtshof handelt ein Influencer, der Produkte vorstellt und damit zugleich sein eigenes Image fördert, jedenfalls „geschäftlich“. Das bedeutet, auch Eigenwerbung kann Kennzeichnungspflichten auslösen, sofern eine kommerzielle Absicht dahintersteht. Die Gesetzeslage wurde 2022 mit dem neuen § 5a Abs.4 UWG (dem sogenannten „Influencer-Gesetz“) präzisiert: Keine Kennzeichnung ist erforderlich, wenn keine Gegenleistung eines fremden Unternehmens vorliegt. Allerdings hat der BGH klargestellt, dass reine Unentgeltlichkeit nicht ausreicht – wer seinen eigenen kommerziellen Zweck fördert, handelt ebenfalls geschäftlich. Das heißt: Die Personal Brand als Geschäftsmodell fällt unter das Werberecht, sobald sie zur Förderung eigener oder fremder Unternehmen eingesetzt wird.
Als Geschäftsmodell erfordert die Personal Brand einen bewussten Markenaufbau (Personal Branding). Werte, Botschaften und Wiedererkennbarkeit der Person werden strategisch entwickelt, ähnlich wie bei Produktmarken. Juristisch gilt es dabei, frühzeitig für Schutz zu sorgen: z.B. Domain-Sicherung, Markenanmeldung in relevanten Klassen (etwa Klasse 41 für Entertainment-Dienstleistungen, 35 für Merchandising), und Verträge mit Partnern, die die persönliche Marke nutzen (Lizenzbedingungen, klare Regelungen zu Inhalten und Grenzen der Nutzung). Die Personal Brand steht außerdem in enger Wechselwirkung mit Persönlichkeitsrechten – der Influencer als Person hat Rechte am eigenen Bild (§ 22 KUG) und an seiner Stimme/Biografie. Jede wirtschaftliche Verwertung dieser Elemente muss im Einklang mit den Persönlichkeitsrechten erfolgen, was besondere Sensibilität erfordert (siehe dazu Abschnitt 10 über moralische Spannungsfelder).
Insgesamt ist die Personal Brand juristisch ein hybrides Konstrukt: Sie ist gleichzeitig Marketingstrategie und Rechtsobjekt. Für Gründer bedeutet dies, dass sie ihre Person markenrechtlich und vertraglich so aufstellen müssen, dass daraus ein belastbares Geschäftsmodell wird, das sich vertraglich übertragen oder lizenzieren lässt, ohne die unveräußerlichen Persönlichkeitsrechte zu verletzen. Diese Gratwanderung prägt alle folgenden Themen – von Monetarisierung über Haftung bis hin zur Investorenansprache.
Monetarisierungsmodelle für Influencer und Personal Brands
Die Frage, wie Influencer konkret Geld verdienen, ist zentral für das Geschäftsmodell. Es haben sich verschiedene Monetarisierungsmodelle etabliert, die oft parallel genutzt werden:
a) Kooperationen und Sponsored Content: Die häufigste Einnahmequelle sind Kooperationen mit Unternehmen, bei denen der Influencer Produkte oder Dienstleistungen in seinen Posts, Videos oder Streams vorstellt. Hierbei erhalten Influencer entweder eine Pauschalvergütung oder werden erfolgsabhängig bezahlt (Affiliate-Links, Provisionen). Rechtlich handelt es sich um Werbeverträge oder Dienstleistungsverträge, die den Influencer zur Publikation von Inhalten gegen Entgelt verpflichten. Wichtig ist die klare Kennzeichnung als Werbung, um Schleichwerbung zu vermeiden. Nach deutschem Recht besteht eine Kennzeichnungspflicht, wenn der Influencer für die Produktnennung eine Gegenleistung erhält. Die Inhalte müssen so markiert sein, dass der Werbecharakter auf den ersten Blick erkennbar ist (z.B. „Anzeige“ oder die Plattform-Funktion „Bezahlte Partnerschaft mit…“ nutzen). Plattform-AGB unterstützen dies: Instagram etwa verbietet verschleierte Werbung und stellt Tools zur Verfügung, um Partner zu taggen】. Verträge über Sponsored Content sollten u.a. regeln: Inhalt und Frequenz der Posts, Freigabeschleifen, Laufzeit der Posts (wie lange online), Exklusivität (z.B. keine Konkurrenzprodukte bewerben während der Kampagne) und Haftungsfragen (wer haftet bei etwaigen Rechtsverstößen im Content).
b) Digitale Produkte und eigene Inhalte: Viele Influencer vermarkten eigene digitale Produkte. Beispiele sind E-Books, Online-Kurse, Presets/Filter, Musikstücke oder exklusive Communities (Telegram-Gruppen, Discord). Ein prominentes Modell ist auch der Verkauf von Abonnements für exklusive Inhalte über Plattformen wie Patreon, Steady oder OnlyFans. OnlyFans erlaubt es Creatorn, zahlenden Abonnenten gegen Monatsgebühr Zugriff auf exklusive Fotos/Videos zu geben – oft im Erwachsenenunterhaltungsbereich. Rechtlich sind hier Nutzungsverträge mit Endkunden relevant sowie die Plattformbedingungen. Influencer müssen bei direkten Verkäufen an Verbraucher die Verbraucherschutzvorschriften einhalten (Impressumspflicht, Widerrufsrecht bei digitalen Inhalten – wobei letzteres bei voll erfüllten digitalen Leistungen erlöschen kann, Art. 16 lit. m EU-Verbraucherrechterichtlinie). Bei OnlyFans & Co fungiert meist die Plattform als Vermittler: Der Influencer schließt einen Vertrag mit der Plattform, die wiederum die Abos abwickelt und Einnahmen anteilig auszahlt. Wichtig sind hier die Plattform-AGB bezüglich zulässiger Inhalte (z.B. OnlyFans verbietet explizit Inhalte mit Minderjährigen oder nicht-einvernehmliche Darstellungen) sowie Steuerfragen: Einnahmen sind steuerpflichtig; Plattformen wie OnlyFans sitzen oft im Ausland (UK), dennoch müssen deutsche Creator z.B. Umsatzsteuer beachten (ggf. Reverse-Charge oder Nutzung von Sonderregelungen für elektronische Dienstleistungen).
c) Merchandise und physische Produkte: Erfolgreiche Personal Brands weiten sich oft auf Merchandising aus – der Influencer bringt eigene Modekollektionen, Kosmetiklinien, Nahrungsergänzungsmittel oder andere Produkte heraus. Dies kann entweder eigenständig (Eigenmarke) oder in Kooperation mit Herstellern geschehen. Rechtlich braucht es hierfür meist Lizenzverträge: der Influencer stellt seinen Namen, Logo oder Slogan als Marke zur Verfügung, ein Hersteller produziert und vertreibt die Ware und zahlt Lizenzgebühren. Alternativ gründet der Influencer selbst eine Produktionsfirma oder einen Online-Shop und verkauft in eigenem Namen. Hier greifen dann umfangreiche pflichtrechtliche Vorgaben: Produkthaftung, Gewährleistung, Kennzeichnungspflichten (etwa Kosmetik-VO, Lebensmittelrecht falls Supplements), und wieder Verbraucherrechte im Online-Handel (Impressum nach § 5 DDG, DSGVO-Hinweise, Widerrufsrecht etc.). Ein Beispiel: Ein Fitness-Influencer verkauft eigene Proteinpulver – er muss dann als Inverkehrbringer die lebensmittelrechtliche Verantwortung tragen und sicherstellen, dass Werbung für das Produkt den Health-Claims-Vorgaben entspricht. Oft ist es daher gängig, dass Influencer mit bestehenden Unternehmen kooperieren (White-Label-Produkte), um diese Risiken auszulagern.
d) Live-Events und Auftritte: Manche Influencer monetarisieren ihre Marke durch Events – z.B. Meet-and-Greets, Touren, Konferenzen oder bezahlte Auftritte als Speaker/Moderator. Hier werden klassische Dienstverträge abgeschlossen: der Influencer tritt gegen Honorar auf. Zusätzlich können Ticketverkäufe direkt Erlöse generieren, falls der Influencer selbst Veranstalter ist. Vertragsrechtlich sind die Punkte Auftrittsbedingungen, mögliche Absagen (Krankheit etc.), Nutzungsrechte an Fotos/Videos vom Event und Haftungsfragen (z.B. bei Verletzung von Persönlichkeitsrechten des Influencers durch Fans oder umgekehrt) zu klären. Wenn Influencer in Fernsehshows oder Formaten mitwirken, schließen sie oft sogenannte Künstlerverträge, die auch Gagen und erlaubte Verwertungen regeln.
e) Plattform-Monetarisierung: Viele Social-Media-Plattformen bieten eigene Vergütungsmodelle. Beispiele: YouTube-Partnerprogramm (Anteil an Werbeeinnahmen vor Videos), TikTok Creator Fund, Twitch mit Abonnements und Bits (Trinkgeldern), Instagram Bonuses oder Facebook In-Stream Ads. Diese Einnahmen sind meist durch die Plattform-AGB definiert – Influencer stimmen zu, dass Plattformen Werbung schalten und zahlen einen festgelegten Anteil aus. Hier ist relevant, dass Influencer die Community-Richtlinien und Partnerbedingungen einhalten, da Verstöße (etwa Urheberrechtsverletzungen, Hassrede etc.) zur Demonetarisierung oder Sperrung führen können. Für das Geschäftsmodell ist diese Quelle oft volatil, da sie von Algorithmen und Plattformentscheidungen abhängt. Juristisch sind Streitigkeiten hier selten unmittelbar gerichtlich ausgetragen, da die Verträge Schiedsstellen (z.B. YouTube hat ein internes Beschwerdesystem) oder Gerichtsstände im Ausland vorsehen. Dennoch sind diese Einnahmen Teil der steuerlichen Bemessungsgrundlage und müssen vom Influencer-Startup verbucht/versteuert werden.
f) Premium- und Erwachsenen-Inhalte (OnlyFans, Patreon): Ein spezieller Bereich sind erotische bzw. sexuelle Inhalte auf Plattformen wie OnlyFans. Hier erzielen einige Influencer teils enorme Einnahmen durch freizügige Content-Angebote hinter Paywalls. Rechtlich gilt hier streng: es dürfen nur Erwachsene als Creator und Abonnenten teilnehmen; Plattformen verlangen Altersverifikationen. Inhalte, die pornografisch sind, können strafrechtliche Relevanz haben, wenn sie etwa gegen § 184 StGB (Verbreitung pornografischer Schriften) verstoßen – allerdings erlaubt § 184d StGB die Verbreitung an Erwachsene unter bestimmten Voraussetzungen. Influencer, die solche Inhalte anbieten, bewegen sich in einem rechtlich sensiblen Bereich, wo Jugendschutz und Persönlichkeitsschutz eine große Rolle spielen (siehe Abschnitt 10). Plattformen wie OnlyFans schreiben vor, dass alle erkennbaren Personen im Content zugestimmt haben und volljährig sind; bei Verstoß droht sofortige Sperre. Für das Startup stellt sich auch die Frage der Reputation: Investoren könnten zurückhaltend sein bei Geschäftsmodellen, die auf erotischen Inhalten basieren, aufgrund regulatorischer und moralischer Risiken. Gleichwohl ist es ein legitimes Monetarisierungsmodell, das hier nicht ausgeklammert werden darf.
Abschließend lässt sich festhalten, dass Influencer üblicherweise Mehrgleisig monetarisieren – etwa eine Mischung aus Werbung für Fremdprodukte und Aufbau eigener Produktlinien. Jede Einnahmequelle bringt spezifische Vertragsformen und rechtliche Vorgaben mit sich, die ein Influencer-Startup beachten muss. Die Kunst besteht darin, diese Modelle so zu kombinieren, dass rechtliche Konflikte vermieden werden – z.B. Exklusivitätsklauseln aus Werbeverträgen könnten kollidieren mit eigener Produktwerbung. Hier ist sorgfältiges Vertragsmanagement gefragt.
Rechtliche Verantwortung & Haftung im Influencer-Business
Influencer und ihre Startups bewegen sich rechtlich in einem komplexen Verantwortungsgeflecht. Zum einen tragen sie Verantwortung gegenüber Verbrauchern und der Öffentlichkeit (Compliance mit Gesetzen, keine Irreführung etc.), zum anderen haften sie gegenüber Geschäftspartnern für vertragliche Pflichten. Wichtige Aspekte der Haftung sind:
a) Anbieterkennzeichnung und Impressumspflicht: Influencer, die geschäftsmäßig Online-Auftritte betreiben, unterliegen der Impressumspflicht gemäß § 5 des neuen Digitale-Dienste-Gesetzes (DDG), das das Telemediengesetz abgelöst hat. Das bedeutet, jeder Social-Media-Kanal, der nicht rein privat ist, muss ein Impressum mit Name, Anschrift und Kontakt des Anbieters leicht erkennbar verfügbar machen. Viele Influencer nutzen Linktree oder Story-Highlights, um ihr Impressum zu verlinken. Ein Verstoß kann als Ordnungswidrigkeit geahndet werden und Abmahnungen nach sich ziehen. Das DDG setzt u.a. die EU-Vorgaben aus dem Digital Services Act (DSA) um und stärkt die Transparenzpflichten. Tipp: Influencer-Startups sollten frühzeitig klären, wer als Anbieter auftritt – oft ist es sinnvoll, dass die gegründete Firma im Impressum steht (statt die Privatperson), um Haftung auf die juristische Person zu konzentrieren.
b) Werbekennzeichnung und UWG: Wie in Abschnitt 3 erwähnt, müssen Influencer Werbung klar als solche kennzeichnen. Fehlt dies, drohen Abmahnungen von Mitbewerbern oder Verbänden wegen unlauteren Wettbewerbs (§§ 5a VI, 3 UWG) bzw. Verfahren der Medienaufsicht wegen Verschleierung. Die deutsche Medienanstalten stufen fehlende Kennzeichnung als Schleichwerbung ein, was nach dem Medienstaatsvertrag (MStV) unzulässig is. Seit den BGH-Urteilen vom September 2021 (Influencerinnen Fälle „Luisa-Maximilian“, „Flying Uwe“ etc.) ist klar: Sobald eine Gegenleistung vorliegt, ist Kennzeichnung Pflicht. Aber auch ohne Gegenleistung kann Kennzeichnung nötig sein, wenn der Beitrag objektiv werblich übertrieben ist. Influencer-Startups haften hier in zweierlei Hinsicht: Der Influencer selbst haftet für seine Posts (oft als Täter der Wettbewerbsverletzung), aber auch das Management oder die Agentur kann als Mitstörer oder Teilnehmer haftbar sein, wenn sie an der Veröffentlichung mitwirkt. Darum sind interne Guidelines unerlässlich, um jeden Post auf Rechtskonformität zu prüfen. Die neueren EU-Regeln (DSA) verlangen zusätzlich, dass Plattformen Tools bereitstellen, um bezahlte Posts zu markieren, und Nutzer illegale Inhalte melden können. Influencer müssen also mit strengeren Plattform-Prüfungen rechnen.
c) Strafrechtliche Risiken: Grundsätzlich gelten für Influencer keine anderen Strafgesetze als für andere Bürger – aber die öffentliche Tätigkeit birgt spezielle Gefahren. Denkbar sind etwa Fälle von Beleidigung oder Verleumdung (§§ 185 ff. StGB), wenn ein Influencer in einem „Diss-Track“ oder Video Dritte verunglimpft. Auch Jugendgefährdende Inhalte (§ 184 StGB ff. für Pornografie, § 130 StGB Volksverhetzung etc.) können relevant werden, gerade bei kontroversen Pranks oder politischem Content. Influencer haften persönlich für von ihnen begangene Straftaten; das Startup als Unternehmen kann ggf. nach dem OWiG mit Geldbußen oder nach dem Verbandsanktionengesetz (zukünftig) belangt werden, wenn Führungspersonen Straftaten im Unternehmensinteresse begehen. Auch Verstöße gegen das Kunsturhebergesetz (Veröffentlichung von Bildnissen ohne Einwilligung) oder Urheberrechtsverletzungen (z.B. Verwendung geschützter Musik ohne Lizenz) können Strafanzeigen nach sich ziehen. Ein Influencer-Startup muss daher Compliance-Regeln implementieren, um strafrechtliche Risiken zu minimieren – z.B. keine Verwendung urheberrechtlich geschützter Inhalte ohne Erlaubnis, sorgfältiger Umgang mit Äußerungen über Dritte, Jugendschutzfilter bei bestimmten Inhalten etc.
d) Plattformverantwortung und Haftung von Vermittlungsplattformen: Große Plattformen wie YouTube, Instagram oder TikTok haften nach dem DSA und der E-Commerce-Richtlinie (bislang) nicht für Nutzerinhalte, solange sie keine Kenntnis von Rechtsverstößen haben und nach Meldung zügig löschen (Notice-and-Takedown-Prinzip). Influencer selbst sind aber Content-Ersteller und somit unmittelbar verantwortlich für Rechtsverstöße in ihren Posts. Neu ist, dass der Digital Services Act Influencer als Unterstützer kommerzieller Kommunikation ebenfalls in die Pflicht nimmt: Sie müssen sicherstellen, dass ihre Inhalte nicht illegal oder irreführend sind. Plattformen müssen Meldemechanismen bereitstellen, über die etwa beleidigende oder rechtswidrige Influencer-Posts gemeldet werden können. Für Influencer-Startups bedeutet das, dass sie mit schnellerer Entfernung ihrer Inhalte rechnen müssen, wenn diese gegen Gesetze verstoßen – was wiederum zu Einnahmeverlust (Demonetarisierung) führen kann. Zugleich haben die Plattform-AGB meist Haftungsfreistellungen: Influencer müssen den Plattformbetreiber schadlos halten, falls dieser wegen der Influencer-Inhalte in Anspruch genommen wird. Das heißt, wenn z.B. ein Influencer-Video urheberrechtswidrig Musik nutzt und YouTube dafür haftet, könnte YouTube Regress beim Influencer nehmen. Diese vertraglichen Freistellungsklauseln der Plattform-AGB sollte man kennen und möglichst das Risiko durch Rechteklärung vor Veröffentlichung minimieren.
e) Haftung gegenüber Endverbrauchern: Eine interessante Frage ist, ob Influencer für Schäden der Follower haften, die aufgrund ihrer Empfehlungen entstehen. Beispiel: Ein Influencer bewirbt ein bestimmtes Finanzprodukt oder einen gesundheitsbezogenen Lifehack, und ein Follower erleidet Schaden. Grundsätzlich haftet der Influencer hier nicht wie ein Verkäufer oder Berater, da kein direkter Vertrag mit dem Follower besteht. Eine deliktische Haftung käme nur bei Verletzung absoluter Rechte in Betracht (Leben, Gesundheit, Eigentum) und Vorsatz oder Fahrlässigkeit. Etwa wenn falsche Gesundheitsversprechen gemacht werden, könnte eine deliktische Haftung wegen § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. dem Heilmittelwerbegesetz denkbar sein – aber in der Praxis sind solche Fälle selten. In Frankreich wurde allerdings 2023 geregelt, dass Influencer für bestimmte Branchen (z.B. Finanzprodukte, medizinische Eingriffe) strengen Werbebeschränkungen unterliegen. Verstöße können dort auch zivilrechtliche Folgen haben. In Deutschland könnte man an Haftung für irreführende Werbung nach UWG denken, die aber primär von Konkurrenten geltend gemacht wird, nicht von Verbrauchern direkt. Allerdings: Sollte ein Influencer sein eigenes Produkt bewerben (z.B. Kosmetik) und Verbraucher erleiden Schaden durch ein fehlerhaftes Produkt, haftet das Unternehmen des Influencers aus Produkthaftung und Gewährleistung. Ist der Influencer selbst Hersteller oder Importeur, kann er sogar nach dem Produkthaftungsgesetz verschuldensunabhängig haften.
f) Vertragliche Haftung gegenüber Partnern: Influencer-Startups schließen viele Verträge – mit Werbekunden, Agenturen, Plattformen, Dienstleistern. Die Erfüllung dieser Verträge begründet Haftungsrisiken bei Schlechtleistung oder Nichterfüllung. Beispiel: Ein Influencer verpflichtet sich in einem Werbevertrag, fünf Instagram-Posts zu machen, unterlässt dies aber oder postet verspätet. Der Vertragspartner kann Schadensersatz fordern oder Vertragsstrafen geltend machen, falls vereinbart. Daher sollten Verträge realistische Pflichten enthalten und ggf. Haftungsbegrenzungen (z.B. Beschränkung auf direkte Schäden, Ausschluss von Folgeschäden) um das Risiko zu mindern. Auch der Influencer will umgekehrt haftungsrechtlich abgesichert sein, falls z.B. das beworbene Produkt Mängel hat – oft verlangen Influencer eine Klausel, dass der Auftraggeber für die Rechtmäßigkeit der zur Verfügung gestellten Inhalte und Produktangaben einsteht und den Influencer von Ansprüchen Dritter freistellt. So kann verhindert werden, dass der Influencer für falsche Werbeaussagen des Herstellers haftet.
Zusammengefasst verlangt das Influencer-Geschäft eine Rundum-Compliance: Angefangen bei der Impressumspflicht über Werberecht bis zu Strafrecht und Vertragserfüllung müssen Influencer-Startups sicherstellen, dass sie ihrer Verantwortung gerecht werden. Es empfiehlt sich, interne Checklisten zu führen (Werden alle Posts korrekt gekennzeichnet? Liegt für jedes Musikstück eine Lizenz vor? Ist das Impressum aktuell? etc.) und sich im Zweifel rechtlich beraten zu lassen, um teure Haftungsfälle zu vermeiden.
Internationale Haftungsmodelle: Vergleich Deutschland, USA, UK, Madeira, VAE
Da Influencer global agieren, lohnt der Blick auf unterschiedliche Rechtsräume. Die rechtlichen Rahmenbedingungen für Influencer-Marketing und Haftung variieren teils erheblich:
Deutschland: Gilt als relativ streng reguliert in puncto Kennzeichnung und Medienrecht. Influencer fallen unter UWG und Medienstaatsvertrag, was klare Kennzeichnung erfordert und behördliche Aufsicht ermöglicht. Allerdings schützt die deutsche Rechtstradition auch die Meinungsfreiheit, weshalb reine Meinungsäußerungen keine Kennzeichnung brauchen, auch wenn sie positive Aussagen über Produkte enthalten – erst eine kommerzielle Absicht triggert die Kennzeichnungspflicht. Plattformen genießen (noch) Haftungsprivilegien ähnlich den USA (Stichwort: § 7 TMG a.F., nun DDG), aber der DSA bringt hier Angleichungen. Vertraglich sind in Deutschland Influencer oft als selbständige Dienstleister tätig; bei exklusiven Managementverträgen gelten Schranken (dazu Abschnitt 8).
USA: In den USA gibt es keine spezifischen Gesetze für Influencer-Werbung auf Bundesebene, aber die FTC (Federal Trade Commission) gibt Leitlinien heraus. Influencer müssen z.B. gemäß den FTC Endorsement Guides eindeutig offenlegen, wenn ein Post gesponsert ist (z.B. mittels #ad oder klarer Sprache). Die Durchsetzung erfolgt durch die FTC, die Strafen verhängen kann, aber auch durch Social-Media-Plattformen, die diese Regeln in ihre Standards aufnehmen. Eine wichtige Besonderheit: In den USA schützt Section 230 des Communications Decency Act Online-Plattformen weitgehend vor Haftung für User Generated Content. Das heißt, Influencer können Inhalte posten, ohne dass die Plattform haftet – es sei denn, es geht um Urheberrechte oder Bundesstraftaten. Influencer selbst können jedoch z.B. für falsche Werbeversprechen haftbar gemacht werden (es gab Fälle, in denen die FTC Influencer abmahnte, weil sie Schleichwerbung betrieben hatten). Anders als in Deutschland sind Abmahnungen durch Mitbewerber weniger zentral; es läuft mehr über Behörden und Sammelklagen. Auch gibt es in den USA keine Impressumspflicht, aber es empfiehlt sich aus Transparenzgründen oft dennoch Kontaktinfos bereitzustellen. Haftungsklagen von Konsumenten gegen Influencer wegen Empfehlungen (z.B. Fyre-Festival-Incident, wo Influencer ein letztlich betrügerisches Event beworben hatten) sind vorgekommen – hier könnte nach kalifornischem Recht etwa aus negligent misrepresentation gehaftet werden. Das US-Recht betont Eigenverantwortung der Konsumenten jedoch stärker, sodass solche Klagen Hürden haben. Für Verträge mit Influencern gilt US-typisch eine große Vertragsfreiheit, aber im Fall von Exklusivbindungen könnten Gerichte auf Unconscionability prüfen, ob eine Vereinbarung sittenwidrig ist.
UK (Vereinigtes Königreich): Ähnlich wie in Deutschland besteht Kennzeichnungspflicht, diese wird aber primär durch die Advertising Standards Authority (ASA) überwacht. Die ASA hat konkrete Guidelines, z.B. dass #ad oder #advert deutlich sein müssen und versteckte Werbung unzulässig ist. Verstöße führen zu öffentlichen Rügen und können an die Handelsaufsicht (CMA) weitergeleitet werden. 2021 wurde in UK eine Liste säumiger Influencer veröffentlicht, die mehrfach nicht korrekt gekennzeichnet hatten – ein eher prangerartiger Ansatz der ASA. Zudem sind Influencer in UK eventuell als “Media service providers” anzusehen, wenn sie signifikant Einkommen daraus erzielen, was Regulierung nach dem Ofcom-Broadcasting Code triggern kann. Vertraglich sind britische Influencer-Verträge dem Common Law unterworfen; restraint of trade-Grundsätze könnten überlange Exklusivbindungen kippen. Plattformen in UK haben nach Brexit eigene Anpassungen, aber im Wesentlichen ähnlich dem EU/US-Modell.
Madeira (Portugal): Madeira ist kein eigenes Land, sondern Teil Portugals mit Sondersteuerstatus. Für Influencer ist Madeira insbesondere wegen steuerlicher Vorteile bekannt (niedrige Einkommensteuer für Non-Habitual Residents und 5% Körperschaftsteuer in der Freihandelszone)】. Rechtlich gilt dort aber grundsätzlich portugiesisches/EU-Recht. Portugal hat die EU-Richtlinien zu unlauterem Wettbewerb umgesetzt, Influencer müssen auch hier Werbung kennzeichnen (die Regeln entsprechen der EU-weit harmonisierten Richtlinie 2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken). Die Aufsicht in Portugal ist jedoch weniger aktiv in einzelnen Influencer-Fällen als in DE/UK. Dennoch hat die portugiesische Lebensmittelbehörde etwa schon gegen Influencer ermittelt, die ungeprüfte Gesundheitsversprechen verbreiteten. Wer nach Madeira auswandert, genießt also steuerliche Vorteile, aber keine Haftungserleichterung: EU-Standards wie der DSA gelten trotzdem. Wichtig: Viele deutsche Influencer, die nach Madeira ziehen, behalten ihr deutsches Publikum. Damit bleiben sie faktisch auch dem deutschen Recht ausgesetzt – deutsche Gerichte könnten bei Verstößen die Anwendbarkeit deutschen UWG annehmen, wenn der Marktbezug zu Deutschland gegeben ist. Die Wahl Madeiras ändert jedoch die Gerichtsstands- und Vollstreckungsfragen: Kläger müssten eventuell im Ausland klagen oder Urteile dort vollstrecken, was Hemmnis sein kann. Kurz: Madeira bietet Steuerfreiheit, aber kein rechtsfreies Raum für influencer-spezifische Pflichten.
VAE (Vereinigte Arabische Emirate, insbesondere Dubai): Die Emirate haben eigene Regularien erlassen, um den Wildwuchs im Influencer-Marketing einzudämmen. Seit 2018 benötigen Influencer, die in den VAE ansässig sind und kommerziell posten, eine staatliche Lizenz der National Media Council (NMC). Diese E-Media-Lizenz kostet rund 15.000 AED pro Jahr (ca. 3.500–4.000 €) und soll Transparenz schaffen. Wer ohne Lizenz wirbt, riskiert Geldstrafen (min. 5.000 AED pro Verstoß). Außerdem untersagen die VAE bestimmte Inhalte und Werbungen aus moralischen Gründen: z.B. keine Werbung für Alkohol, Glücksspiel oder unsittliche Inhalte. Influencer müssen auch lokale Gesetze wie Blasphemieverbote und Scharia-Vorgaben respektieren – z.B. könnten freizügige Aufnahmen oder LGBTQ+-Inhalte rechtliche Probleme bringen. Plattformen sind in der Golfregion ebenfalls aktiv im Überwachen – in Abu Dhabi verlangt die Medienaufsicht separate Registrierung zusätzlich zur NMC-Lizenz. Haftungsrechtlich haften Influencer in den VAE nach Mediengesetzen und dem Strafrecht, das strikter ist (Beleidigungen online können z.B. zu Haftstrafen führen). Ein Influencer-Startup in Dubai muss also neben Business-Lizenz auch die spezielle Influencer-Lizenz organisieren. Positiv: Diese Regulierung schafft Rechtssicherheit und Professionalität, was auch Investoren ein Signal gibt, dass Influencer ein anerkanntes Geschäftsmodell sind – allerdings zum Preis von staatlicher Kontrolle.
Zusammenfassend zeigt der internationale Vergleich: Grundprinzipien (Werbekennzeichnung, Plattform-Haftungsprivileg) sind oft ähnlich, doch im Detail gibt es erhebliche Unterschiede in der Durchsetzung und zusätzlichen Pflichten. Frankreich z.B. hat 2023 sehr detaillierte Regeln zu verbotenen Promotions (Schönheits-OPs, bestimmte Finanzprodukte) erlassen, was Influencer dort enger bindet als in Deutschland. In den USA dagegen herrscht mehr Selbstregulierung mit behördlicher Nachkontrolle. Für Influencer-Startups, die international tätig sind, empfiehlt es sich, lokale Rechtsexpertise hinzuzuziehen, um etwa Kampagnen in UK, USA oder Middle East jeweils compliant aufzusetzen. Verträge mit Influencern sollten klauselweise prüfen, welches Recht anwendbar ist und ob der Influencer versichert, die lokalen Gesetze (Kennzeichnung usw.) einzuhalten. Im Zweifel kann man in Verträgen auch vorschreiben, dass der Influencer die jeweils strengsten anwendbaren Regeln befolgen muss, um globale Kampagnen risikofrei auszurollen.
Markenrechtliche Schutzstrategien für Influencer und Personal Brands
Eine starke Personal Brand bedarf eines soliden Markenschutzes, um Nachahmung und Trittbrettfahren vorzubeugen. Influencer sollten daher frühzeitig verschiedene Rechtsinstrumente nutzen:
a) Markenanmeldung des Namens oder Pseudonyms: Der Name des Influencers (bürgerlicher Name oder Künstlername) kann – soweit unterscheidungskräftig – als Marke geschützt werden. In Deutschland regelt § 3 Abs.1 MarkenG, dass alle Zeichen, einschließlich Personennamen, markenfähig sind, sofern sie zur Unterscheidung von Waren/Dienstleistungen geeignet sind. Viele Influencer lassen ihre Namen in relevanten Klassen eintragen (z.B. Klasse 41 für Unterhaltung/Dienstleistungen eines Entertainers, Klasse 35 für Werbung, Klasse 25 für Bekleidung bei Merch). Die Eintragung verschafft das ausschließliche Nutzungsrecht für die geschützten Klassen. Das bedeutet, Dritte dürfen den Namen nicht für gleichartige Waren/Dienstleistungen verwenden, ohne Lizenz. Wichtig: Bei sehr generischen Pseudonymen kann die Eintragung an fehlender Unterscheidungskraft scheitern. Auch Marken, die nur beschreibend sind oder gegen die guten Sitten verstoßen, werden zurückgewiesen (§ 8 MarkenG). Eine gründliche Markenrecherche vorab ist unerlässlich, um Kollisionen mit älteren Marken zu vermeiden. Falls der Influencer international tätig ist, bietet sich eine EU-Marke (Schutz in allen EU-Staaten über EUIPO) oder sogar eine internationale Registrierung via WIPO an. Beispielsweise hat die Influencerin „Pamela Reif“ ihren Namen als Unionsmarke registriert, um europaweit geschützt zu sein. Der Markenschutz erlaubt es dem Influencer-Startup, gegen Trittbrettprodukte (z.B. fremde Fan-Merchandise mit dem Namen/Bild des Influencers) mit Abmahnung und Unterlassung vorzugehen. Außerdem kann die Marke lizenziert werden – ein Investor oder Partner könnte eine Markenlizenz erhalten, um den Namen auf Produkten zu nutzen, was zusätzliche Einnahmen bringt.
b) Schutz des Logos/Slogans: Viele Personal Brands nutzen ein Logo, ein Kürzel oder einen Spruch (z.B. einen charakteristischen Hashtag oder Gruß). Diese können ebenfalls markenrechtlich geschützt werden. Logos als Bildmarke oder Wort-Bild-Marke, Slogans als Wortmarke sofern originell genug. Beispiel: Der YouTuber „Unge“ hat sein Affen-Logo markenrechtlich schützen lassen, um es exklusiv auf Merchandise einsetzen zu können. Slogans müssen unterscheidungskräftig sein und nicht nur beschreibend. Gelingt die Eintragung, gelten dieselben Rechte: Verbietungsrechte gegenüber Dritten und positive Verwertung durch Lizenzen.
c) Namensrecht (§ 12 BGB): Unabhängig vom Markenrecht besteht für den bürgerlichen Namen und etablierte Künstlernamen das Namensrecht. § 12 BGB bietet Schutz vor unbefugtem Gebrauch des Namens, insbesondere bei Namensanmaßung (wenn sich jemand unbefugt den gleichen Namen im geschäftlichen Verkehr anmaßt und dadurch Zuordnungsverwirrung entsteht). Das Namensrecht greift auch, wenn z.B. kein Markenschutz besteht oder möglich ist (etwa weil der Name nicht als Marke eingetragen wurde). Wenn ein Dritter den Namen des Influencers für ähnliche Angebote nutzt und Verwechslungen provoziert, kann der Influencer Unterlassung nach § 12 BGB fordern. Allerdings ist der Namensschutz begrenzt: Er gilt primär gegen namensmäßigen Gebrauch, nicht gegen alle Formen der Nutzung. Zudem müssen berühmtere Namen bereits Verkehrsgeltung haben, damit § 12 greift (bei völlig unbekannten Namen droht keine Verwechslungsgefahr, daher kein Unterlassungsanspruch). Für eingeführte Personal Brands ist § 12 jedoch eine wichtige Ergänzung, z.B. wenn jemand Domainnamen mit dem Influencernamen registriert in Absicht, Nutzer abzufangen – hier kann man nach § 12 vorgehen (BGH „ruhrgebiet.de“-Rechtsprechung). Praxis-Tipp: Influencer sollten sich auch die wichtigsten Domains („.de“, „.com“ etc. mit ihrem Künstlernamen) sichern, um Cybersquatting zu verhindern.
d) Urheber- und Leistungsschutzrechte: Zwar ist die Marke das primäre Schutzrecht für den Namen, doch auch im Content selbst stecken Schutzrechte. Fotos von Influencern unterliegen dem Urheberrecht des Fotografen, aber der Influencer hat idR ein Mitspracherecht durch Verträge (Model-Release) und kann Persönlichkeitsrechte am eigenen Bild geltend machen. Selbst erstellte Bilder/Videos von Influencern können als Lichtbildwerke (§ 2 Abs.1 Nr.5 UrhG) oder zumindest Lichtbilder (§ 72 UrhG) geschützt sein. Das bedeutet, wenn jemand ungefragt die Fotos eines Influencers kommerziell nutzt (z.B. um für eigene Zwecke zu werben mit dem Bild des Influencers), verletzt er Urheberrechte und ggf. das Recht am Bild. Influencer-Startups sollten sich dieser Rechte bewusst sein und bei Verletzungen konsequent dagegen vorgehen – oft via anwaltliche Abmahnung mit Bezug auf §§ 97 UrhG (Unterlassung, Schadenersatz) und 22 KUG (Veröffentlichung ohne Einwilligung). Markenrechtlich lassen sich bestimmte ikonische Bildnisse auch als Bildmarke schützen, aber das ist selten (man könnte theoretisch ein prägnantes Porträt als Marke anmelden, aber praktisch wird eher der Name/Logo geschützt).
e) Merchandise und Produktdesigns: Wenn Influencer eigene Produkte designen (z.B. Mode), kann Designrecht (Geschmacksmuster) relevant werden. Ein markantes Logo auf Kleidung ist durch die Wort-/Bildmarke geschützt; das Kleidungsdesign an sich könnte als eingetragenes Design gesichert werden, wenn es neu und eigenartig ist. In der Praxis stützen sich Influencer hier meist auf die Marke und das Urheberrecht an Grafiken/Motiven.
f) Verteidigung der Marke und Durchsetzung: Schutzstrategie heißt nicht nur registrieren, sondern auch durchsetzen. Influencer-Startups sollten eine Überwachungsstrategie fahren – z.B. Markenüberwachung einrichten, ob jemand ähnliches anmeldet, oder auf Online-Marktplätzen schauen, ob unlizenzierte Fanartikel auftauchen. Gegen Markenverletzer stehen dem Markeninhaber Ansprüche auf Unterlassung, Auskunft und Schadenersatz zu (§§ 14, 19 MarkenG). Oft wird zunächst abgemahnt. Beispiel: Der Influencer „Dagi Bee“ ging erfolgreich gegen einen Onlineshop vor, der unter ihrem Namen Kosmetik anbot, ohne Berechtigung. Achtung: Hat der Influencer-Name auch beschreibende Bedeutungen oder Doppelbedeutungen, muss man Differenzieren. Wenn jemand z.B. „Apple“ heißt und als Influencer bekannt ist, kann er trotzdem nicht verhindern, dass das Wort im allgemeinen Sprachgebrauch genutzt wird. Der Schutz bezieht sich immer auf Nutzung als Kennzeichen im geschäftlichen Verkehr in einer Weise, die Herkunftstäuschung verursacht.
g) Schutz im Ausland: Personal Brands sind oft global aktiv. Markenschutz ist territorial – eine deutsche Marke wirkt nur in Deutschland. Für EU-weite Präsenz ist die Unionsmarke sinnvoll (Eintragung beim EUIPO, Schutz in allen EU-Mitgliedstaaten). Kostenmäßig ist das effizienter als viele einzelne Marken. Für darüber hinaus (USA, Asien etc.) kann via WIPO eine internationale Registrierung erfolgen, die auf nationalen Marken basiert. Influencer, die etwa einen großen US-Fanbase haben, sollten überlegen, ihren Namen auch in den USA als Marke anzumelden (beim USPTO), um sich dort vor Trittbrettfahrern zu schützen. Unterschied: In den USA sind Trademark Rechte oft an tatsächlichen Gebrauch geknüpft (Use-Prinzip), während Europa Eintragungssysteme hat. Es kann also nötig sein, in den USA den Namen auch tatsächlich in commerce zu nutzen, um voll durchsetzbare Markenrechte zu haben.
h) Social Media Accounts: Ein eigenwilliger Aspekt: Die Handles/Nutzernamen in sozialen Medien. Sie sind zwar nicht im klassischen Sinne „geschützt“, aber fallen unter AGB der Plattformen. Z.B. verbieten Instagram und TikTok den Handel mit Accounts oder Usernames. Wenn jemand einen ähnlich klingenden Accountnamen anlegt, der Verwechslung stiftet, kann man oft über Plattform-Melden vorgehen (Impersonation-Vorwurf). Einige Influencer konnten so erreichen, dass Fake-Accounts mit ihrem Namen gelöscht wurden. Rechtlich kann man hier § 12 BGB analog anführen, aber meist ist der pragmatische Weg über die Plattform schneller.
Markenrechtliche Strategien sind also ein Muss für jedes Influencer-Startup: Die Personal Brand sollte wie ein wertvolles Asset betrachtet werden, das aktiv gemanagt, geschützt und lizenziert werden kann. Kombination aus Marken, Namen und Vertragsrechten sorgt dafür, dass die wirtschaftliche Ausnutzung durch das Startup exklusiv bleibt und nicht durch Dritte verwässert wird.
Vertragliche Gestaltung: Managementverträge, Reichweitenverwertung, Sunset-Klauseln, Buy-out vs. Lizenzmodell
Das Herzstück eines Influencer-Startups ist oft der Vertrag zwischen dem Influencer (als Person) und dem Management bzw. der eigenen Firma. Hier wird geregelt, wie die Reichweite und Persönlichkeitsrechte des Influencers kommerziell genutzt werden dürfen. Wichtige Vertragstypen und Klauseln sind:
a) Influencer-Managementvertrag: Dies ist vergleichbar mit einem Künstler-Manager-Vertrag aus der Entertainmentbranche. Der Influencer verpflichtet sich, für einen bestimmten Zeitraum mit dem Manager/der Agentur exklusiv zusammenzuarbeiten. Der Manager übernimmt dafür Leistungen wie Akquise von Werbedeals, Organisation, PR etc. Typischerweise erhält der Manager eine Umsatzbeteiligung an den vom Influencer erzielten Einnahmen (z.B. 20%). Wichtige Punkte:
Exklusivität: Meist wird vereinbart, dass der Influencer keine anderen Agenten einschaltet und alle Anfragen an den Manager verweist. Achtung: Eine zu weitgehende Exklusivbindung kann problematisch sein (siehe Künstlerbindung in Abschnitt 8).
Laufzeit: Häufig befristet (z.B. 2 Jahre) mit Verlängerungsoption oder auch unbefristet mit Kündigungsfrist. BGB § 627 ist hier relevant: Bei Dienstverträgen „höherer Art“ (die auf persönlichem Vertrauensverhältnis beruhen) kann der Dienstverpflichtete jederzeit kündigen. Ein Influencer-Managementvertrag könnte darunter fallen, was dem Influencer ein gesetzliches Kündigungsrecht jederzeit gäbe. Deshalb versuchen Agenturen oft, § 627 BGB vertraglich abzubedingen. Allerdings ist umstritten, ob das bei echten Vertrauensdiensten wirksam ist – viele Juristen meinen, § 627 sei zwingend für Dienste, die persönlich und vertrauensvoll sind. Die Agentur will jedoch Planungssicherheit, daher werden häufig feste Laufzeiten und Vertragsstrafen bei vorzeitigem Ausstieg vereinbart (dazu Severance-Klauseln weiter unten).
Leistungen: Der Vertrag sollte genau umreißen, was der Manager tut (Vertragsverhandlungen, Markenaufbau, Terminplanung etc.) und was der Influencer liefern muss (regelmäßiger Content, Abstimmung mit Manager vor größeren Entscheidungen etc.). Oft ist auch geregelt, dass der Manager im Namen des Influencers handeln darf (Vollmacht/Vermittlungsvollmacht).
Vergütung: Üblich ist prozentuale Beteiligung. Nettoumsätze aus Kooperationen, Kampagnen etc. werden geteilt. Wichtig: Definition der Bemessungsgrundlage (inkl/exkl. Umsatzsteuer, Abzug von Kosten?) und Fälligkeit (z.B. sobald der Kunde zahlt, anteilig an Manager weiter).
Kündigung und Nachwirkungen: Hier kommen Sunset-Klauseln ins Spiel.
b) Sunset-Klauseln (nachvertragliche Einnahmenbeteiligung): Eine Sunset-Klausel regelt, dass der Manager auch nach Vertragsende noch an bestimmten vom Influencer erzielten Einnahmen beteiligt wird. Hintergrund: Der Manager hat während der Vertragslaufzeit Deals angebahnt, die erst später voll realisiert werden. Z.B. verhandelt die Agentur einen lukrativen Werbevertrag kurz vor Vertragsende; der Influencer kündigt den Managementvertrag und schließt den Deal danach direkt ab, um die Provision zu sparen. Um so etwas zu verhindern, vereinbaren Manager Sunset-Klauseln, etwa: Für alle Verträge, die während der Laufzeit angebahnt oder abgeschlossen wurden, erhält der Manager auch nach Kündigung für X Zeit eine Beteiligung. Übliche Gestaltungen sind z.B. 1 Jahr 100% der ursprünglichen Provision, 1 weiteres Jahr 50%, danach keine Beteiligung mehr. Wichtig ist, dass solche Klauseln angemessen begrenzt sind in Höhe und Dauer, sonst droht Unwirksamkeit wegen Sittenwidrigkeit (§ 138 BGB) oder als unangemessene Benachteiligung nach AGB-Recht. Die Rechtsprechung (z.B. LG Potsdam, Urt. v. 2.6.2021 – 2 O 101/20) hat eine Sunset-Regel, die 100% für 1 Jahr und 60% für 2 weitere Jahre vorsah, als sittenwidrig verworfen, da sie die berufliche Freiheit des Influencers übermäßig beschneide. Als Faustregel nennt die Literatur max. 25% Provision für 1–2 Jahre post-contract. Außerdem dürfen nur die konkret vermittelten Geschäfte erfasst sein, nicht sämtliche künftigen Einnahmen des Influencers. Transparenz ist wichtig: Die Klausel muss klar erkennen lassen, welche Einnahmen erfasst sind. In individueller Verhandlung sind strengere Regeln etwas eher haltbar als in vorformulierten Verträgen (Stichwort AGB-Kontrolle). Insgesamt dienen Sunset-Klauseln dazu, das Investitionsrisiko des Managements abzusichern, müssen aber fair austariert werden, um Bestand zu haben.
c) Vertragsstrafen und Severance (Abfindungs-)Klauseln: Ein heikles Thema ist, wie man den Influencer davon abhält, den Vertrag vorzeitig zu verlassen, um z.B. ohne Provision zu einem anderen Manager zu wechseln. Einige Verträge enthalten Vertragsstrafen für den Fall vertragswidriger vorzeitiger Beendigung. Alternativ oder zusätzlich gibt es Severance-Klauseln (Abfindungsklauseln): Diese definieren eine Zahlung, die der Influencer leisten muss, wenn er vor Vertragsablauf kündigt. Das Konzept ähnelt dem Ausgleichsanspruch beim Handelsvertreter (§ 89b HGB), nur umgekehrt – hier zahlt der „Vertretene“ (Influencer) dem Agenten. Zulässig sind solche Regelungen grundsätzlich, aber unter Schranken: Sie dürfen nicht exzessiv hoch sein und müssen transparent sein. Wenn der Vertrag als AGB einzustufen ist, greift § 307 BGB (Verbot unangemessener Benachteiligung). Eine überzogene Pauschale könnte als Vertragsstrafe gewertet und ggf. gemildert werden (§ 343 BGB) oder komplett unwirksam sein. Daher: Moderate Beträge oder degressive Struktur (z.B. Abfindung sinkt mit fortschreitender Vertragsdauer). Auch sollte klar sein, dass keine Abfindung geschuldet ist, wenn wichtiger Grund für Kündigung vorlag (z.B. Managerpflichtverletzung). Solche Klauseln sind eine Absicherung fürs Management, aber zugleich eine Einschränkung der Berufsfreiheit des Influencers – im Zweifel neigen Gerichte eher dazu, den Influencer zu schützen (wie bei Künstlerverträgen üblich, siehe Abschnitt 8). Deshalb müssen Severance-Klauseln wohlüberlegt und juristisch sauber formuliert werden.
d) Reichweitenverwertung und Lizenzmodelle: Unter Reichweitenverwertung versteht man alle Maßnahmen, wie die Followerschaft des Influencers in Umsatz umgewandelt wird. Vertraglich kann dies über Lizenzverträge geschehen. Z.B. könnte der Influencer seiner eigenen Firma oder einer Agentur das Recht lizenzieren, in seinem Namen Kooperationen abzuschließen, seinen Content weiterzuverwenden, Merch mit seinem Namen zu verkaufen etc. Ein Lizenzmodell hat den Vorteil, dass der Influencer Inhaber seiner immateriellen Güter bleibt (Name, Marke, Inhalte) und nur Nutzungsrechte einräumt. Dafür erhält er entweder Lizenzgebühren oder Anteile am Umsatz. Im Gegensatz dazu wäre ein Buy-out-Modell, dass der Influencer bestimmte Rechte vollständig verkauft oder überträgt. Ein extremes Beispiel: Ein Influencer verkauft seine gesamte Marke (Name, Social-Media-Accounts, Inhalte) an ein Unternehmen, das diese dann eigenständig fortführt. Solche Buy-outs sind selten, da die persönliche Mitwirkung des Influencers meist untrennbar ist. In der Praxis gibt es aber Fälle, wo Influencer sich von ihrem eigenen Unternehmen trennen – etwa wenn ein Influencer-Startup mit mehreren Talents verkauft wird, inklusive der Verträge mit diesen Talents. Hier muss im Vorfeld vertraglich geklärt sein, ob die Verträge überhaupt übertragbar sind (oft haben sie persönliche Dienste zum Inhalt, die nicht ohne Zustimmung übertragbar sind, § 613 BGB analog). Lizenzmodelle sind flexibler: z.B. der Influencer lizenziert seiner eigenen GmbH die Nutzungsrechte an seinen Inhalten und seinem Namen, damit die GmbH diese wirtschaftlich verwerten kann. Investoren investieren dann in die GmbH (nicht direkt in die Person), was die Investition rechtlich greifbarer macht. Allerdings sollte die Lizenz exklusiv, langfristig und am besten unwiderruflich (zumindest für eine bestimmte Dauer) sein, damit Investoren Planungssicherheit haben. Hier kann man wiederum mit vertragsstrafenbewehrtem Unterlassungsanspruch arbeiten, falls der Influencer die Exklusivität bricht.
e) Vergütungsmodelle: Umsatzbeteiligung vs. Festgehalt: In manchen Konstellationen (etwa wenn Influencer und Startup faktisch identisch sind) zahlt sich der Influencer evtl. ein Gehalt oder Geschäftsführerlohn aus. Das hat arbeits- und steuerrechtliche Implikationen (siehe Abschnitt 9 Scheinselbstständigkeit). Üblicher bleiben erfolgsabhängige Modelle: Der Influencer bekommt Ausschüttungen oder Dividenden, weil er Anteilseigner der Firma ist, während das operative Geschäft alle Einnahmen einsammelt. Oder er bleibt externer Dienstleister auf Provisionsbasis. Hier gilt es, steuerlich optimal zu gestalten (u.U. Kombination: ein Teil Gehalt für soziale Absicherung, ein Teil Tantieme). Für Verträge mit externen Dienstleistern (z.B. weitere Teammitglieder, Ghostwriter, Fotografen) sollte klar geregelt sein, wem die Rechte an erstellten Inhalten zustehen – meist dem Startup, mit zeitlich unbegrenzter Nutzung, damit der Influencer-Content konsistent verwertbar bleibt, auch wenn einzelne Teammitglieder gehen.
f) Weitere Vertragsklauseln: Erwähnenswert sind noch Non-Compete-Klauseln und Non-Solicitation-Klauseln. Erstere könnten dem Influencer untersagen, während der Vertragslaufzeit (und begrenzt danach) mit Konkurrenzagenturen oder Konkurrenzprodukten zusammenzuarbeiten. Solche Wettbewerbsverbote nach Vertragsende unterliegen jedoch § 74a HGB analog (für freie Handelsvertreter und wohl auch Künstler analog) – mehr als 2 Jahre sind unwirksam, und es muss eine Karenzentschädigung gezahlt werden, will man ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot durchsetzen. Viele Influencer-Verträge verzichten darauf, da dies schwer durchsetzbar ist. Non-Solicitation-Klauseln können festlegen, dass der Influencer nicht versucht, Kunden/Kooperationspartner des Managers abzuwerben oder umgekehrt der Manager keine anderen Talents abwirbt – dies ist moderater und eher zulässig, solange zeitlich begrenzt.
Zusammengefasst kommt es bei der Vertragsgestaltung darauf an, ein Gleichgewicht zu finden: Der Influencer soll einerseits vertraglich gebunden und planbar gemacht werden (für das Startup/Investoren), andererseits dürfen die Verträge nicht so einseitig sein, dass sie vor Gericht scheitern oder das Vertrauensverhältnis vergiften. Klare, faire Regeln zu Vergütung, Pflichten und Beendigung sind entscheidend. Sunset- und Exit-Klauseln müssen sorgfältig formuliert und angemessen begrenzt sein. Ideal ist, wenn die Vereinbarungen individuell ausgehandelt sind, was AGB-Probleme umgeht. Hier sollte im Zweifel spezialisierter Rechtsrat eingeholt werden, da dieser Vertragskomplex das Fundament des Influencer-Startups bildet.
Künstlerbindung in der Rechtsprechung: BGH „Heintje“, OGH „Kiesbauer“ und Co.
Die Bindung von Künstlern (und hierzu zählen wir Influencer als moderne „Internet-Künstler“) durch langfristige Verträge ist seit jeher Gegenstand gerichtlicher Beurteilung. Zwei oft zitierte Fälle sollen exemplarisch genannt werden:
BGH „Heintje“: Dieser Klassiker betraf den Kinderstar Heintje (Hendrik Simons), der Ende der 1960er als Sänger berühmt wurde. Seine Eltern bzw. Vertreter hatten sehr langfristige Exklusivverträge mit einem Management/Plattenlabel abgeschlossen. Der Fall landete vor deutschen Gerichten, wo es um die Frage ging, inwieweit ein solcher Vertrag einen Minderjährigen unzulässig binden kann. Die genaue Fundstelle ist OLG Hamburg 3 U 21/69 („Heintje“), zitiert in GRUR 1970, 38. Das OLG entschied sinngemäß, dass Verträge mit minderjährigen Künstlern besonders strengen Maßstäben unterliegen. Eine jahrelange Exklusivbindung, die faktisch die gesamte Entwicklungsmöglichkeit des jungen Künstlers in die Hände eines Vertragspartners legt, wurde als sittenwidrig (§ 138 BGB) eingeordnet. Zwar stammt der Fall aus einer Zeit vor Einführung moderner Jugendschutzvorschriften im BGB (heute gibt es §§ 107 ff. BGB, aber die waren auch damals gültig – lediglich Einwilligung der Eltern lag vor). Die Kernüberlegung war, dass eine unbefristete oder ungewöhnlich lang befristete Bindung eines Künstlers an einen Vertragspartner dessen persönliche Freiheit unangemessen beschneidet. Daraus hat die Rechtsprechung allgemein abgeleitet, dass bei sogenannten Knebelverträgen im Künstlerbereich § 138 BGB greifen kann. Der BGH hat in Folgefällen (z.B. betreffend Musiker und Künstleragenturverträge) die Prüfung angelegt, ob ein Vertrag den Künstler wirtschaftlich und künstlerisch „versklavt“ oder ob noch genug Freiräume bleiben. Insbesondere wenn ein Vertrag einseitige Vorteile für das Management vorsieht (z.B. überhöhte Gewinnbeteiligung, umfassende Verwertungsrechte, lange Laufzeiten ohne Kündigungsmöglichkeit), wird genau geprüft, ob die Grenzen der guten Sitten überschritten sind.
OGH „Kiesbauer“: Hierbei handelt es sich um einen Fall vor dem Obersten Gerichtshof in Österreich. Die bekannte TV-Moderatorin Arabella Kiesbauer hatte in den 1990er Jahren einen Exklusivvertrag (mutmaßlich mit einem TV-Sender oder Management), aus dem sie vorzeitig herauswollte. Der OGH entschied (Urteil um 1997/98, genaue AZ oft zitiert als „Kiesbauer-Urteil“), dass die Vertragsfreiheit zwar auch langfristige Bindungen erlaubt, aber bei persönlichkeitsbezogenen Leistungen eine übermäßige Bindung sittenwidrig sein kann – analog zur deutschen Sicht. Konkret soll der OGH die Freiheit der Frau Kiesbauer zur weiteren beruflichen Betätigung höher gewichtet haben als das Interesse des Vertragspartners an der Erfüllung des langfristigen Vertrags. Eine Lehre daraus war, dass zeitliche Befristung und Kündigungsmöglichkeiten in solchen Verträgen essenziell sind. Exklusivitätsklauseln, die verhindern, dass der Künstler anderweitig tätig wird, dürfen nicht über ein gewisses Maß hinausgehen (im Film- und Musikbereich gelten z.B. branchenübliche Maximallaufzeiten, häufig 3-5 Jahre und dann Verlängerungsoptionen, aber nicht „lebenslang“). Auch wurde diskutiert, ob eine Ausstiegsklausel gegen Zahlung einer angemessenen Entschädigung (quasi eine Severance) nötig sei, um die Balance zu wahren.
Deutsche Rechtsprechung allgemein: Neben Heintje gibt es diverse BGH-Entscheidungen zum Künstlervertragsrecht. Beispiel: Ein BGH-Urteil von 1985 (I ZR 28/83) griff auf Heintje zurück in einem urheberrechtlichen Kontext. Auch das sog. „Margot Eskens“-Urteil (BGH, 1968) war ein bekannter Fall einer Schlager-Sängerin, wo die Übertragbarkeit eines Künstlerexklusivvertrags hinterfragt wurde. Quintessenz in Deutschland: Bei exklusiven Künstlerverträgen muss eine angemessene Höchstbindung vereinbart sein und dem Künstler verbleiben ausreichende Entfaltungsmöglichkeiten. Außerdem muss der Vertrag fair austariert sein (Leistung und Gegenleistung). Bei Heintje war kritisiert, dass der junge Sänger quasi alle Verwertungsrechte abtrat und dafür vergleichsweise geringe Beteiligung bekam – ein Missverhältnis, das auf Ausbeutung hindeutete. Solche Verträge werden als sittenwidrig nichtig betrachtet.
Analogien auf Influencer: Influencer-Managementverträge sind im Grunde moderne Künstlerverträge. Die gleichen Grundsätze dürften gelten. Eine überlange Vertragsbindung ohne Kündigungsmöglichkeit des Influencers könnte von deutschen Gerichten gekippt werden. Ebenso eine zu umfassende Sunset-Klausel, die faktisch den Influencer noch Jahre nach Kündigung an den alten Manager finanziell bindet (siehe LG Potsdam 2021, das ja genau aus diesem Grund Sittenwidrigkeit annahm. Die Gerichte würden prüfen: Wird die berufliche Weiterentwicklung des Influencers durch den Vertrag über Gebühr gehemmt? Liegt ggf. Wucher vor (extrem ungünstiges Verhältnis zwischen Beiträgen beider Parteien)? Liegt eine Dominanzstellung vor, wo der Influencer keine echte Wahl hatte (etwa weil das Management Monopolstellung hat)? – All das fließt in § 138 BGB Würdigung ein.
Künstler-Sozialkasse & Co: Ein Aspekt aus der Rechtsprechung ist auch, ob Influencer als „Künstler“ im sozialversicherungsrechtlichen Sinn gelten (dazu später bei Scheinselbständigkeit). Das erwähnen wir hier nur am Rande: 2019 gab es in Deutschland Diskussionen, ob Influencer, die künstlerisch tätig sind, der Künstlersozialabgabe unterfallen. Rechtsprechung hierzu ist noch spärlich, aber Tendenz: Ja, wer als Influencer kreativ Content erstellt, kann als Künstler oder Publizist i.S.d. KSVG gelten. Das hat für die Agenturen Abgabepflichten (30% von deren Honorar).
Internationaler Vergleich: In den USA existiert das Konzept der unconscionability für Verträge, was ähnlich wie Sittenwidrigkeit funktioniert. Verträge, die extrem einseitig sind, können von Gerichten verworfen werden. Ein bekannter Fall betraf z.B. frühe Verträge in der Musikindustrie (Motown-Verträge mit jungen Künstlern, die lebenslange Rechte abgaben – solche wurden später als unverhältnismäßig angesehen). In UK gibt es den Restraint of Trade-Grundsatz: Ein Vertrag, der jemanden übermäßig in seiner Handelsfreiheit beschränkt, ist unenforceable unless justified. Das Kiesbauer-Urteil spiegelt diese Denkweise wider.
Für Influencer-Startups bedeutet all dies: Man kann Influencer nicht absolut „besitzen“. Jede Vereinbarung muss den Influencer als kreativen Unternehmer respektieren. Vorsicht vor Knebelungen – sie sind nicht nur ethisch fragwürdig, sondern auch gerichtlich anfechtbar. Die Verträge sollten immer eine Exit-Option vorsehen, sei es durch zumutbare Kündigungsfristen oder Entschädigungsmodelle, um nicht gegen Grundsätze der Vertragsfairness zu verstoßen. Dies schafft auch ein besseres Arbeitsverhältnis – Influencer arbeiten lieber mit einem Management zusammen, wenn sie wissen, dass sie nicht in einer „goldenen Käfig“-Situation stecken.
Arbeitsrechtliche Aspekte und Scheinselbstständigkeit
Ein oft übersehener Bereich ist das Arbeitsrecht. Viele Influencer arbeiten formal selbstständig – sie sind ja Unternehmer ihrer eigenen Marke. Doch in bestimmten Konstellationen kann es zur Problematik der Scheinselbstständigkeit kommen, nämlich dann, wenn ein Influencer wirtschaftlich und organisatorisch so sehr in die Strukturen eines Auftraggebers eingebunden ist, dass er de facto wie ein Arbeitnehmer agiert.
Scheinselbstständigkeit Kriterien: In Deutschland prüft insbesondere die Deutsche Rentenversicherung (DRV) den Status von freien Mitarbeitern. Kriterien sind u.a.: hat der Influencer/Creator weisungsgebundene Tätigkeiten, ist er in Arbeitszeit/Ort eingebunden, hat er nur einen Auftraggeber (Monokundenverhältnis), tritt er eigenständig am Markt auf oder nur im Namen des Auftraggebers, nutzt er eigene Arbeitsmittel etc. Wenn z.B. eine Influencerin ausschließlich für eine Agentur Content produziert, feste „Dienstpläne“ hat, vom Agentur-Team Anweisungen zu Inhalten und Frequenz erhält und keine eigene unternehmerische Entscheidungsmacht hat, könnte argumentiert werden, dass ein faktisches Arbeitsverhältnis vorliegt. In der Medienbranche gab es solche Fälle: freiberufliche Journalisten oder Moderatoren wurden als Arbeitnehmer eingestuft, wenn sie über Jahre nur für einen Sender tätig waren und wie Angestellte behandelt wurden.
Konsequenzen: Wird Scheinselbstständigkeit festgestellt, sind Sozialversicherungsbeiträge nachzuzahlen (Arbeitgeber- und -nehmeranteil, für bis zu 4 Jahre rückwirkend, bei Vorsatz bis 30 Jahre). Zudem drohen Strafbarkeitsrisiken nach § 266a StGB (Vorenthalten von Sozialversicherungsbeiträgen). Für das Influencer-Startup wäre es fatal, wenn plötzlich die eingesetzten Creator oder der Hauptinfluencer selbst als Arbeitnehmer gelten – das könnte Urlaubsansprüche, Kündigungsschutz, Lohnfortzahlungspflichten etc. auslösen.
Abgrenzung: Influencer sind häufig Unternehmer eigener Sache. Gerade wenn sie eigene Kanäle betreiben und nur mit Agenturunterstützung arbeiten, sind sie nicht abhängig beschäftigt. Das Startup muss aber aufpassen, wenn es mit kleineren Influencern arbeitet, diese aber voll integriert ins Team. Beispiel: Eine Agentur „kauft“ alle Rechte eines TikTok-Künstlers und schreibt ihm exakt vor, was er zu tun hat, ggf. arbeitet er sogar vom Büro der Agentur aus. Hier nähert man sich einer Schein-Freelancer-Situation.
DRV-Statusfeststellungsverfahren: In Zweifelsfällen kann man ein Statusfeststellungsverfahren bei der DRV beantragen (§ 7a SGB IV), um Klarheit zu erhalten. Für Influencer-Startups kann das sinnvoll sein, wenn man längerfristig mit einem Talent zusammenarbeitet, aber keine Festanstellung möchte. Ein solcher Bescheid schafft Rechtssicherheit.
Medienrechtsprechung: Es gibt einige Urteile, wo z.B. Kameraleute, Tontechniker oder freie Moderatoren als scheinselbstständig anerkannt wurden. Z.B. entschied das Bundessozialgericht in Fällen von Fernsehjournalisten, dass deren Scheinselbstständigkeit vorlag, da sie fest in Redaktionsabläufe eingebunden waren (BSG, Urteil vom 31.03.2017 – B 12 R 7/15 R, zu ZDF). Für Influencer speziell gibt es noch keine höchstrichterliche Entscheidung, aber analog könnte etwa ein eSports-Streamer, der exklusiv auf einem Sender-ähnlichen Kanal auftaucht und ein festes Honorar pro Monat bekommt, als Arbeitnehmer gelten.
Arbeitnehmerähnliche Personen: Selbst wenn Influencer formal selbstständig bleiben, könnten sie als arbeitnehmerähnliche Person gelten, wenn sie wirtschaftlich abhängig und vergleichbar schutzbedürftig sind (z.B. nur ein Auftraggeber, aber weiterhin selbstständig). Dann greifen zumindest einige arbeitsrechtliche Schutzvorschriften (z.B. Anspruch auf Urlaubskasse nach KSVG oder Kündigungsfristen analog).
Umgehung/Vermeidung: Wie vermeidet man Scheinselbstständigkeit? Entweder tatsächlich Anstellung wählen, wenn die Einbindung sehr eng ist – es kann Vorteile haben, Influencer fest anzustellen (Sozialversicherung, Loyalität, Planbarkeit), hat aber auch Nachteile (Lohnnebenkosten, Kündigungsschutz). Oder man strukturiert die Zusammenarbeit so, dass der Influencer eindeutig ein eigenes Geschäft betreibt: also eigene Firma hat, ggf. mehrere Kunden (nicht exklusiv nur für eine Agentur tätig), frei seine Zeit einteilen kann, von zu Hause aus arbeitet, eigenes Equipment nutzt. Im Zweifel kann man vertraglich zusichern, dass kein Arbeitsverhältnis gewollt ist, doch dies schützt nur bedingt – die tatsächliche Durchführung zählt.
Künstler vs. Arbeitnehmer: Ein kleiner Sonderfall: Künstler können teils beides sein, aber es gibt z.B. im Bühnenrecht (§ 1 TV Kü, Bühnen) oft befristete Engagements, die aus arbeitsrechtlichem Kündigungsschutz etwas herausgenommen sind. Für Influencer ist das (noch) nicht relevant, aber wenn Influencer etwa für Filmprojekte engagiert werden, geschieht das häufig als befristete Arbeitnehmer mit projektbezogenem Vertrag.
Urlaubs- und Arbeitszeitfragen: Als Selbstständige bekommen Influencer natürlich keinen bezahlten Urlaub oder geregelte Arbeitszeit. Allerdings muss man aufpassen: Weist ein Konstrukt Merkmale von Arbeitnehmerüberlassung oder Ähnlichem auf (z.B. ein Influencer-Manager „leiht“ die Influencer an Kunden aus), könnten überraschend arbeitsrechtliche Pflichten entstehen (AÜG-Problematik). Hier sollte die vertragliche Ausgestaltung eindeutig in Richtung Vermittlungs- und Projektverträge gehen und nicht wie ein „Arbeitsvertrag“ aussehen.
Insgesamt sollte ein Influencer-Startup stets prüfen, in welchem Status die handelnden Personen stehen. Der Hauptinfluencer als Gründer ist meist Gesellschafter-Geschäftsführer – auf ihn findet Arbeitsrecht in der Regel nicht Anwendung (wenn beherrschender Gesellschafter). Andere mitwirkende Influencer sollten entweder echte Partner sein (mit Share am Unternehmen oder wirklich eigenem Business) oder klar freischaffend mit mehreren Auftraggebern. Kommt es doch mal zu einer Sozialversicherungsprüfung, ist es ratsam, alle vertraglichen Unterlagen parat zu haben und darzustellen, dass die Person unternehmerisch tätig war (Rechnungen an mehrere Kunden, Eigeninvestitionen etc.). So kann man die gefährliche Feststellung der Scheinselbstständigkeit vermeiden.
Wirtschaftlich-moralische Spannungsfelder: Jugendschutz, sexuelle Inhalte, Persönlichkeitsrechte
Influencer-Startups operieren nicht im luftleeren Raum – sie bewegen sich oft in Graubereichen zwischen wirtschaftlichen Interessen und moralisch-ethischer Verantwortung. Einige besondere Spannungsfelder:
a) Sexuelle und anstößige Inhalte: Viele Influencer erwirtschaften Einkommen mit erotischen Inhalten (OnlyFans, Dessous-Shootings auf Instagram, provokante TikToks). Hier entsteht ein Spannungsfeld zwischen Reichweite steigern (Sex Sells) und Jugendschutz. Jugendliche gehören oft zur Followerschaft; das Jugendschutzrecht (Jugendschutzgesetz, Jugendmedienschutz-Staatsvertrag) verlangt, dass entwicklungsbeeinträchtigende Inhalte für unter 18-Jährige unzugänglich gemacht werden. Plattformen wie Instagram verbieten Nacktheit weitgehend, OnlyFans erlaubt sie hinter Ü18-Verifikation. Ein Influencer-Startup im Erotikbereich muss strenge Alterskontrollen implementieren. Zudem stellt sich moralisch die Frage, ob man junge Influencer zu solchen Inhalten drängt – es gab Diskussionen um Teenager auf Plattformen, die freizügige Bilder posten gegen Geld. Rechtlich können hier Wohlergehensschutz-Regeln greifen: § 184c StGB stellt z.B. Jugendpornografie unter Strafe (auch wenn 17-Jährige einvernehmliche Inhalte erstellen, deren Verbreitung ist strafbar). Das Startup muss also klare Grenzen ziehen: Kein Einbezug Minderjähriger in erotische Contentproduktion, auch keine „harmlose“ Darstellung, die aber tatsächlich grooming fördern könnte. Moralisch trägt das Management Verantwortung, den Influencer vor Ausbeutung zu schützen – nicht um jeden Preis Content generieren, der Traumata verursachen könnte oder die Würde verletzt. Vertraglich könnte man Klauseln vorsehen, dass der Influencer gewisse Arten von Content ablehnen darf, auch wenn sie profitabel wären.
b) Jugendschutz & Plattformregeln: Influencer haben oft junge Fans. Product-Placements müssen deren Schutz beachten. Z.B. ist es moralisch fragwürdig, wenn Influencer Glücksspiel oder Alkohol an ein jugendliches Publikum bewerben. In einigen Ländern (Frankreich z.B. jüngst) sind solche Werbeinhalte für Influencer gesetzlich verboten. In Deutschland greifen teils Jugendschutzbestimmungen: etwa Alkoholwerbung darf sich nicht gezielt an Minderjährige richten (Jugendschutzgesetz, UWG). Selbst wenn legal, kann es Reputationsschäden geben. Viele Influencer verweigern daher Werbung für bestimmte Branchen (Casinos, vieldiskutiert in der Twitch-Community). Ein Startup sollte einen Ethik-Kodex etablieren: Welche Sponsoren nehmen wir, welche nicht? Kurzfristiger Gewinn darf nicht über Kinderschutz gestellt werden.
c) Persönlichkeitsrechte des Influencers selbst: Influencer geben viel von ihrem Privatleben preis, um authentisch zu wirken. Das birgt das Risiko, dass die Grenzen zwischen Person und Persona verschwimmen. Das Management hat hier die Pflicht, den Influencer auch mal zu bremsen, wenn z.B. aus Sensationsgründen private Krisen ausgeschlachtet würden, die langfristig dem Persönlichkeitsrecht schaden. Beispiel: Ein Management drängt einen Influencer, seine Scheidung oder psychische Probleme öffentlich breitzutreten, um Reichweite zu ziehen – dies könnte die Persönlichkeitsrechte verletzen, etwa das Recht auf Privatsphäre. Zwar entscheidet letztlich der Influencer, was er teilt, aber ökonomischer Druck kann moralisch verwerflich sein. Umgekehrt muss das Startup auch die Persönlichkeitsrechte anderer achten: Wenn Influencer z.B. Pranks machen, in denen unbeteiligte Personen gefilmt und bloßgestellt werden, kann das deren allgemeines Persönlichkeitsrecht (Recht am eigenen Bild, Ehre) verletzen. Hier drohen juristische Schritte gegen Influencer und Firma. Also: klare Guidelines, kein Content, der Dritte degradiert oder ohne deren Einwilligung vorführt.
d) „Cancel Culture“ und Reputationsrisiken: Die öffentliche Meinung kann sich schnell gegen Influencer wenden, die als unethisch wahrgenommen werden. Das hat wirtschaftliche Auswirkungen (Sponsoren springen ab). Daher ist es nicht nur moralisch, sondern auch ökonomisch sinnvoll, ethische Standards hochzuhalten. Influencer-Startups sollten Krisenpläne haben, falls z.B. ein Shitstorm aufkommt wegen eines kontroversen Inhalts. Sie sollten sich auch der Verantwortung als Vorbilder bewusst sein – insbesondere, wenn man Minderjährigen etwas vorlebt. Ein Beispiel war die Kritik an Influencern, die für Schönheitsoperationen werben oder ein unerreichbares Körperbild propagieren. Rechtlich kaum fassbar, moralisch aber brisant. Immerhin: In Frankreich nun verboten, in DE bisher Selbstkontrolle.
e) Schutz des Influencers vor Ausbeutung: Oft denkt man an Schutz des Publikums, aber auch Influencer selbst (gerade junge Newcomer) sind gefährdet, von Branchenplayern ausgenutzt zu werden – sei es finanziell oder sexuell (Stichwort „Modelle und MeToo“ – auch im Influencer-Bereich vorstellbar, wenn etwa ein Fotograf Grenzen überschreitet). Das Startup muss interne Policies haben (z.B. zwei Personen am Set, keine zweideutigen Arrangements). Gerade bei Models und sexuellen Inhalten (OnlyFans) sollte es vertraglichen Schutz geben: etwa dass der Influencer Content jederzeit zurückziehen kann, wenn er sich unwohl fühlt (natürlich mit Blick auf bestehende Abos muss man Lösungen finden). Genauso sollte das Startup den Influencer schützen, wenn etwa private intime Bilder geleakt werden – das ist strafbar (Recht am eigenen Bild, § 33 KUG), und hier sollte das Management rechtlich durchgreifen.
f) Privacy und Daten: Influencer sammeln über ihre Follower oft Daten (Newsletter, Gewinnspiele, etc.). Hier muss DSGVO eingehalten werden. Darüber hinaus aber moralisch: Keine missbräuchliche Nutzung (Verkauf von Fan-Daten an Dritte ohne Wissen), Respekt vor Fan-Post, vernünftiger Datenschutz auch intern (z.B. Teammitglieder sehen nicht ungefragt private Nachrichten). Vertrauensbruch kann die Community beschädigen.
Insgesamt sind Influencer-Startups gut beraten, sich einen Verhaltenskodex zu geben, der über das gesetzlich Notwendige hinausgeht. Dieser könnte Punkte enthalten wie: Verantwortungsvoller Umgang mit Werbung (keine schädlichen Produkte), Sicherstellung, dass keine Inhalte veröffentlicht werden, die Würdeverletzungen darstellen, Schutz von Kindern (keine Darstellung der eigenen Kinder ohne Schutz, keine sexualisierten Inhalte für unter 18 etc.), Transparenz bei möglicher digitaler Manipulation (auch KI-Aspekt: wenn Filter oder Deepfakes genutzt werden, Offenheit darüber, um keine falschen Körperideale zu setzen). Solche Maßnahmen dienen nicht nur dem guten Gewissen, sondern beugen auch rechtlichen Konflikten vor, da viele „Skandale“ schnell in rechtliche Probleme umschlagen können (etwa Jugendschutzverfahren, Persönlichkeitsrechtsklagen, strafrechtliche Ermittlungen). Die Herausforderung ist, diese hohen Standards zu halten, ohne die Kreativität abzuwürgen. Es braucht also Sensibilisierung aller Beteiligten.
Grenzüberschreitende Vertragsmodelle und Datenschutz (DSGVO)
Influencer agieren oft international: Fans weltweit, Deals mit ausländischen Firmen, Wohnsitz im Ausland. Das bringt juristisch einige Besonderheiten mit sich:
a) Internationales Vertragsrecht: Schließt ein deutsches Influencer-Startup einen Vertrag mit einem US-Werbekunden, stellt sich die Frage nach dem anwendbaren Recht und Gerichtsstand. Üblich ist, dies vertraglich festzulegen (Rechtswahlklausel, Gerichtsstand- oder Schiedsklausel). Ohne Vereinbarung greifen Kollisionsnormen: Bei Dienstleistungsverträgen kann nach Rom-I-VO deutsches Recht anwendbar sein, wenn der Influencer seine charakteristische Leistung von Deutschland aus erbringt und nichts anderes vereinbart wurde. Es kann aber auch sein, dass der ausländische Partner seine AGB mit Rechtswahl stellt. Hier muss man aufpassen, dass der Influencer sich nicht unbemerkt fremdem Recht unterwirft, dessen Implikationen er nicht kennt. Daher: Klarheit durch Rechtswahl. Viele Influencer-Vereinbarungen mit globalen Brands wählen englisches Recht oder schweizer Recht als neutralen Boden, plus Schiedsgerichtsklausel (z.B. ICC-Schiedsverfahren). Für das Startup ist wichtig, die Kosten und Durchsetzbarkeit im Blick zu haben – ein Schiedsspruch ist international meist vollstreckbar, ein deutsches Urteil in den USA z.B. eher schwierig durchzusetzen und umgekehrt.
b) Steuerliche Betriebsstätten-Frage: Wenn ein Influencer in Deutschland eine Firma hat, aber von z.B. Dubai aus agiert, kann eine steuerliche Betriebsstätte entstehen. Das ist hier nur am Rande relevant, aber immerhin: Die Betriebsstättenthematik und Doppelbesteuerungsabkommen müssen im Hinterkopf behalten werden. Einfluss auf Verträge: Manchmal wird aus steuerlichen Gründen der Influencer für Auslandsgeschäfte über eine dort ansässige Tochterfirma oder Zwischengesellschaft abgerechnet.
c) Datenschutz (DSGVO): Influencer-Startups verarbeiten personenbezogene Daten – von Followern (Kommentarlisten, Direct Messages), von Kunden, von Newsletter-Abonnenten etc. Die DSGVO gilt, sobald die Verarbeitung im Zusammenhang mit dem Anbieten von Waren/Diensten an EU-Bürger steht (Marktortprinzip). Ein Influencer mit globaler Reichweite muss also DSGVO einhalten für seine EU-Follower. Das bedeutet: Privacy Policy bereitstellen, ggf. Einwilligungen für Newsletter einholen, nur Auftragsverarbeiter einsetzen mit DSGVO-konformen Verträgen (z.B. wenn man E-Mail-Tools nutzt oder Cloud-Analyse). Bei internationalem Verkehr fließen oft Daten in Drittländer (z.B. wenn der Social-Media-Manager in den USA sitzt und auf die Fan-Daten zugreift). Hier müssen geeignete Garantien (Standardvertragsklauseln) getroffen werden. Für die Fans ist wichtig: Recht auf Auskunft, Löschung etc. Das Startup sollte einen Datenschutzbeauftragten ernennen, wenn nötig (bei umfangreicher Datenverarbeitung, meist ab 10 Mitarbeitern regelmäßig mit Daten, § 38 BDSG). Auch wenn nicht gesetzlich verlangt, ist es gut, intern jemanden für Privacy verantwortlich zu haben. Eine besondere Sache: Influencer kommunizieren viel über Plattformen (Instagram, YouTube). Die Plattform speichert die Daten, aber der Influencer nutzt sie. Nach aktueller Ansicht sind Influencer für ihre Fanpages auf Facebook z.B. mitverantwortlich (Fanpage-Entscheidung EuGH 2018). Entsprechend müsste auch ein Instagram-Influencer evtl. Mitverantwortlicher sein für die Daten auf seiner Seite. Praktisch schwierig umzusetzen, aber man sollte es nicht ignorieren. Mindestens sollte man in der Bio/Impressum auf die Datenschutzhinweise verlinken.
d) Cross-Border Content-Lizenzen: Will ein deutsches Startup die Inhalte eines Influencers international vermarkten (z.B. Clips an ausländische Medien verkaufen), sollte im Vertrag genau stehen, dass die Rechte weltweit eingeräumt sind (territorial unbeschränkt) oder wo nicht. Sonst könnte der Influencer später in den USA sagen, hier greift mein Persönlichkeitsrecht nach kalifornischem Recht, ihr durftet das nicht dort senden. Ebenfalls zu bedenken: Sprachversionen. Wenn z.B. für die Verwertung im Ausland Übersetzungen oder Synchronisationen gemacht werden, müssen auch diese abgedeckt sein (UrhG Bearbeitungsrecht, Persönlichkeitsrecht am eigenen gesprochenen Wort etc.).
e) Internationale Compliance: Erwähnt sei das Thema KI: Wenn das Influencer-Startup KI-generierte Inhalte nutzt (z.B. Deepfake-Stimmen, virtuelle Influencer), gilt international unterschiedliche Regulierung. In der EU kommt die KI-Verordnung: Für „Deepfakes“ ist Transparenzpflicht vorgesehen. D.h., wenn ein Influencer-Video eigentlich von einer KI generiert wurde (z.B. Avatar), muss dies gekennzeichnet sein sobald es realitätsgetreu menschliches Verhalten vortäuscht. Diese Vorschrift wird voraussichtlich mit dem AI Act in Kraft treten. Das kann relevant werden, wenn z.B. ein verstorbener Influencer virtuell weiter genutzt würde, oder ein Influencer seine Stimme/sein Gesicht per KI multipliziert (für Sprachausgaben in verschiedenen Sprachen etwa). Solche futuristischen Modelle sollten in Verträgen vorweggenommen werden: Wem gehören z.B. die Traininigsdaten (die Videos als KI-Trainingsmaterial), darf das Management einen digitalen Klon des Influencers einsetzen? Ohne ausdrückliche Vereinbarung vermutlich nicht, da es das allgemeine Persönlichkeitsrecht tangiert. Besser explizit regeln, ob und wie KI genutzt werden darf.
f) Schiedsgericht vs. Gericht: In internationalen Verträgen oft Schiedsvereinbarung. Vorteil: Vollstreckbar in vielen Ländern dank New Yorker Übereinkommen. Nachteil: teuer. Eine Alternative kann Mediation sein – Influencer-Verträge können eine Mediationsklausel enthalten, damit internationale Dispute gütlich gelöst werden, bevor der Social-Media-Krieg losgeht. Das schont auch das öffentliche Image.
g) Anwendbarkeit deutschen Schutzrechts im Ausland: Wenn ein ausländischer Influencer mit Marke in Heimatland in Deutschland auftreten will – sollte er Markenschutz hier beantragen? Umgekehrt, ein deutscher Influencer expandiert nach USA – dort Markenanmeldung erwägen. Hier sind IP-Anwälte gefragt. Domainrecht: Wenn jemand im Ausland den Namen des Influencers als Domain registriert und darüber Fans leitet, kann Domain Grabbing nach UDRP Verfahren bekämpft werden (z.B. bei .com Domains). Das sind internationale Mechanismen, die relevant werden können.
Im Ergebnis verlangt der grenzüberschreitende Aspekt ein waches Auge auf Rechtswahl, Datenschutz und IP-Management. Besser im Vertrag ein paar Zeilen mehr investieren (z.B. detaillierte Rechtswahlklausel, DSGVO-Auftragsverarbeitung klären, weltweite Rechteeinräumung), als später mühsam Länder für Länder klagen zu müssen. Gerade Datenschutz ist ein Compliance-Blocker: Manche US-Partner wollen keine DSGVO-Verpflichtungen unterzeichnen – dann muss man überlegen, ob man auf den Deal verzichtet oder Wege findet (z.B. Daten in EU lassen). Für Influencer, die Daten international transferieren (z.B. Team in USA hat Zugang zum Instagram-Account mit EU-Fandaten), sind Standard Contractual Clauses zwischen EU-Company und US-Team Pflicht, um legal zu sein. Das sollte im Setup eines Influencer-Startups mitbedacht werden.
Investorenansprache: Juristische Herausforderungen bei Skalierung der Managementstrukturen
Für viele Influencer-Startups stellt sich irgendwann die Frage, wie man Investoren ins Boot holt, um zu wachsen. Doch klassische Venture Capital-Geber waren lange skeptisch gegenüber Modellen, die auf einzelnen Personen basieren. Wie kann man also die Grenzen der „Agentur-Mentalität“ überwinden und ein investierbares, skalierbares Geschäftsmodell schaffen? Und welche rechtlichen Hürden treten dabei auf?
a) Vom Star zur Struktur: Ein zentrales Problem ist die Personenabhängigkeit. Ein VC-Investor investiert ungern in ein Unternehmen, dessen Wert einzig an einer Person hängt, die jederzeit gehen kann. Daher muss ein Influencer-Startup rechtlich die Marke und Reichweite vom Individuum auf die Company übertragen – sei es durch Lizenzen oder Eigentumsübertragungen. Praktisch: Der Influencer gründet eine GmbH (oder ähnliche Rechtsform), diese schließt mit dem Influencer einen umfassenden Vertrag, der der GmbH exklusive Rechte einräumt (Nutzungsrechte am Content, Verwertungsrechte an Name/Bild etc., idealerweise langfristig). So kann der Wert zumindest teilweise von der Person auf das Unternehmen übergehen. Investoren sehen dann, dass das Unternehmen Verträge in der Hand hat, die auch bei Ausscheiden des Influencers nicht sofort wertlos werden. Allerdings bleibt ein Key-Person-Risk: Juristisch kann man versuchen, den Influencer über Vesting oder Earn-Outs im Boot zu halten. Beispielsweise könnte der Influencer Gründer-Anteile haben, die über Jahre erst unverfallbar werden (so bleibt Motivation zu bleiben). Oder im Investmentvertrag wird eine Good Leaver/Bad Leaver-Klausel vereinbart: Verlässt der Influencer ohne wichtigen Grund vor einer bestimmten Zeit das Unternehmen, muss er seine Anteile günstiger zurückgeben (Bad Leaver), bleibt er, behält er sie (Good Leaver). Solche gesellschaftsrechtlichen Mechanismen sind wichtig, aber sie müssen sorgfältig mit dem Arbeits-/Dienstvertragsrecht synchronisiert werden.
b) Skalierung durch Multi-Talent-Plattform: Einige Influencer-Startups pivotieren weg vom Einzelstar und bauen ein Portfolio von Talents auf – quasi eine Talent-Agentur 2.0 oder Influencer-Netzwerk. Das erhöht die Skalierbarkeit, weil das Unternehmen nicht nur auf eine Person angewiesen ist. Investoren honorieren Diversifikation. Juristisch bedeutet das, dass man mit mehreren Influencern Managementverträge abschließt. Die Herausforderung: Ein Konsolidierungsmodell kann in Wettbewerb mit traditionellen Agenturen treten, was rechtlich okay ist, aber man muss auf Kartellrecht achten, falls man zu viel Markt bündelt (derzeit im Influencer-Markt eher noch fern). Auch muss man intern NDAs und No-Poaching vereinbaren, dass die Influencer sich nicht gegenseitig abwerben innerhalb der Plattform oder bei Abgang alle Kunden mitnehmen. Ein klares Regime von Vertragslaufzeiten und vielleicht auch Anreizsystemen (z.B. Profit-Sharing für Top-Talents) hilft, um Netzwerkeffekte zu behalten.
c) Produktisierung des Geschäftsmodells: Ein Weg, um investierbar zu werden, ist die Produktifizierung – d.h. Dienstleistungen in wiederholbare Produkte umwandeln. Z.B. Entwicklung einer Technologie-Plattform (eine App, die Influencer und Brands zusammenbringt). Dann tritt das Startup nicht nur als Agentur, sondern als Tech-Unternehmen auf, was VCs bevorzugen. Rechtlich bedeutet das aber zusätzliche Dimensionen: Software-Recht (Urheberrecht am Code, Lizenzierung, AGB für Nutzer), evtl. Plattformhaftung wie bei Marktplätzen etc. Auch Datenrecht, falls die Plattform Daten analytisch nutzt (Big Data der Follower). Der Pitch an Investoren ist dann: „Wir haben die Software, die Influencer-Marketing skaliert“ anstatt „wir managen Person X“. Allerdings muss man die bestehenden vertraglichen Verpflichtungen der Talents auf so eine Plattform überführen (Datenschutz: Darf ich ihre Performance-Daten mit allen teilen? etc.).
d) Überwindung der Agenturgrenzen: Klassische Agenturen haben lineares Wachstum – mehr Kunden erfordert mehr Mitarbeiter. Skalierung ist limitiert. Ein Influencer-Startup kann das durch Plattformlösungen überwinden, die Content-Erstellung automatisieren, Reichweite digital messen und Prozesse effizienter gestalten. Rechtlich verlangt dies klare Regelungen zum geistigen Eigentum an automatisiert erstellten Inhalten, Datenschutzfragen bei automatischer Verarbeitung von Nutzerdaten, und vertragliche Klarstellungen, wer für automatisierte Fehler haftet. Investoren interessieren sich hier vor allem für Fragen des geistigen Eigentums, da Software-basierte Lösungen nur dann attraktiv sind, wenn sie rechtlich sicher exklusiv nutzbar bleiben. Zudem müssen AGB und Lizenzbedingungen sorgfältig ausgearbeitet werden, um Haftungsrisiken zu minimieren.
Die rechtliche Komplexität beim Übergang vom Einzelinfluencer zu einer skalierbaren, investierbaren Unternehmensstruktur ist erheblich, aber notwendig, um Wachstumskapital von VCs zu erhalten.
Fazit
Die rechtliche Gestaltung und unternehmerische Strukturierung von Influencer-Startups und Personal Brands ist ein komplexes Unterfangen, das tiefgreifende Kenntnisse in einer Vielzahl von Rechtsgebieten voraussetzt. Die essenziellen Rechtsbereiche umfassen insbesondere das Vertragsrecht, Markenrecht, Datenschutzrecht, Urheberrecht sowie internationale rechtliche Fragestellungen, die stets aktuell gehalten werden müssen, um zukünftige Herausforderungen sicher zu meistern. Gerade bei Influencer-Startups liegt der besondere juristische Anspruch darin, dass sie häufig rund um eine oder mehrere Personal Brands aufgebaut werden, die wiederum sowohl persönlichkeitsrechtliche als auch markenrechtliche Aspekte berühren. Daher ist es notwendig, diese Marken frühzeitig umfassend zu sichern und langfristig durch ein strategisches Markenmanagement zu schützen, um eine nachhaltige Wertschöpfung zu gewährleisten.
Um wirtschaftlichen Erfolg sicherzustellen, müssen Influencer-Startups die richtigen Monetarisierungsstrategien wählen und diese mit einer rechtssicheren Vertragsgestaltung verbinden. Die verschiedenen Modelle – von Sponsored Content und eigenen Produkten bis hin zu Plattform-Monetarisierung – bieten vielfältige Chancen, bergen aber zugleich erhebliche Risiken, wenn nicht von Beginn an auf klare und vorausschauende Vertragsgestaltung geachtet wird. Insbesondere beim Thema Werbekennzeichnungspflicht und Haftung für fremde Inhalte lauern erhebliche Stolpersteine, die im schlimmsten Fall zu Abmahnungen oder rechtlichen Streitigkeiten führen können. Eine proaktive rechtliche Beratung und sorgfältig geführte Compliance-Checks sind daher unabdingbar, um solche Risiken effektiv zu minimieren.
Im Bereich Datenschutz müssen Influencer-Startups besonders sorgfältig agieren, da sie oft erhebliche Mengen an personenbezogenen Daten verarbeiten – sowohl von Followern als auch von Kooperationspartnern. Die Einhaltung der DSGVO und weiterer relevanter Datenschutzgesetze ist nicht nur gesetzliche Pflicht, sondern auch von hoher Bedeutung für den Aufbau von Vertrauen und langfristigen Kundenbeziehungen. Internationale Rechtsfragen kommen hinzu, sobald die Reichweite und der wirtschaftliche Fokus des Startups über nationale Grenzen hinausgehen. Hier sind spezifische Kenntnisse zu den unterschiedlichen regulatorischen Anforderungen verschiedener Länder notwendig, um beispielsweise Haftungsrisiken und Steuerthemen effektiv zu managen.
Die Gewinnung von Investoren und die damit verbundene Skalierung eines Influencer-Startups erfordert eine strategische Lösung für das zentrale Problem der Personenabhängigkeit. Investoren bevorzugen Geschäftsmodelle, die nicht vollständig auf einzelne Personen angewiesen sind, sondern eine eigenständige unternehmerische Struktur aufweisen. Dies gelingt durch intelligente Vertragslösungen wie exklusive Lizenz- und Übertragungsverträge, die dem Startup langfristige Nutzungsrechte an den Marken und Inhalten sichern. Auch gesellschaftsrechtliche Instrumente wie Vesting-Regelungen, Earn-Out-Mechanismen und Good-Leaver-/Bad-Leaver-Klauseln helfen dabei, die Bindung zentraler Personen langfristig zu gewährleisten und so die Unternehmensbewertung attraktiv zu gestalten.
Darüber hinaus eröffnet die Diversifikation des Geschäftsmodells – etwa durch die Entwicklung einer Multi-Talent-Plattform oder durch Technologieplattformen zur automatisierten Reichweitenvermarktung – bedeutende Wachstumspotenziale und verringert gleichzeitig das Risiko für Investoren. Solche skalierbaren Lösungen erfordern jedoch zusätzliche rechtliche Überlegungen, etwa im Bereich des geistigen Eigentums, der Plattformhaftung und des Wettbewerbsrechts. Klare und umfassende vertragliche Regelungen zu geistigem Eigentum, Nutzungsrechten, Haftungsbeschränkungen und Datenschutzfragen schaffen hierbei die notwendige Grundlage für nachhaltiges Wachstum und Investorenvertrauen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die langfristige Perspektive eines Influencer-Startups entscheidend davon abhängt, ob die rechtlichen Herausforderungen von Beginn an ernst genommen und systematisch angegangen werden. Nur durch eine umfassende juristische Strategie, die sowohl die Personal Brand absichert als auch geeignete Strukturen zur Skalierung und Investorengewinnung schafft, können Influencer-Startups ihr volles Potenzial entfalten. Der Aufwand für eine präzise rechtliche Strukturierung zahlt sich langfristig mehrfach aus: in Form reduzierter Risiken, erhöhter Investitionsbereitschaft externer Kapitalgeber und letztlich nachhaltigem, gesichertem wirtschaftlichem Erfolg.