Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Wann wird ein Projektmitarbeiter ein Angestellter?
Das Problem Oft genug habe ich bei Mandanten und auch hier auf dem Blog gepredigt, dass man nicht unterschätzen sollte,...
Mehr lesenDetailsService Level Agreements (SLAs) sind für SaaS-Startups ein zentrales Instrument, um Kunden klare Leistungsvorgaben zu geben und gleichzeitig die eigene Haftung in kontrollierbare Bahnen zu lenken. In diesem Leitfaden betrachten wir praxisnah, wie SLAs in Deutschland professionell und rechtssicher gestaltet werden können. Dabei beleuchten wir marktübliche Verfügbarkeitszusagen, die Definition von Wartungsfenstern, abgestufte Support-Level und Reaktionszeiten, Service Credits bzw. Vertragsstrafen bei SLA-Verletzungen sowie die Zulässigkeit solcher Klauseln nach deutschem AGB-Recht. Dieser Überblick richtet sich an juristisch und unternehmerisch interessierte Leserinnen und Leser, die für ein SaaS-Startup ein robustes SLA entwickeln möchten.
Ein Kernbestandteil jedes SLA ist die verfügbare Betriebszeit der Cloud-Software (Uptime). Branchenüblich sind sehr hohe Verfügbarkeitszusagen – absolute 100 % werden kaum garantiert, sondern meist Werte im Bereich 99 % bis 99,9 % pro Zeitraum. Solche Zahlen wirken klein, aber sie entsprechen beträchtlichen Unterschieden in der zulässigen Ausfallzeit (Downtime):
Je höher der Prozentwert, desto geringer die tolerierte Downtime. „Five Nines“ (99,999 %) entsprechen z. B. nur etwa 5 Minuten Ausfall pro Jahr, was nur bei hochverfügbaren Enterprise-Systemen realistisch ist. Für ein Startup genügen oft drei Ninen (99,9 %) als Ziel für geschäftskritische Dienste, während weniger kritische Anwendungen auch mit ~99 %–99,5 % Zusage betrieben werden können.
Wichtig ist, Werte und Bezugszeiträume genau zu definieren. Üblich ist eine Messung pro Kalendermonat (so wird verhindert, dass Ausfälle aus einem schlechten Monat durch gute Monate „verwässert“ werden). Eine SLA-Klausel könnte z. B. lauten: „Der SaaS-Dienst hat eine Verfügbarkeit von 99,5 % pro Monat.“ Dabei sollte klargestellt werden, wie Verfügbarkeit gemessen wird – etwa bezogen auf die Gesamtzeit minus definierte Wartungszeiten (siehe nächster Abschnitt). Es empfiehlt sich auch, festzulegen, was genau als Ausfall zählt (kompletter Dienstausfall vs. bloße Performance-Degradation). Manche Anbieter schließen „Teilstörungen“ oder Minderleistung ausdrücklich von der Downtime-Berechnung aus. Entscheidend ist, dass die Kennzahl Verfügbarkeit transparent und für beide Seiten nachvollziehbar geregelt ist.
Wartungsarbeiten sind unvermeidlich, sei es für Updates, Bugfixes oder Sicherheits-Patches. Im SLA sollten Wartungsfenster festgelegt werden, um planbare Downtime klar von echten Störungen zu trennen. Üblich ist die Unterscheidung zwischen geplanter Wartung (maintenance) und ungeplanter Wartung (Notfallmaßnahmen):
Als Faustregeln für Wartungsklauseln gelten: Geplante Wartungen klar definieren (Zeiten, Dauer) und von der Verfügbarkeitsberechnung ausnehmen, diese Wartungen frühzeitig ankündigen, und ungeplante Eingriffe nur im Notfall zulassen. So behält der Anbieter die nötige Flexibilität für Betrieb und Updates, ohne dass Kunden die vereinbarte Uptime anzweifeln müssen.
Neben der technischen Verfügbarkeit sollte ein SLA auch den Support abdecken: Wie schnell reagiert der Anbieter, wenn der Kunde ein Problem meldet? Gerade für B2B-Kunden ist eine professionelle Support-Vereinbarung wichtig, um Betriebsstörungen zügig zu beheben. Üblich ist es, Störungsmeldungen nach Dringlichkeit zu priorisieren und für jede Prioritätsstufe bestimmte Reaktionszeiten festzulegen:
Diese Beispiele zeigen ein mögliches Schema (oft auch in P1/P2/P3 kategorisiert). Wichtig: Das SLA sollte auch definieren, wann die Uhr läuft. Häufig gelten Reaktionszeiten nur innerhalb definierter Supportzeiten – etwa Montag bis Freitag, 8:00–18:00 Uhr. Beispielsweise bedeutet „Reaktionszeit 1 Stunde“ unter Geschäftszeit-Bedingungen, dass eine kritische Störung, die Freitag um 22:00 Uhr gemeldet wird, erst am nächsten Werktag um 9:00 Uhr bearbeitet werden muss. Wer 24/7-Support bieten möchte, muss dies ausdrücklich zusagen (für Startups oft eine Kostenfrage). Alternativ kann man Premium-Support mit erweiterten Zeiten gegen Aufpreis anbieten.
Zusätzlich zur Reaktionszeit wird manchmal eine Lösungszeit (Time-to-Resolve) vereinbart – z. B. dass bei P1-Störungen innerhalb von 4 oder 8 Stunden eine Lösung oder zumindest ein Workaround bereitgestellt sein muss. Dies ist aber heikel, da nicht jeder Fehler in fester Zeit gelöst werden kann. Oft begnügt man sich damit, **Reaktions- bzw. Wiederherstellungszeiten als Zielgrößen (Service Level Objectives) zu definieren, ohne Garantien im engen Sinne. Wichtig ist, dass Support-Prozesse klar beschrieben werden: Wie meldet der Kunde Störungen (Ticketsystem, Hotline?), und wie wird priorisiert. Ein transparentes Verfahren erhöht das Kundenvertrauen und verhindert falsche Erwartungen.
Kein SLA ist vollständig ohne Regelungen, was passiert, wenn der Anbieter die zugesagten Service Levels nicht einhält. Hier kommen vertragliche Sanktionen ins Spiel, die von Vertragsstrafen bis zu Service Credits reichen. Im SaaS-Umfeld haben sich vor allem Service Credits (Gutschriften) als gängige Lösung etabliert – quasi eine Geld-zurück-Garantie in Form einer Gutschrift, die der Kunde bei Nichterreichen der SLA anfordern kann.
Typische Modelle für Service Credits: Oft vereinbaren Provider und Kunde einen bestimmten Prozentsatz der monatlichen Gebühr, der gutgeschrieben wird, abhängig davon, wie stark das SLA verfehlt wurde. Beispiel: Bei Unterschreitung der garantierten Verfügbarkeit gewährt der Anbieter pro x Stunden Ausfall eine Gutschrift von y% der Monatsgebühr. Ein konkretes Modell aus der Praxis: „Je angefangene 30 Minuten Ausfallzeit erhält der Kunde eine Gutschrift in Höhe einer Tagesmiete (1/30 der Monatsgebühr), maximal jedoch 50 % der Monatsgebühr.”. Damit wird der Ausfallschaden pauschaliert – der Kunde bekommt finanziellen Ausgleich (meist verrechnet auf zukünftige Rechnungen), ohne jeden einzelnen Schadenersatzanspruch kompliziert nachweisen zu müssen. Gleichzeitig begrenzt der Anbieter seine Haftung nach oben (z. B. auf höchstens die Hälfte eines Monatsentgelts). Dieses Modell soll einen Anreiz zur Leistung schaffen, den Anbieter aber nicht übermäßig bestrafen.
Grenzen von Service Credits: Wichtig ist, dass solche Gutschriften automatisch oder auf einfachen Antrag des Kunden gewährt werden. Üblich ist eine Frist, innerhalb derer der Kunde den SLA-Verstoß melden und die Gutschrift einfordern muss (z. B. „innerhalb von 5 Werktagen nach Monatsende“). Versäumt der Kunde diese Frist, verfällt der Anspruch – dies sollte deutlich im Vertrag stehen. Eine Barauszahlung der Credits ist meist ausgeschlossen; stattdessen werden sie mit künftigen Zahlungen verrechnet. Außerdem wird in vielen SLAs festgelegt, dass **Service Credits das exklusive Rechtsmittel des Kunden sind, also anstelle anderer Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche gewährt werden. So versucht der Anbieter zu verhindern, dass der Kunde trotz Gutschrift noch weitere Ansprüche (wie entgangenen Gewinn etc.) geltend macht. Allerdings ist Vorsicht geboten: Diese Haftungsbeschränkung muss im Rahmen des deutschen Rechts zulässig sein (siehe nächster Abschnitt).
Vertragsstrafe vs. pauschalierter Schadensersatz: Juristisch gesehen sind Service Credits eine Form von pauschaliertem Schadensersatz oder Vertragsstrafe, je nach Ausgestaltung. Eine Vertragsstrafe („Konventionalstrafe“) hat primär Sanktionscharakter – sie setzt den Anbieter unter Druck, die Leistungspflicht zu erfüllen, und erleichtert dem Kunden den Erhalt eines Ausgleichs ohne Schadensnachweis. Im Unterschied dazu dient eine echte Schadensersatz-Pauschale vor allem der Beweiserleichterung und orientiert sich an einem typischen Schaden. In der Praxis verschwimmen die Begriffe: „Service Credits“ werden gerne verwendet, um das Konzept kundenfreundlich klingen zu lassen – letztlich handelt es sich um eine vertraglich festgelegte Kompensation bei Minderleistung. Wichtig: Höhe und Voraussetzungen der Gutschriften sollten im Vertrag eindeutig bestimmt sein (am besten objektiv messbar, z. B. Prozentsätze, Zeiten). Und: Kein Anbieter wird einer unbegrenzten Strafzahlung zustimmen – daher sind Kappungsgrenzen (ceiling) gängig, wie im obigen Beispiel 50 % der Monatsgebühr. Darüber hinaus kann man Sonderkündigungsrechte vereinbaren: Bei schwerwiegenden SLA-Verletzungen (z. B. Verfügbarkeit fällt über längere Zeit weit unter zugesagten Wert) erhält der Kunde das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund. Diese „Exit-Klausel“ wirkt zwar dramatisch, ist aber ein wichtiges Druckmittel für Kunden und erhöht die Glaubwürdigkeit des SLA.
Für deutsche SaaS-Startups ist es entscheidend, dass die SLA-Klauseln mit dem AGB-Recht (§§ 305 ff. BGB) im Einklang stehen, da die SLAs meist als vorgefertigte Vertragsbedingungen gelten. Eine vermeintlich clevere Klausel nützt nichts, wenn sie vor Gericht unwirksam ist. Folgende Punkte sollten beachtet werden:
Zusammengefasst: Eine rechtssichere SLA-Gestaltung muss die Balance wahren zwischen klar definierten, für Kunden hilfreichen Zusagen und wirksamen Haftungsbegrenzungen für den Anbieter. Überraschungen und Einseitigkeiten gilt es zu vermeiden. Im Zweifel sollten SLA-Klauseln einfach und fair gehalten werden, damit sie im Ernstfall Bestand haben und nicht vor Gericht gekippt werden.
Ein gut formuliertes SLA ist für ein SaaS-Startup Gold wert: Es schafft Vertrauen bei Kunden, indem es Verfügbarkeit, Support und Reaktionszeiten verbindlich zusagt, und es gibt gleichzeitig dem Anbieter einen Rahmen zur Risikokontrolle. Marktübliche Verfügbarkeitszusagen (wie 99 % oder 99,9 % Uptime) stellen sicher, dass Kunden auf die Zuverlässigkeit des Dienstes vertrauen können, während klar definierte Wartungsfenster dem Betreiber genügend Raum für Updates und Pflege lassen – ohne versteckte Ausfälle. Gestufte Support-Level mit schnellen Reaktionszeiten für kritische Probleme zeigen Professionalität und Kundennähe. Und im Falle der Fälle sorgen Service Credits als vertragliche Kompensation dafür, dass Kunden fair entschädigt werden, ohne dass gleich der Rechtsweg beschritten werden muss. All dies trägt zu einer professionellen Kundenkommunikation bei und begrenzt die Haftung des Anbieters auf planbare Weise.
Bei der Ausarbeitung eines SLA sollten Startups stets den rechtlichen Rahmen im Blick behalten: Was nützt die beste SLA-Klausel, wenn sie vor Gericht nicht hält? Indem man die AGB-rechtlichen Leitplanken einhält – keine unzulässigen Haftungsausschlüsse, angemessene Regelungen bei Pflichtverletzungen – wird das SLA rechtssicher. Im Zweifel lohnt es sich, juristischen Rat einzuholen oder an bewährten Branchenvorbildern Maß zu nehmen.
Ein SLA ist letztlich mehr als nur ein Vertrag: Es ist ein Leistungsversprechen an die Kunden. Wenn es gut gemacht ist, profitieren beide Seiten – der Kunde weiß, worauf er sich verlassen kann, und das Startup setzt klare Grenzen für seine Verpflichtungen. Damit wird die Zusammenarbeit verlässlich, Streitigkeiten werden vorgebeugt und das SaaS-Startup kann sich darauf konzentrieren, seinen Service stetig zu verbessern, ohne im Haftungsdschungel zu stranden. Eine klare SLA-Gestaltung zahlt sich langfristig aus – sowohl in Kundenzufriedenheit als auch in Rechtssicherheit.
Marian Härtel ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für IT-Recht mit einer über 25-jährigen Erfahrung als Unternehmer und Berater in den Bereichen Games, E-Sport, Blockchain, SaaS und Künstliche Intelligenz. Seine Beratungsschwerpunkte umfassen neben dem IT-Recht insbesondere das Urheberrecht, Medienrecht sowie Wettbewerbsrecht. Er betreut schwerpunktmäßig Start-ups, Agenturen und Influencer, die er in strategischen Fragen, komplexen Vertragsangelegenheiten sowie bei Investitionsprojekten begleitet. Dabei zeichnet sich seine Beratung durch einen interdisziplinären Ansatz aus, der juristische Expertise und langjährige unternehmerische Erfahrung miteinander verbindet. Ziel seiner Tätigkeit ist stets, Mandanten praxisorientierte Lösungen anzubieten und rechtlich fundierte Unterstützung bei der Umsetzung innovativer Geschäftsmodelle zu gewährleisten.
Das Problem Oft genug habe ich bei Mandanten und auch hier auf dem Blog gepredigt, dass man nicht unterschätzen sollte,...
Mehr lesenDetailsDie Europäische Union hat einen bedeutenden Schritt in Richtung einer fortschrittlichen Datenwirtschaft unternommen, indem sie den Data Act verabschiedet hat....
Mehr lesenDetailsDie Bindung von Schlüsselmitarbeitern ist für Startups von zentraler Bedeutung, insbesondere wenn es darum geht, Investoren von der Stabilität und...
Mehr lesenDetailsImmer wieder erreichen mich Anfragen, wie man beispielsweise als Softwarentwickler oder junges Startup mit Plattformen wie Upwork, Fiverr, Freelancer.com umgeht,...
Mehr lesenDetailsCloud-Dienste bieten Startups zahlreiche Vorteile wie Flexibilität, Skalierbarkeit und Kosteneffizienz. Allerdings bringt die Nutzung von Cloud-Services auch erhebliche datenschutzrechtliche Herausforderungen...
Mehr lesenDetailsDas Landgericht Nürnberg hat mit einer einstweiligen Verfügung die Sperrung eines Twitter Accounts untersagt, der wegen dem Tweet "Aktueller Anlass:...
Mehr lesenDetailsFacebook kann in einer gerichtlichen Auseinandersetzung mit einem deutschen Nutzer nicht auf einer Übersetzung deutschsprachiger Schriftstücke in das Englische bestehen....
Mehr lesenDetailsDa ich mich diese Woche mit einigen größeren Spielerverträgen beschäftigten musste bzw. diese für internationale Teams neu erstellt habe, möchte...
Mehr lesenDetailsMit Beschluss vom 29. Oktober 2020 hat das Landgericht Köln zum Thema Cookies eine interessanter Entscheidung getroffen 1. Das Setzen...
Mehr lesenDetailsMit Urteil vom 27. Januar 2026 (KZR 10/25) hat der Kartellsenat des Bundesgerichtshofs eine Patentverletzungsklage aus standardessenziellen Patenten (SEP) bestätigt...
Mehr lesenDetails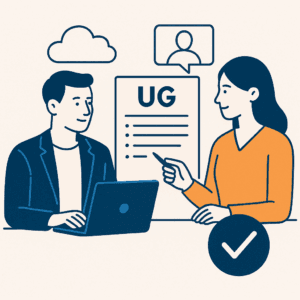 Mustersatzung für eine UG (haftungsbeschränkt)
0,00 €
Mustersatzung für eine UG (haftungsbeschränkt)
0,00 €inkl. MwSt.
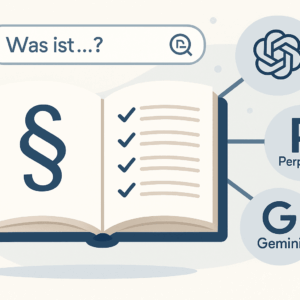 Von der Kanzlei zur KI-Quelle – LLM-SEO für Rechtsanwälte
9,99 €
Von der Kanzlei zur KI-Quelle – LLM-SEO für Rechtsanwälte
9,99 €inkl. MwSt.
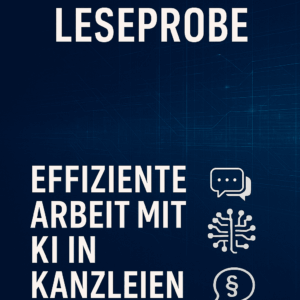 Leseprobe: KI effizient in der Kanzlei nutzen
0,00 €
Leseprobe: KI effizient in der Kanzlei nutzen
0,00 €inkl. MwSt.
 Videoberatung via Microsoft Teams 60 Minuten – Flexibel, unkompliziert und individuell
327,25 €
Videoberatung via Microsoft Teams 60 Minuten – Flexibel, unkompliziert und individuell
327,25 €inkl. MwSt.
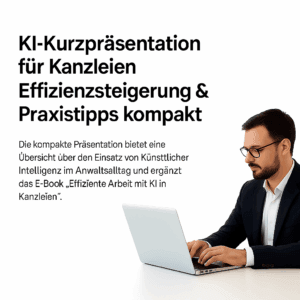 KI-Kurzpräsentation für Kanzleien – Effizienzsteigerung & Praxistipps kompakt
9,99 €
KI-Kurzpräsentation für Kanzleien – Effizienzsteigerung & Praxistipps kompakt
9,99 €inkl. MwSt.
In dieser Episode des Itmedialaw Podcasts nimmt euch Rechtsanwalt und Unternehmer Marian Härtel mit auf eine Reise durch den rechtlichen...
Mehr lesenDetailsIn diesem Video rede ich ein wenig über transparente Abrechnung und wie ich kommuniziere, was es kostet, wenn man mit...
Mehr lesenDetails
















