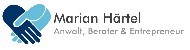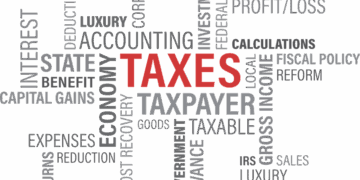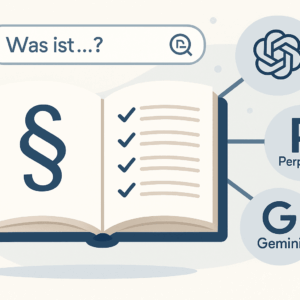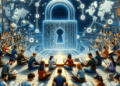Soziale Medien sind für moderne Unternehmen wertvolle Assets geworden. Follower, Profile und Reichweite können über Kundenbeziehungen, Arbeitgeberimage und Marketing-Erfolg entscheiden. Doch wem gehören diese digitalen Güter, wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt? In der Praxis stellt sich zunehmend die Frage: „Wem gehört der LinkedIn-Account nach Kündigung?“ Kann der Mitarbeiter seine Kontakte und Follower einfach „mitnehmen“, oder hat das Unternehmen ein Recht daran? Nachfolgend werden die arbeitsrechtlichen, gesellschaftsrechtlichen und zivilrechtlichen Aspekte dieser Thematik beleuchtet – juristisch fundiert und mit Blick auf praktikable Lösungen für Selbstständige, Startups und wachsende Unternehmen.
Social-Media-Profile im Arbeitsverhältnis – Einordnung und Bedeutung
Social-Media-Accounts im Unternehmen sind heute fester Bestandteil von Marketing und Personalbranding. Mitarbeiter agieren oft als Markenbotschafter – sei es auf LinkedIn für Employer Branding oder auf Instagram für Produktwerbung. Dadurch verschwimmen die Grenzen zwischen privaten Profilen und Unternehmensaccounts. Aus Unternehmenssicht stellt sich die Reichweite eines Mitarbeiters auf Social Media als wirtschaftlicher Wert dar – ein Firmenasset, das man ungern verliert, wenn der Mitarbeiter geht. Aus Sicht des Mitarbeiters hingegen sind Profile und Follower Teil der persönlichen beruflichen Identität. Diese Gemengelage birgt Konfliktpotenzial, das rechtlich nicht eindeutig geklärt ist und deshalb klare Vereinbarungen erfordert.
Rechtsfrage: Wem gehören Accounts, Follower und Kontakte beim Ausscheiden?
Grundsatz: Ohne besondere Vereinbarung gehören persönliche Social-Media-Accounts dem Mitarbeiter. Ob und inwieweit der Arbeitgeber Ansprüche auf den Account oder die darauf befindlichen Kontakte hat, hängt im Wesentlichen von der Nutzung und Zuordnung des Accounts ab. Die Rechtsprechung unterscheidet dabei grundsätzlich drei Fallgruppen:
- (1) Echte Unternehmensaccounts: Diese werden vom Unternehmen eingerichtet, verwaltet und ausschließlich für geschäftliche Zwecke genutzt. Sie laufen typischerweise unter dem Firmennamen oder einer Markenbezeichnung. Hier liegt die Inhaberschaft klar beim Unternehmen. Verfügt ein Mitarbeiter lediglich als Teil seiner Arbeitsaufgaben über die Zugangsdaten, muss er diese bei Ende des Arbeitsverhältnisses herausgeben. Der Arbeitgeber kann die Weiterführung des Accounts verlangen – allerdings nicht unter dem Namen des Mitarbeiters, falls dieser persönlich benannt war.
- (2) Reine Privatprofile: Accounts, die vom Mitarbeiter privat (ggf. schon vor der Anstellung) angelegt wurden, unter eigener E-Mail-Adresse und eigenem Namen laufen und überwiegend private Inhalte enthalten. Solche Profile gehören dem Mitarbeiter. Der Arbeitgeber hat hier kein Herausgaberecht und darf auch nicht ohne Weiteres verlangen, dass der Mitarbeiter dort Unternehmensinhalte postet oder das Profil nach Ausscheiden überlässt. Die privaten Follower „gehören“ dem Mitarbeiter – sie haben bewusst der Person und nicht dem Unternehmen ihre Aufmerksamkeit geschenkt.
- (3) Gemischt genutzte Profile: In der Praxis häufig sind Hybrid-Profile, die auf den Mitarbeiter persönlich laufen, aber während der Anstellung intensiv für Unternehmenszwecke mitgenutzt wurden. Beispielsweise ein LinkedIn-Profil des Mitarbeiters, das stark mit Inhalten des Arbeitgebers bespielt wurde, oder ein Instagram-Account, den der Mitarbeiter teils privat, teils für Firmenmarketing verwendet. Diese Fälle sind rechtlich am schwierigsten einzuordnen. Hier kommt es auf eine Gesamtbetrachtung aller Umstände an.
Wem im Einzelfall der Account zuzuordnen ist, beurteilt sich nach Indizien. Die Gerichte ziehen u.a. folgende Kriterien heran (vgl. AG Brandenburg, Urt. v. 31.01.2018 – 31 C 212/17):
- Zeitpunkt und Anlass der Erstellung: Wurde der Account explizit im Auftrag des Unternehmens während des Arbeitsverhältnisses angelegt, oder bestand er schon vorher als privates Profil?
- Registrierungsdaten: Unter wessen Namen läuft der Account und mit welcher E-Mail-Adresse ist er verknüpft? (Privatadresse des Mitarbeiters vs. Firmenadresse)
- Profilgestaltung: Ist im Profil erkennbar, dass es dem Unternehmen dient? (Z.B. Verwendung des Firmennamens, Firmenlogo, Angabe des Unternehmens in der Bio/Impressum, Link zur Unternehmenswebsite)
- Inhaltliche Nutzung: Werden überwiegend geschäftliche Inhalte, Arbeitgeberkampagnen, Produktwerbung etc. gepostet oder handelt es sich vorwiegend um persönliche Posts? Sind Follower hauptsächlich Kunden/Branchennetzwerk oder privates Umfeld?
- Zugriffsrechte: Hat nur der Mitarbeiter selbst Zugang (alleinige Adminrechte, persönliches Passwort) oder haben auch Kollegen/der Arbeitgeber Zugriff auf den Account? Ist der Account in unternehmensinterne Tools eingebunden?
- Kosten und Ressourcen: Trägt der Arbeitgeber Kosten für den Account (z.B. bei kostenpflichtigen Premium-Accounts oder gesponserten Posts)? Stellt das Unternehmen personelle oder finanzielle Ressourcen bereit, um den Account aufzubauen (z.B. Content-Erstellung, Marketing-Budget)?
- Nutzungsbedingungen der Plattform: Lassen die AGB des sozialen Netzwerks überhaupt die Übertragung von Accounts oder eine Firmennutzung persönlicher Accounts zu? (Viele Plattformen wie LinkedIn schreiben vor, dass persönliche Profile personengebunden und nicht übertragbar sind.)
Anhand solcher Kriterien wird im Streitfall geprüft, ob ein Profil eher dem betrieblichen Bereich oder der Privatsphäre zuzuordnen ist. Ein überwiegend geschäftlich genutztes und vom Arbeitgeber mitgeprägtes Profil könnte als im Rahmen der Anstellung erlangt angesehen werden. Dann käme analog § 667 BGB ein Herausgabeanspruch in Betracht – der Mitarbeiter müsste dem Arbeitgeber alles herausgeben, was er aus der Tätigkeit erlangt hat (hier: Zugang zum Account bzw. zumindest die geschäftlichen Kontaktinformationen). Ist das Profil hingegen erkennbar persönlicher Natur, überwiegen die privaten Züge und der Mitarbeiter behält die Kontrolle.
Die Gerichte betonen, dass diese Abgrenzung eine Frage des Einzelfalls ist. Im Zweifel erfolgt die Zuordnung eher zugunsten des Mitarbeiters, wenn keine eindeutige Firmenbindung vorliegt. So hat z.B. das Amtsgericht Brandenburg entschieden, dass ein Arbeitgeber keinen Anspruch auf die Facebook-Seite eines ehemaligen Mitarbeiters hat, wenn diese dem Unternehmen nicht eindeutig zuzuordnen ist (AG Brandenburg, Urt. v. 31.01.2018 – 31 C 212/17). Im betreffenden Fall lief die Seite unter dem Namen des Mitarbeiters und war mit seiner privaten E-Mail registriert; sie enthielt auch private Posts. Zwar war im Info-Bereich ein Link zur Firmenseite und das Impressum des Arbeitgebers angegeben, doch allein daraus – so das Gericht – ergab sich noch keine eindeutige Eigentümerstellung des Unternehmens. Das Vorhandensein eines Firmen-Impressums sei nur eines von mehreren Indizien, aber nicht ausschlaggebend, solange der Account insgesamt einen gemischt privaten Charakter hatte. Der Mitarbeiter durfte die Facebook-Seite behalten.
Umgekehrt gilt: Hätte der Mitarbeiter das Profil auf Anweisung der Firma mit Unternehmensdaten erstellt, z.B. unter Verwendung einer Firmenadresse oder ausschließlich für dienstliche Posts, lägen die Indizien eher für einen Firmenaccount. Dann könnte der Arbeitgeber die Herausgabe der Account-Zugangsdaten verlangen. Allerdings – und das ist wichtig – kann der Arbeitgeber nie verlangen, dass ein Account unter dem Namen des Mitarbeiters weitergeführt wird. Das heißt: selbst wenn der Arbeitgeber Zugang bekommt, dürfte er das Profil nicht einfach weiterbetreiben, als wäre er die Person. In der Praxis würde ein übernommener Account dann entweder stillgelegt oder in einen offiziellen Firmenaccount umgewandelt werden müssen. Dies ergibt sich daraus, dass persönliche Profile in sozialen Netzwerken personengebunden sind und eine Weiterführung unter falscher Identität gegen die Nutzungsbedingungen und Persönlichkeitsrechte verstoßen würde.
Rechtliche Grundlagen: Arbeitsrechtliche Pflichten vs. Persönliche Rechte
Die Nutzung von Social Media im Job berührt diverse Rechtsbereiche. Im Arbeitsrecht gilt grundsätzlich: Der Arbeitnehmer schuldet dem Arbeitgeber nach § 611a BGB seine Arbeitsleistung und hat Treuepflichten gegenüber dem Arbeitgeber. Dazu gehört, Unternehmensinteressen nicht zu schädigen und Geschäftsgeheimnisse zu wahren (§ 17 UWG). Gleichzeitig hat der Arbeitnehmer Persönlichkeitsrechte und ein Recht auf eine private Sphäre – auch im digitalen Raum.
Während des Arbeitsverhältnisses unterliegt die Social-Media-Nutzung gewissen Grenzen: Der Mitarbeiter darf z.B. nicht vertrauliche Unternehmensinformationen unbefugt posten und muss sich loyal verhalten. Ein klassisches Beispiel ist ein Fall des Arbeitsgerichts Düsseldorf, in dem eine Auszubildende, die sich krankgemeldet hatte, auf Facebook einen Urlaubsgruß postete („Ab zum Arzt und dann Koffer packen!“). Das ArbG Düsseldorf wertete dies als erhebliche Verletzung der arbeitsvertraglichen Loyalitätspflicht – es rechtfertigte eine fristlose Kündigung (ArbG Düsseldorf, Urt. v. 25.08.2011 – 7 Ca 2591/11). Dieser Fall zeigt, dass Äußerungen und Verhalten auf Social Media durchaus arbeitsrechtliche Konsequenzen haben können.
Übertragen auf die Account-Thematik bedeutet Loyalitätspflicht: Solange das Arbeitsverhältnis besteht, darf der Arbeitnehmer betriebliche Social-Media-Kanäle nicht zu eigenmächtigen Zwecken missbrauchen. Ein Mitarbeiter, der z.B. einen vom Unternehmen bereitgestellten Account verwaltet, muss diesen im Sinne des Arbeitgebers führen und darf Follower-Daten nicht heimlich für sich umleiten. Nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses endet die allgemeine Loyalitätspflicht allerdings – dann greifen nur noch nachvertragliche Pflichten wie Verschwiegenheit oder vereinbarte Wettbewerbsverbote.
Zivilrechtlich stellt sich die Frage, ob ein Social-Media-Account oder die Followerliste als „Eigentum“ oder ein geschütztes Rechtsgut des Unternehmens angesehen werden können. Klassisches Eigentum (Sachenrecht) scheidet mangels körperlicher Sache aus. Denkbar ist aber ein Schutz als sonstiges Recht im Sinne von § 823 Abs. 1 BGB: beispielsweise könnte ein etabliertes Unternehmensprofil als Ausprägung des Firmenpersönlichkeitsrechts oder als geschütztes Rechtsgut betrachtet werden. Bisher neigt die Rechtsprechung jedoch dazu, Social-Media-Accounts primär vertragsrechtlich und über Wettbewerbsrecht zu lösen, statt sie als eigenständiges absolutes Recht einzuordnen.
Wenn ein Mitarbeiter beim Ausscheiden geschäftliche Kontakte oder Follower „mitnimmt“, prüft man oft § 17 UWG (Verrat von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen) bzw. seit 2019 das Geschäftsgeheimnisgesetz. Eine Liste von Kundenkontakten, die ein Mitarbeiter exportiert, kann ein Geschäftsgeheimnis sein. Bei öffentlich einsehbaren Social-Media-Kontakten ist dies jedoch zweifelhaft, da sie eben nicht geheim sind. Kontakte auf LinkedIn oder XING sind in der Regel öffentlich Teil des Netzwerks – ihr „Mitnehmen“ ist kaum zu verhindern, weil das Netzwerk ja dem Kontakt selbst ebenfalls zugänglich ist. Daten wie private Notizen über Kunden, die nicht öffentlich sind, genießen dagegen Geheimnisschutz. Entwendet der Mitarbeiter etwa interne CRM-Daten oder nutzt vertrauliche Kontaktinfos aus dem Account für seinen neuen Arbeitgeber, kann das einen UWG-Verstoß darstellen. Hier muss der frühere Arbeitgeber aber den Geheimnischarakter und die unbefugte Nutzung nachweisen.
§ 667 BGB analog spielt – wie oben erwähnt – eine zentrale Rolle: Diese Norm verpflichtet Beauftragte, alles Herauszugeben, was sie aus der Geschäftsbesorgung erlangt haben. Im Arbeitsverhältnis wird § 667 BGB zwar nicht direkt, aber analog angewandt, um Herausgabeansprüche herzuleiten. Wenn also argumentiert werden kann, dass der Social-Media-Account oder zumindest die darauf gespeicherten Geschäftskontakte „im Rahmen der Anstellung erlangt“ wurden, dann muss der Arbeitnehmer sie herausgeben. Genau dies ist regelmäßig umstritten. Die Beweislast liegt beim Arbeitgeber: Er muss darlegen, dass und welche Kontakte über den Account gerade aufgrund der arbeitsvertraglichen Tätigkeit zustande kamen und dem Geschäft des Arbeitgebers zuzuordnen sind.
Die Hürden hierfür sind hoch. Ein bekanntes Beispiel ist das Arbeitsgericht Hamburg, das 2013 über XING-Kontakte einer Mitarbeiterin zu befinden hatte. Die Arbeitgeberin verlangte die Löschung bzw. Herausgabe dieser Kontakte nach Kündigung. Das ArbG Hamburg (Urt. v. 24.01.2013 – Az. 29 Ga 2/13) entschied jedoch, dass kein Herausgabeanspruch besteht, weil der Arbeitgeber nicht beweisen konnte, dass die Kontakte „gerade im Rahmen der arbeitsvertraglich geschuldeten Tätigkeit“ entstanden sind. Die Richter stellten klar: Eine bloße geschäftliche Gelegenheit oder die Tatsache, dass die Person während der Anstellung geknüpft wurde, reicht nicht. Es müsste gezeigt werden, dass die Kontaktaufnahme selbst Teil der Arbeitspflicht war und im Auftrag des Arbeitgebers erfolgte – was im sozialen Netzwerk schwer differenzierbar ist. Zudem lehnte das Gericht eine Beweiserleichterung für den Arbeitgeber ab: Der Mitarbeiter muss nicht von sich aus darlegen, ob ein Kontakt privat oder geschäftlich ist; die volle Darlegungslast liegt beim Arbeitgeber. Dieser Präzedenzfall verdeutlicht, warum Unternehmen vor Gericht oft leer ausgehen, wenn sie nachträglich „ihre“ Follower oder Kontakte zurückverlangen möchten.
Zusätzlich sind datenschutzrechtliche Aspekte zu beachten: Social-Media-Kontakte sind personenbezogene Daten. Würde ein Arbeitgeber verlangen, dass der Mitarbeiter ihm z.B. die Liste seiner LinkedIn-Kontakte übergibt, bewegt man sich schnell im Bereich der DSGVO. Die betroffenen Kontakte/Follower haben dem Unternehmen ihre Daten nicht direkt zur Verfügung gestellt – sie folgten der Person. Eine Übertragung dieser Daten ohne Einwilligung könnte datenschutzwidrig sein. Außerdem kennen Arbeitgeber bei rein privaten Accounts die Zugangsdaten oft gar nicht, was eine Herausgabe praktisch erschwert.
Gesellschaftsrechtlich stellt sich bei Social-Media-Accounts vor allem für Startups und Unternehmen die Frage, wie diese immateriellen Werte in der Unternehmenssphäre gehalten werden können. Ein Social-Media-Account kann Teil des Firmenwerts sein (Stichwort: Goodwill, Reichweite). Wird z.B. ein Unternehmen verkauft, möchte der Käufer die Social-Media-Präsenzen übernehmen. Befinden sich diese jedoch auf persönliche Mitarbeiter-Accounts, stehen sie dem Unternehmen im Zweifel nicht zu. Daher ist es in gesellschaftsrechtlicher Hinsicht ratsam, wichtige Social-Media-Kanäle als Gesellschaftsvermögen zu behandeln – etwa indem offizielle Accounts geschaffen werden, die auf die Firma laufen. Geschäftsführern und Mitarbeitern als Organwaltern obliegt zudem eine Pflicht, Firmenvermögen zu schützen. Man könnte argumentieren, dass ein Geschäftsführer, der die Firmenpräsenz allein über sein privates Profil laufen lässt, gegen seine Sorgfaltspflicht nach § 43 GmbHG (bzw. § 93 AktG für Vorstände) verstößt, weil er das Unternehmen in eine abhängige Position bringt. Auch unter Gesellschaftern kann die Frage aufkommen, wem die Follower „gehören“, insbesondere wenn ein Gründer mit großer persönlicher Marke ausscheidet. Klare Absprachen im Gesellschaftsvertrag oder in Gesellschaftervereinbarungen sollten solche Fälle berücksichtigen.
Nicht zuletzt kann das Thema auch wettbewerbsrechtliche Folgen haben. Wechselt ein Mitarbeiter zur Konkurrenz und nutzt seine Social-Media-Kontakte, um Kunden abzuwerben, bewegt er sich im Grenzbereich zur unlauteren Abwerbung. Ohne vertragliches Wettbewerbsverbot ist ein moderater Kundenwechsel legal – gezieltes Abwerben unter Ausnutzung von im alten Job erworbenen Kenntnissen kann aber unter § 823 Abs. 1 BGB (Verletzung des Rechts am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb) oder § 17 UWG fallen. Hier gibt es Überschneidungen mit der Frage der Follower: Die schiere Tatsache, dass ein Mitarbeiter seine Follower im neuen Job weiter „mitnimmt“, kann das alte Unternehmen kaum verhindern. Was es verhindern kann, ist, dass der Mitarbeiter dabei geschützte Geschäftsgeheimnisse oder unlautere Mittel einsetzt (etwa irreführende Aussagen, wer der Ansprechpartner ist). In der Praxis sind solche Fälle schwer nachzuweisen – auch deshalb geht der Trend hin zu vertraglichen Regelungen und Policies, die vorab Klarheit schaffen.
Unternehmensaccount, Mischprofil oder Privatkonto? – Abgrenzung in der Praxis
Hier ist der korrigierte Abschnitt mit angepasster Formatierung und aktualisierten Rechtsgrundlagen:
Unternehmensaccount, Mischprofil oder Privatkonto? – Abgrenzung in der Praxis
Da die Rechtsfolgen stark von der Account-Einordnung abhängen, ist eine klare Abgrenzung zwischen Unternehmensaccount und persönlichem Profil im Alltag essenziell. Einige typische Konstellationen sollen hier deutlich voneinander getrennt werden:
Unternehmensaccount: Ein Profil, das offiziell im Namen des Unternehmens auftritt. Beispiele sind etwa die Firmen-Facebook-Seite, ein Twitter-Account mit Firmenlogo, ein LinkedIn-Unternehmensprofil oder ein Corporate Instagram-Account. Solche Accounts werden typischerweise von der Marketingabteilung oder einem Social-Media-Team betreut, häufig mit wechselnden Administratoren. Rechtlich gehört ein solcher Account zweifelsfrei dem Unternehmen. Bei Mitarbeiterwechseln gibt es hier selten Streit, da die Zugangsdaten grundsätzlich intern verbleiben und der Account nahtlos fortgeführt wird. Wichtig: Es sollte stets dafür gesorgt werden, dass mehrere berechtigte Personen Zugang zu den Accounts haben oder die Zugangsdaten zumindest zentral dokumentiert sind. Dadurch wird verhindert, dass ein ausscheidender Einzeladministrator den Account „mitnehmen“ oder blockieren kann. Idealerweise erfolgt die Registrierung ausschließlich über firmeneigene E-Mail-Adressen, niemals über persönliche Adressen einzelner Mitarbeiter.
Privates Profil: Ein Account, den der Mitarbeiter eigenständig und privat führt – sei es unter Klarnamen ohne Bezug zum Arbeitgeber oder auch mit beruflichen Angaben, aber dennoch eigenverantwortlich genutzt. Solche Profile werden ausschließlich vom Mitarbeiter selbst kontrolliert. Arbeitgeber haben auf die private Social-Media-Aktivität ihrer Mitarbeiter nur sehr begrenzten Einfluss. Weder dürfen sie grundsätzlich verbieten, Profile zu besitzen, noch ohne Weiteres Inhalte vorschreiben, solange keine erheblichen betrieblichen Interessen verletzt werden. Nach dem Ausscheiden verbleibt das Profil beim Mitarbeiter, einschließlich sämtlicher Follower. Das Unternehmen besitzt keinerlei Ansprüche daran. Allerdings gilt weiterhin die nachvertragliche Verschwiegenheitspflicht gemäß § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 17 UWG sowie dem Geschäftsgeheimnisgesetz (GeschGehG). Auch herabsetzende Äußerungen (insbesondere Schmähkritik oder üble Nachrede) bleiben selbstverständlich unzulässig.
Gemischt genutztes Profil: Diese Kategorie bildet eine rechtliche Grauzone. Ein typisches Beispiel hierfür sind LinkedIn-Profile von Mitarbeitern, die persönlich auf den Namen der jeweiligen Person laufen, aber während der Beschäftigung systematisch für Zwecke des Unternehmens wie Kundenakquise, Recruiting oder Employer-Branding genutzt wurden. Häufig unterstützen Unternehmen diese Profile aktiv (etwa durch Content-Vorlagen, Social-Media-Schulungen oder finanzielle Anreize), ohne den Account formell als Unternehmensaccount zu kennzeichnen oder zu übernehmen. Ebenfalls betroffen sind Instagram-Profile von Mitarbeitern, die als Influencer auftreten, aber unter eigenem Namen firmenspezifische Inhalte posten. Solche Profile zeigen typischerweise eine Mischung aus privaten und geschäftlichen Posts; die Follower stammen aus persönlichen, geschäftlichen und branchenspezifischen Kreisen.
Für diese Mischfälle existieren bislang keine expliziten gesetzlichen Vorschriften. Die Zuordnung eines Accounts richtet sich daher nach den oben genannten Indizien und wird durch die Rechtsprechung im Einzelfall entschieden. Besonders Startups und kleine Unternehmen, die intensiv auf Personal Branding setzen, laufen Gefahr, dass solche Hybrid-Profile entstehen. Sie profitieren einerseits von der Reichweite der Mitarbeiterprofile, riskieren andererseits aber den Verlust dieser Reichweite bei einem Mitarbeiterwechsel. Gerichte tendieren in solchen Fällen eher dazu, den persönlichen Charakter des Accounts hervorzuheben, sofern keine eindeutige vertragliche Vereinbarung getroffen wurde. Social-Media-Accounts sind grundsätzlich personengebunden (insbesondere bei LinkedIn, XING, Facebook und Instagram – mit Ausnahme bestimmter Plattformen wie Twitter, auf denen Gruppen- oder Pseudonymaccounts üblich sind).
Das bedeutet in der Praxis: Follower folgen primär der Person. Selbst wenn diese Person hauptsächlich Inhalte im Zusammenhang mit dem Unternehmen postet, besteht die Bindung der Follower überwiegend an dem individuellen Profil. Somit spricht auch das Argument der persönlichen Beziehung dafür, dass eine einfache Übertragung des Profils auf das Unternehmen nach Kündigung nicht rechtmäßig ist. Dieses Argument besitzt zudem datenschutzrechtliche und wettbewerbsrechtliche Implikationen, da Follower nicht plötzlich durch einen anderen Betreiber betreut werden dürfen, dem sie ursprünglich nicht folgen wollten.
Diese Sichtweise wird durch Gerichtsentscheidungen untermauert. Beispielsweise entschied das ArbG Hamburg in einem prominenten Fall, dass XING-Kontakte eines Mitarbeiters auf seinem persönlichen Profil nicht automatisch an den Arbeitgeber herauszugeben sind. Ähnliche Zurückhaltung ist bei zukünftigen Entscheidungen über LinkedIn-Kontakte zu erwarten.
Ein weiterer wichtiger rechtlicher Aspekt betrifft die Impressumspflicht und Kennzeichnungspflichten. Seit dem 1. Dezember 2021 gilt nicht mehr das Telemediengesetz (TMG), sondern das neue Telekommunikation-Telemedien-Datenschutzgesetz (TTDSG) in Verbindung mit § 18 Abs. 1 Medienstaatsvertrag (MStV). Demnach besteht eine Impressumspflicht weiterhin für geschäftsmäßig betriebene Telemedien. Viele Mitarbeiter fügen vorsichtshalber das Impressum ihres Arbeitgebers ein, wenn geschäftliche Posts veröffentlicht werden. Das allein führt jedoch nach der überwiegenden Auffassung nicht automatisch dazu, dass der Account zu einem offiziellen Unternehmensaccount wird. Die Impressumspflicht dient vorrangig der rechtlichen Absicherung der geschäftlichen Kommunikation. Allerdings könnte ein deutlich hervorgehobenes Unternehmensimpressum ein Indiz für eine geschäftliche Zuordnung darstellen, wie etwa das Amtsgericht Brandenburg (Az. 31 C 212/17) festgestellt hat – allerdings allein nicht ausreichend zur eindeutigen Zuordnung des Profils.
Kurz gesagt: Ohne klare vertragliche Vereinbarungen bleibt ein Mischprofil juristisch schwierig einzuordnen, wobei die Rechtsprechung im Zweifel dazu neigt, es dem persönlichen Eigentum des Mitarbeiters zuzuschreiben. Unternehmen sollten daher solche Situationen gar nicht erst entstehen lassen und entsprechende vertragliche oder interne Regelungen treffen.
Spezialfall 1: LinkedIn-Accounts und Employer Branding
LinkedIn (und in Deutschland früher auch XING) sind berufliche Netzwerke, in denen professionelle Kontakte geknüpft werden. Unternehmen wünschen sich hier eine starke Präsenz – sowohl über offizielle Unternehmensseiten als auch über die Profile ihrer Mitarbeiter. Besonders Mitarbeiter mit Kundenkontakt oder solche in PR/HR-Funktionen werden ermutigt, als Aushängeschild des Unternehmens aufzutreten. Kampagnen wie „Mitarbeiter teilen Unternehmensbeiträge“ oder persönliches Netzwerken im Auftrag der Firma sind üblich.
Doch was passiert mit so einem LinkedIn-Profil nach dem Mitarbeiterwechsel? Per Richtlinie von LinkedIn gehört ein persönliches Profil immer der Person und ist nicht übertragbar. Das Unternehmen kann also technisch nicht einfach das Profil übernehmen. Wenn ein Mitarbeiter mit vielen Branchenkontakten kündigt, „nimmt er die LinkedIn-Kontakte mit“ – sie bleiben in seinem Account. Das Unternehmen verliert möglicherweise einen wertvollen Netzwerkschatz. Rechtlich gibt es kaum Mittel, das zu verhindern, solange es ein persönliches Profil war.
Zu beachten ist: LinkedIn-Kontakte sind wechselseitig, d.h. auch das Unternehmen (über andere Mitarbeiter oder eine CRM-Datenbank) kennt im Idealfall diese Personen. Es empfiehlt sich daher, geschäftliche Kontakte nicht ausschließlich auf LinkedIn zu belassen, sondern sie parallel in unternehmenseigenen Systemen zu erfassen. Dann hat der Arbeitgeber zumindest Zugriff auf die Kontaktdaten, auch wenn der Social-Media-Link über den Mitarbeiter verloren geht. (Diese Praxis wurde z.B. von Tatjana Hahn in einer Veröffentlichung als sinnvoll empfohlen, um Konflikte bei Kündigung zu entschärfen.)
In Fällen, wo der LinkedIn-Account stark durch den Arbeitgeber geprägt wurde – etwa der Mitarbeiter hat den Account erst auf Arbeitsempfehlung erstellt, alle Inhalte wurden vom Marketing gestellt und das Profil ist quasi eine verlängerte Unternehmensseite – könnte man argumentieren, der Account sei ein arbeitgeberfinanziertes Arbeitsmittel. Dennoch bleibt die Person der offizielle Inhaber gegenüber LinkedIn. Ein Arbeitgeber kann höchstens vertraglich vereinbaren, dass der Mitarbeiter bei Austritt bestimmte Dinge tut: z.B. die aktuelle Position im Profil ändert, eventuell bestimmte Kontakte an den Nachfolger meldet, oder dass er für einen gewissen Zeitraum abstimmt, wie er das Netzwerk nutzt (was allerdings schnell ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot darstellen kann, siehe unten).
Die Praxis zeigt: Viele Arbeitgeber verlassen sich darauf, dass ein ausscheidender Mitarbeiter aus freien Stücken seine Verbindungen dem Unternehmen zugutekommen lässt – etwa indem er Kollegen vorstellt oder Kunden informiert, wer neuer Ansprechpartner wird. Rechtlich erzwingen lässt sich das kaum, außer es wurde klar vereinbart. Daher sollten Arbeitgeber, die LinkedIn gezielt fürs Business nutzen, von Anfang an entscheiden: Setzt man auf Personal-Profile oder offizielle Kanäle? Eine Lösung kann sein, parallel eine LinkedIn-Unternehmensseite aufzubauen, wo Follower gezielt der Firma folgen unabhängig von einzelnen Personen. Zudem können Team-Accounts (z.B. ein Account „Mitarbeiter Vorname von Firma XY“) genutzt werden, wobei das strenggenommen gegen LinkedIn-Richtlinien verstößt, da ein Account immer eine echte Person repräsentieren soll.
Employer Branding über Mitarbeiter-Profile ist ein zweischneidiges Schwert. Einerseits authentisch und effektiv, andererseits rechtlich unsicher für die Firma. Die Empfehlung lautet meist: Vertragliche Klarheit schaffen, wenn solche Strategien angewandt werden. (Dazu unten mehr unter Handlungsempfehlungen.)
Spezialfall 2: Instagram-Influencer im Unternehmen
Auf Instagram und vergleichbaren Plattformen steht oft die Personality im Vordergrund. Unternehmen kooperieren gerne mit Influencern – teilweise bauen sie auch eigene Mitarbeiter zu Influencern auf, um z.B. jüngere Zielgruppen anzusprechen. Beispiel: Eine Marketing-Mitarbeiterin führt auf Instagram einen Lifestyle-Kanal, auf dem sie gelegentlich auch Produkte oder Einblicke aus ihrer Firma teilt. Die Firma unterstützt sie vielleicht, indem sie professionelles Fotoequipment zur Verfügung stellt, Inhalte liefert oder die Reichweite boostet (etwa durch Verlinkung auf dem offiziellen Firmenaccount).
Auch hier gilt: Wenn es der persönliche Account der Mitarbeiterin ist, der nur „auch“ fürs Unternehmen wirbt, dann behält sie im Zweifel bei Ausscheiden den Account und alle Follower. Selbst wenn das Unternehmen erheblich zum Wachstum beigetragen hat (etwa durch Werbeschaltungen, Shoutouts oder finanzielle Förderung), entsteht daraus kein Eigentumsrecht am Account. Das Investment des Arbeitgebers war dann eher Marketingaufwand, der im Worst Case mit dem Abgang der Person verpufft. Dieses Risiko sollten Firmen einkalkulieren, wenn sie solche Personal Branding Strategien fahren.
Umgekehrt sollten Mitarbeiter, die ihren privaten Kanal mit Arbeitgeberinhalten anreichern, sich bewusst sein, dass Rechtsfragen wie Impressumspflicht, Werbekennzeichnung und Urheberrechte hier relevant sind. Wer etwa Unternehmensfotos postet, benötigt die Rechte daran, oder der Arbeitgeber muss es genehmigen. Solche Fragen sollten idealerweise in einer Social-Media-Policy geregelt sein.
Falls der Instagram-Account formal als Unternehmenskanal geführt wird (z.B. er heißt @firma_xyz und der Mitarbeiter ist nur Administrator), dann ist es kein persönlicher Account und gehört klar der Firma. Oft aber nutzen Unternehmen lieber offizielle Accounts für Marken und lassen private Mitarbeiter-Accounts freiwillig ergänzen. Die Grenze zwischen privat und dienstlich verschwimmt insbesondere, wenn Firmeninhalte auf private Accounts geteilt werden. Eine mögliche Lösung: Unternehmen können auf vertraglicher Basis verlangen, dass im Profil kenntlich gemacht wird, dass der Account privat ist („Meinungen sind meine eigenen“ o.ä.), um nicht den Eindruck eines offiziellen Kanals zu erwecken.
Zusammengefasst: Instagram-Accounts, die persönlich geführt, aber mit Unternehmensressourcen aufgebaut wurden, sind ohne spezielle Abrede weiterhin persönliche Accounts. Die Firma kann allenfalls moralischen oder markenrechtlichen Einfluss nehmen (dazu gleich mehr), aber keine Übertragung erzwingen. Daher sollte ein Unternehmen sich gut überlegen, wie viel Ressourcen es in etwas steckt, das es rechtlich nicht besitzt. Ggf. ist es sinnvoller, einen eigenen Unternehmens-Instagram zu pushen, auf dem Mitarbeiter dann offiziell zu sehen sind.
Spezialfall 3: Accounts ohne formale Zuordnung (Mitarbeiter als Admin)
In manchen Situationen existieren Social-Media-Präsenzen, die inoffiziell fürs Unternehmen laufen, aber über einen privaten Account administriert werden. Beispiele: Ein begeisterter Mitarbeiter eröffnet aus Eigeninitiative eine Facebook-Gruppe für Kunden des Unternehmens und betreut diese als Admin, ohne dass es einen offiziellen Auftrag gab. Oder ein Mitarbeiter fungiert als einziger Administrator der LinkedIn-Unternehmensseite, die aber offiziell der Firma gehört. Solche Konstellationen sind gefährlich, wenn die Person das Unternehmen verlässt.
- Ist der Account eigentlich dem Unternehmen zuzurechnen, aber nur „inoffiziell“ entstanden? Dann sollte das Unternehmen spätestens bei Ausscheiden die Kontrolle übernehmen. Wenn vorher nichts geregelt wurde, kann es schwierig werden: Der Mitarbeiter hat ihn zwar fürs Unternehmen betrieben, aber vielleicht auf seinen Namen registriert. Hier kann das Unternehmen nur über Ansprüche aus Geschäftsführung ohne Auftrag oder konkludente Vereinbarungen argumentieren, dass dem Mitarbeiter klar sein musste, dass der Account der Firma zusteht. Oft wird man sich gütlich einigen müssen. Es empfiehlt sich dringend, solche inoffiziellen Kanäle frühzeitig zu formalisieren, z.B. indem weitere Admins (Vorgesetzte) hinzugefügt werden oder die Registrierung auf eine Firmenadresse umgestellt wird.
- Bei offiziellen Unternehmensseiten mit nur einem Admin-Mitarbeiter ist die Lage klarer: Die Seite gehört der Firma, der Admin-Zugang ist quasi ein „Betriebsmittel“. Hier sollte die Personalabteilung oder IT-Abteilung vor dem letzten Arbeitstag dafür sorgen, dass Admin-Rechte umgeschichtet werden. Das Versäumnis, rechtzeitig für Ersatz-Admins zu sorgen, kann böse enden – im schlimmsten Fall kann ein frustrierter Ex-Mitarbeiter den Account sperren oder schädigen. Technisch bieten Plattformen wie Facebook und LinkedIn die Möglichkeit, mehrere Administratoren einzusetzen; diese Option sollte immer genutzt werden (Prinzip der Vier-Augen-Kontrolle bei Social Media).
- Marken- und Namensrechte: Wenn ein Mitarbeiter als Admin einen Account betreut, der den Unternehmensnamen oder Marken enthält, hat das Unternehmen aus markenrechtlicher Sicht ein starkes Druckmittel. Ein Account, der z.B. den Firmennamen trägt, darf nach Ausscheiden des Admins von diesem nicht weiter unter dem Namen betrieben werden, weil das eine unberechtigte Marken- bzw. Namensnutzung wäre. In solchen Fällen kann notfalls per Unterlassungsanspruch nach § 12 BGB (Namensrecht) oder Markengesetz gegen den Ex-Mitarbeiter vorgegangen werden, um die weitere Nutzung des Unternehmensnamens im Account zu untersagen. Das führt praktisch dazu, dass der Account entweder an die Firma herausgegeben oder gelöscht werden muss. Dieses Szenario tritt insbesondere dann auf, wenn kein klarer Eigentümer benannt war. Daher: Schon während der Anstellung sollte jeder Account mit Firmenbezug einen sauberen Impressums- oder Profilhinweis haben, wem er gehört, um späteren Streit zu vermeiden.
Fazit zu gemischten und inoffiziellen Accounts: Je unklarer die Verhältnisse, desto eher droht Konflikt. Im Zweifel gilt: Hat der Mitarbeiter den Account unter eigenem Namen und eigenem Zugriff, steht er erst einmal in seiner Verfügungsgewalt. Das Unternehmen muss dann mit rechtlichen Hebeln oder Verhandlungen an seine Assets kommen. Die besten Hebel hat man, wenn der Account offensichtlich ein Unternehmens-Account ist (Name/Marke) – dann greifen Markenrecht und Wettbewerbsrecht. Ist das nicht der Fall, hilft oft nur Überzeugung oder Vertrag.
Konfliktvermeidung durch klare Richtlinien und Verträge
Angesichts der geschilderten Unsicherheiten ist der beste Rat: Konflikte um Social-Media-Accounts proaktiv vermeiden. Unternehmen sollten nicht erst bei der Kündigung eines Mitarbeiters darüber nachdenken, wem Follower und Accounts gehören, sondern frühzeitig intern Regeln aufstellen. Folgende Maßnahmen bieten sich an:
Social-Media-Policies und Guidelines
Ein guter erster Schritt ist eine Social-Media-Richtlinie im Unternehmen. Darin kann festgelegt werden:
- Welche Arten von Social-Media-Accounts gibt es im Zusammenhang mit dem Unternehmen (z.B. offizielle Firmenaccounts, projektbezogene Accounts, persönliche Accounts von Mitarbeitern mit/ohne Unternehmensbezug)?
- Wie sind diese Accounts gekennzeichnet und wer darf sie erstellen?
- Wem „gehören“ die Inhalte und Kontakte dort? (Auch wenn rechtlich nicht bindend, schafft eine klare Ansage zumindest ein Einverständnis, an dem man sich orientieren kann.)
- Wie ist mit gemischten Profilen umzugehen? Z.B. Empfehlung, berufliche und private Inhalte möglichst zu trennen. Oder Vorgabe, dass geschäftliche Inhalte nur über freigegebene Kanäle gepostet werden.
- Was passiert bei Austritt eines Mitarbeiters? Etwa: Verpflichtung, Administratorrechte abzugeben, Firmen-Logos aus dem privaten Profil zu entfernen, in der Bio kenntlich zu machen, dass man nicht mehr bei Firma XYZ ist etc.
- Umgang mit Zugangsdaten: Es sollte geregelt sein, dass sämtliche Accounts mit Firmenbezug dokumentiert werden. Passwörter von Unternehmensaccounts müssen dem Arbeitgeber bekannt sein. Bei persönlichen Accounts darf der Arbeitgeber das natürlich nicht verlangen, aber dann sollte klargestellt sein, dass persönliche Accounts eben offiziell außen vor sind.
Solche Guidelines sollten möglichst konkret sein, damit es im Ernstfall klare Anhaltspunkte gibt. Sie können auch Hinweise zur Netiquette und Complianceregeln enthalten (z.B. Verbot, betriebsinterne Probleme öffentlich auszubreiten). Wichtig ist, diese Regeln allen Mitarbeitern bekannt zu machen und idealerweise von ihnen bestätigen zu lassen (z.B. als Anlage zum Arbeitsvertrag oder per Betriebsvereinbarung).
Arbeitsvertragliche Regelungen
Noch wirksamer ist es, verbindliche Vertragsklauseln einzuführen. Im Arbeitsvertrag von Mitarbeitern, die im Social-Media-Bereich tätig sind oder wo klar ist, dass sie ihre Profile dienstlich nutzen, sollten spezifische Regelungen stehen:
- Zuordnung von Accounts: Etwa: „Social-Media-Accounts, die ausschließlich oder überwiegend für dienstliche Aufgaben genutzt werden, gelten als Unternehmensaccounts und sind beim Ausscheiden an den Arbeitgeber zu übergeben.“ Oder: „Vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellte Accounts bleiben Eigentum des Arbeitgebers.“
- Mitwirkungspflichten bei Austritt: Z.B. „Der Mitarbeiter verpflichtet sich, beim Ausscheiden dem Arbeitgeber alle geschäftlichen Kontakte, die ausschließlich im Rahmen der Beschäftigung über soziale Netzwerke generiert wurden, in einem gängigen Format zu überlassen und auf seinem persönlichen Account zu löschen.“ – Achtung: Eine solche Pflicht könnte als nachvertragliches Wettbewerbsverbot interpretiert werden, wenn sie effektiv bedeutet, dass der Mitarbeiter diese Kontakte nicht weiter nutzen darf. Nach §§ 74 ff. HGB ist ein Wettbewerbsverbot nur mit Karenzentschädigung wirksam. Deshalb muss die Formulierung wohlüberlegt sein. Eine mildere Variante: „geschäftliche Kontakte sind intern zu dokumentieren und auf Verlangen zu löschen, soweit dem kein berechtigtes eigenes Interesse des Mitarbeiters entgegensteht.“ Dies lässt Raum, ohne strikt zu untersagen, dass der Mitarbeiter die Menschen wiedertreffen darf.
- Kennzeichnungspflichten: Der Vertrag könnte verlangen, dass der Mitarbeiter in sozialen Profilen stets richtig angibt, ob es sich um private oder dienstliche Aussagen handelt, und bei dienstlicher Nutzung bestimmte Disclaimer oder das Impressum einbindet.
- Rückgabe von Zugangsdaten: Ist zwar bei Firmenaccounts selbstverständlich, kann aber ausdrücklich aufgenommen werden, inklusive einer Vertragsstrafe, wenn jemand die Herausgabe verweigert oder Daten löscht.
- Urheber- und Nutzungsrechte: Falls der Mitarbeiter Inhalte (Texte, Bilder, Videos) für Social Media erstellt, sollte geregelt sein, dass diese dem Arbeitgeber zustehen bzw. der Arbeitgeber ein Nutzungsrecht daran hat, auch wenn sie auf dem Mitarbeiterprofil erschienen sind. So kann der Arbeitgeber zumindest die Wiederverwendung sichern, auch wenn der Account wegfällt.
- Wettbewerbs- und Abwerbeverbote: Um zu verhindern, dass ein Mitarbeiter nach dem Weggang die gewonnenen Follower dazu nutzt, Kunden oder Kollegen abzuwerben, kann ein befristetes Abwerbeverbot vereinbart werden. Beispielsweise: „Der Mitarbeiter wird für 12 Monate nach Ausscheiden keine aktiven Versuche unternehmen, Kunden, die über die Unternehmens-Sozialmedia-Kanäle gewonnen wurden, abzuwerben.“ Hier ist auf die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben zu achten – ein generelles Kontaktverbot wäre ein Wettbewerbsverbot und nur mit Entschädigung zulässig. Ein bloßes Abwerbeverbot (Nichtansprechen von Kunden) kann unter gewissen Umständen ohne Entschädigung vereinbart werden, wenn es als Nebenabrede formuliert und zeitlich/bezüglich Kundenkreis begrenzt ist. Dies ist jedoch heikel und sollte individuell rechtskonform ausgestaltet sein.
Bestehende Verträge sollte man dahingehend prüfen, ob es bereits Regelungen gibt. Oft finden sich Klauseln wie „sämtliche Arbeitsmittel und Unterlagen sind zurückzugeben“. Man könnte argumentieren, dass ein vom Arbeitgeber finanzierter Social-Media-Account unter „Arbeitsmittel“ fällt. Aber bei Zweifel sollte man es konkret benennen, da sonst Unklarheit bleibt, ob ein virtueller Account von so einer Klausel erfasst ist.
Einbindung des Betriebsrats
In größeren Unternehmen mit Betriebsrat ist das Thema Social Media auch mitbestimmungspflichtig (§ 87 Abs.1 BetrVG). Insbesondere wenn der Arbeitgeber Richtlinien zur Nutzung aufstellt oder Monitoring betreibt, muss der Betriebsrat zustimmen. Eine Betriebsvereinbarung Social Media kann sinnvoll sein, um den Rahmen festzulegen: etwa wie Arbeitszeit und Social Media, wer offizielle Statements abgeben darf, Richtlinien für private Posts über den Betrieb etc. Im Kontext „Wem gehören die Accounts?“ könnte eine Betriebsvereinbarung z.B. regeln, dass bei unternehmensbezogener Social-Media-Arbeit immer ein offizieller Account zu nutzen ist. Oder, falls private Accounts genutzt werden, wie die Übergabe von Inhalten bei Austritt erfolgen soll. Die Mitbestimmung stellt sicher, dass auch Arbeitnehmerinteressen – wie das Recht auf einen privaten Onlineauftritt – gewahrt bleiben.
Dokumentation und IT-Management
Abseits von formalen Regeln ist eine praktische Maßnahme wichtig: Die IT- oder Kommunikationsabteilung sollte ein Verzeichnis aller relevanten Social-Media-Auftritte führen, inklusive Admins, Zugangsdaten (soweit es Firmenaccounts sind) und Verantwortlichen. So läuft man nicht Gefahr, einen Account zu „verlieren“, nur weil niemand mehr die Zugangsdaten kennt, nachdem der Zuständige gegangen ist.
Zudem kann im Offboarding-Prozess einer Firma ein fester Punkt sein: „Social-Media-Übergabe erledigt? (Ja/Nein)“. Hier wird geprüft, ob der Mitarbeiter aus allen Firmenaccounts ausgetragen ist, ob er alle Unternehmensgeräte (die evtl. verbunden sind) zurückgegeben hat und ob ggf. Beiträge geplant sind, um die Außenwelt zu informieren (z.B. „Mitarbeiter X hat das Unternehmen verlassen, neuer Ansprechpartner ist Y“ – das kann auf der Unternehmensseite oder via Presseinfo geschehen, um die Follower entsprechend umzuziehen).
Sensibilisierung der Mitarbeiter
Last but not least: Aufklärung und Kommunikation. Mitarbeiter (gerade in Startups) denken oft nicht an diese juristischen Konsequenzen, wenn sie im Eifer des Gefechts Social Media für den Arbeitgeber nutzen. Das Unternehmen sollte früh vermitteln, welche Erwartungen und Regeln gelten. Ebenso sollte ein Mitarbeiter, der seine eigenen Kanäle einbringt, wissen, worauf er sich einlässt. Im Idealfall schafft man eine Win-Win-Situation: Der Mitarbeiter stärkt seine Personal Brand, das Unternehmen profitiert – und beide Seiten wissen, wie sie sich fair trennen, wenn es soweit kommt.
Zum Beispiel kann man intern vereinbaren: „Wir fördern deinen LinkedIn-Aufbau (durch Trainings/Budget), dafür erklärst du dich bereit, bei Ausscheiden dein Profil sauber zu übergeben, d.h. Firmenbezug zu entfernen und uns die Kontakte deines Netzwerks für die Übergangszeit zur Verfügung zu stellen.“ Solche Absprachen kann man nicht bis ins Letzte erzwingen, aber eine offene Kultur verhindert böses Blut.
Rechtsprechung: Präzedenzfälle, an denen man sich orientieren kann
Obwohl es noch kein höchstrichterliches Urteil des Bundesarbeitsgerichts oder Bundesgerichtshofs zur Eigentumsfrage von Social-Media-Accounts gibt, haben einige Gerichte wichtige Eckpunkte gesetzt:
- ArbG Hamburg 2013 (XING-Kontakte): Kein Lösch- oder Herausgabeanspruch des Arbeitgebers, weil nicht beweisbar war, dass Kontakte während der Arbeitspflicht entstanden. Arbeitgeber trägt volle Beweislast. -> Quintessenz: Persönliche LinkedIn/XING-Kontakte sind in der Regel beim Mitarbeiter zu belassen, sofern nicht explizit anders vereinbart.
- AG Brandenburg 2018 (Facebook-Seite): Ein Facebook-Account eines Mitarbeiters wurde diesem belassen, da private Registrierung und gemischte Inhalte vorlagen, trotz Firmenlink im Impressum. -> Quintessenz: Mischprofile fallen mangels klarer Abrede tendenziell dem Mitarbeiter zu.
- ArbG Düsseldorf 2011 (Facebook-Post bei Krankmeldung): Mitarbeiter darf nicht durch illoyales Social-Media-Verhalten das Vertrauensverhältnis zerstören; Social Media Posts können arbeitsrechtliche Pflichtverletzungen darstellen. -> Quintessenz: Während des Arbeitsverhältnisses gelten Treuepflichten auch online; jedoch sagt das indirekt auch aus, dass bei loyaler Nutzung persönlicher Accounts kein automatisches Arbeitgeberrecht entsteht.
- ArbG Münster – In jüngerer Zeit befassen sich auch Gerichte wie das ArbG Münster mit Fragen rund um Datenschutz und Social Media (etwa hinsichtlich Veröffentlichung von Mitarbeiterfotos oder DSGVO-Schadensersatz bei unberechtigter Datenverarbeitung auf Social Media). Zwar nicht direkt zur Eigentumsfrage von Accounts, zeigen diese Entscheidungen doch, dass die Gerichte die digitale Sphäre der Arbeitswelt ernst nehmen. Ein Urteil des ArbG Münster aus 2021 etwa verpflichtete einen Arbeitgeber zu 5.000 € Schadensersatz, weil ein Mitarbeiterfoto ohne gültige Einwilligung auf Social Media veröffentlicht wurde (Az. 3 Ca 391/20). -> Quintessenz: Unternehmen müssen im Social-Media-Kontext nicht nur ans Eigentum, sondern auch an Datenschutz und Persönlichkeitsrechte denken, was wiederum dafür spricht, klare Verantwortlichkeiten für Accounts festzulegen.
- OLG Celle 2015 (Haftung für Mitarbeiter-Posting): Das Oberlandesgericht Celle entschied in einem Fall (Beschluss v. 09.11.2015 – Az. 13 U 95/15), dass ein Arbeitgeber (im konkreten Fall das Land als Dienstherr eines Lehrers) für einen Social-Media-Beitrag des Mitarbeiters haftet. Ein Lehrer hatte auf der Schul-Website (als Teil der dienstlichen Tätigkeit) ein urheberrechtswidriges Foto verwendet. Das OLG Celle stellte klar, dass der Arbeitgeber für diesen Verstoß einzustehen hat, da es im Rahmen der Arbeit geschah. -> Übertragbar: Wenn ein Social-Media-Account als Unternehmenskanal anzusehen ist, können Rechtsverstöße des betreuenden Mitarbeiters dem Arbeitgeber zugerechnet werden. Für unsere Fragestellung bedeutet das: Die Inhaberschaft eines Accounts zieht Verantwortung nach sich. Ein Unternehmen sollte also nur dort die Inhaberschaft reklamieren, wo es auch die Kontrolle und Aufsicht ausüben kann. Und umgekehrt: Behält ein Mitarbeiter einen Account allein, trägt er auch allein die Verantwortung dafür in Zukunft.
Diese Beispiele aus der Rechtsprechung unterstreichen die zentrale Botschaft: Ohne klare Zuordnung entstehen Rechtsunsicherheiten, meist zum Nachteil des Arbeitgebers. Es lohnt sich daher, aus diesen Fällen präventive Schlüsse zu ziehen.
Handlungsempfehlungen für Arbeitgeber
Angesichts der vielen Fallstricke hier einige konkrete Empfehlungen, wie Arbeitgeber mit dem Thema „Social Media und Mitarbeiter“ umgehen sollten:
- 1. Klare Verhältnisse schaffen: Definieren Sie für Ihr Unternehmen, welche Social-Media-Präsenzen offiziell sind und welche privat. Kommunizieren Sie diese Abgrenzung an Ihre Mitarbeiter. Zum Beispiel: „LinkedIn-Profile unserer Mitarbeitenden gelten als privat, auch wenn dort die Firmenzugehörigkeit angegeben wird. Offizielle Kommunikation läuft über unser LinkedIn-Company-Page.“ Oder umgekehrt: „Wir erwarten von bestimmten Rollen, dass sie einen berufsbezogenen Account führen, der bei Ausscheiden an uns übergeht“ – letzteres muss aber vertraglich abgesichert sein.
- 2. Social-Media-Policy einführen: Etablieren Sie schriftliche Richtlinien, idealerweise in Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat, die den Umgang mit Social Media regeln. Legen Sie fest, was beim Austritt passiert. So vermeiden Sie Unklarheiten und können im Streitfall darauf verweisen. Eine gute Policy berücksichtigt sowohl Unternehmensinteressen (Schutz von Kontakten, Markenimage) als auch Mitarbeiterinteressen (Recht auf private Meinungsäußerung, Karriereprofil).
- 3. Vertragliche Vereinbarungen: Passen Sie Arbeitsverträge für neue Mitarbeiter an, wenn Social Media Teil der Jobbeschreibung ist. Bei Bestehenden kann man Ergänzungsvereinbarungen treffen (sofern die Mitarbeiter zustimmen) oder zumindest bei Beförderungen/Gehaltsrunden solche Themen mit verhandeln. Besonders Führungskräfte oder Mitarbeiter in Vertrieb/Marketing sollten individuelle Abreden zum Umgang mit Social-Media-Konten haben. Zum Beispiel kann eine Klausel vereinbart werden, dass ein Verkäufer seine LinkedIn-Kontakte bei Austritt an das Unternehmen meldet, damit Kunden informiert werden können. Beachten Sie dabei die Grenzen des Arbeitsrechts (keine überzogene Bindung ohne Kompensation).
- 4. Unternehmensaccounts bevorzugen: Wo immer möglich, setzen Sie auf Firmenaccounts statt Personaccounts. Wenn Sie z.B. ein Blog betreiben wollen, richten Sie einen Unternehmensblog mit wechselnden Autoren ein, statt den Blog auf den persönlichen Account eines Mitarbeiters auszulagern. Gleiches gilt für Twitter: Ein Corporate-Account (ggf. mit dem Namen des Produkts oder Unternehmens) ist safer als der Account „@MitarbeiterXY“, der dann als einziger über Neuigkeiten twittert. Natürlich haben persönliche Accounts oft mehr Charme und Glaubwürdigkeit – aber man muss den Trade-off kennen. Ein Mittelweg kann sein, dass Mitarbeiter zwar persönlich posten, aber immer auf Inhalte verlinken, die auch auf dem Firmenaccount existieren. So bleibt wenigstens der Content beim Unternehmen.
- 5. Zugriffssicherung: Stellen Sie administrativ sicher, dass bei allen relevanten Social-Media-Kanälen Backup-Administratoren eingetragen sind. Niemals sollte ein einzelner Mitarbeiter alleiniger Herr über ein Passwort sein, ohne dass das Unternehmen im Notfall Zugriff hat. Nutzen Sie Passwort-Manager oder zentrale Freigabesysteme. Bei Netzwerken, die nur einen Nutzer zulassen (z.B. ein einzelnes Instagram-Login), bewahren Sie die Zugangsdaten an einem sicheren Ort auf und ändern Sie sie sofort, wenn der betreuende Mitarbeiter geht.
- 6. Schulung und Sensibilisierung: Schulen Sie Ihre Mitarbeiter in den rechtlichen Grundlagen von Social Media im Beruf. Machen Sie ihnen klar, was erlaubt ist und wo Konflikte liegen könnten. Wenn Mitarbeiter verstehen, dass beispielsweise ein XING-Kontakt, den sie im Job knüpfen, aus Sicht des Arbeitgebers ein Kundenkontakt ist, können sie eher nachvollziehen, warum der Arbeitgeber Interesse daran hat. Umgekehrt sollte das Management auch die Perspektive der Mitarbeiter verstehen: Deren Social-Media-Profile sind Teil ihrer beruflichen Identität. Ein respektvoller Umgang mit beiden Interessen ist förderlich.
- 7. Gütliche Einigungen bei Austritt suchen: Wenn ein geschätzter Mitarbeiter das Unternehmen verlässt, sollte man das Thema Social Media im Austrittsgespräch ansprechen. Oft lassen sich einvernehmliche Lösungen finden: Etwa der Mitarbeiter erklärt sich bereit, einen Abschiedspost zu machen, der auf den Unternehmensaccount verweist, oder er teilt eine Zeit lang Inhalte des Nachfolgers, um die Follower „umzuleiten“. Solche Goodwill-Aktionen kann man nicht erzwingen, aber man kann sie vorschlagen. Vielleicht ist auch eine vertragliche Abfindungsregelung denkbar: Im Rahmen eines Aufhebungsvertrags könnte z.B. vereinbart werden, dass der Mitarbeiter für X Monate noch als externer Berater den Firmenaccount betreut oder mit dem Nachfolger gemeinsame Posts macht. Kreative Lösungen können hier beiden Seiten helfen.
- 8. Keine Panik bei Mitarbeiterwechsel: Letztlich sollte ein Unternehmen sich nicht völlig abhängig von den Social-Media-Accounts einzelner Mitarbeiter machen. Mitarbeiter kommen und gehen – und mit ihnen oft auch ein Teil der Reichweite. Das lässt sich nie ganz verhindern (und Top-Leute bringen ja auch ihre Follower mit, wenn sie kommen). Wichtig ist, dass Kundenbeziehungen und Markenbekanntheit nicht allein an einer Person hängen. Pflegen Sie parallel die Unternehmensmarke so, dass Follower dem Unternehmen als Ganzes folgen. Und bauen Sie bei Mitarbeitern auf Team-Präsenz: z.B. mehrere Gesichter des Unternehmens präsentieren, damit nicht alles an einer Personal Brand hängt.
Fazit
Social-Media-Accounts als Firmenasset sind ein zweischneidiges Schwert: Sie sind wertvoll, aber rechtlich schwer zu greifen. Ohne klare vertragliche Basis „gehören“ Follower und Profile in der Regel dem Mitarbeiter, insbesondere bei persönlichen Accounts wie LinkedIn. Unternehmen tun gut daran, diese Realität anzuerkennen und entsprechende Vorkehrungen zu treffen. Durch präventive Regelungen, Social-Media-Guidelines und Bewusstsein bei allen Beteiligten lassen sich Streitfälle weitgehend vermeiden. Ist doch einmal unklar, wem ein Account zusteht, bieten die erwähnten Gerichtsentscheidungen Anhaltspunkte – sie tendieren eher zum Schutz der individuellen Profile, sofern keine eindeutige Unternehmenszuordnung gegeben ist.
Für Selbständige, Startups und wachsende Unternehmen, die stark auf Personal Branding setzen, gilt es, ein gesundes Gleichgewicht zu finden: Einerseits Mitarbeiter als Markenbotschafter wirken lassen und ihren persönlichen Markenaufbau fördern, andererseits die Firmeninteressen durch kluge Strategien absichern. Das bedeutet auch, bei der Trennung fair und konstruktiv zu bleiben. Rechtliche Zwangsmittel sind in diesem Bereich begrenzt wirksam und oft wenig praxisgerecht. Besser ist, es kommt gar nicht zum Streit, weil jeder weiß, woran er ist.
Am Ende entscheidet auch die Professionalität: Ein Unternehmen, das seine Social-Media-Präsenz strategisch managt, wird in den Augen der Öffentlichkeit besser dastehen, als eines, das sich öffentlich mit Ex-Mitarbeitern um Accounts zankt. Mit klarem Konzept, rechtlicher Absicherung und kooperativem Miteinander lassen sich die Fragen „Wem gehört der LinkedIn-Account nach Kündigung?“ oder „Darf der Mitarbeiter Follower mitnehmen?“ so beantworten, dass alle Seiten zufrieden sein können. Das steigert nicht nur die Rechtssicherheit, sondern auch die Attraktivität des Unternehmens für neue Talente – denn im digitalen Zeitalter suchen diese bewusst Arbeitgeber, die modern und fair mit Social Media umgehen.