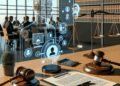- Recht auf Datenübertragbarkeit wurde 2018 mit der DSGVO in der EU etabliert.
- Betroffene Personen können personenbezogene Daten in einem strukturierter, gängigen, und maschinenlesbaren Format erhalten.
- Das Recht umfasst die Übermittlung von Daten an andere Verantwortliche ohne Behinderung.
- Voraussetzungen umfassen Einwilligung und automatisierte Verarbeitung der bereitgestellten Daten.
- Unternehmen müssen Systeme zur Technische Umsetzung der Datenübertragung schaffen.
- Umsetzung stellt technische Komplexität und Sicherheitsanforderungen dar.
- Stärkung der Nutzerrechte und Förderung des Wettbewerbs sind wesentliche Auswirkungen.
Das Recht auf Datenübertragbarkeit ist ein wichtiges Datenschutzrecht, das mit der Einführung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) im Jahr 2018 in der Europäischen Union etabliert wurde. Es gibt betroffenen Personen die Möglichkeit, ihre personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten und diese Daten an einen anderen Verantwortlichen zu übermitteln.
Rechtliche Grundlage
Das Recht auf Datenübertragbarkeit ist in Artikel 20 der DSGVO verankert. Es ergänzt andere Betroffenenrechte wie das Recht auf Auskunft und das Recht auf Löschung und stärkt die Kontrolle der betroffenen Personen über ihre personenbezogenen Daten.
Inhalt und Umfang des Rechts
Das Recht auf Datenübertragbarkeit umfasst mehrere Aspekte:
1. Recht auf Erhalt der Daten: Die betroffene Person hat das Recht, die sie betreffenden personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten.
2. Recht auf Übermittlung: Die betroffene Person hat das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln.
3. Direkte Übermittlung: Soweit technisch machbar, kann die betroffene Person verlangen, dass die personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen einem anderen Verantwortlichen übermittelt werden.
Voraussetzungen für die Ausübung des Rechts
Das Recht auf Datenübertragbarkeit gilt unter folgenden Voraussetzungen:
1. Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage einer Einwilligung oder zur Erfüllung eines Vertrags.
2. Die Verarbeitung erfolgt mithilfe automatisierter Verfahren.
3. Es handelt sich um personenbezogene Daten, die die betroffene Person dem Verantwortlichen bereitgestellt hat.
Umfang der zu übertragenden Daten
Das Recht auf Datenübertragbarkeit erstreckt sich auf:
1. Aktiv und bewusst von der betroffenen Person bereitgestellte Daten (z.B. Name, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum).
2. Beobachtete Daten, die durch die Nutzung eines Dienstes oder Geräts entstehen (z.B. Suchhistorie, Verkehrsdaten, Standortdaten).
Es umfasst jedoch nicht abgeleitete oder erschlossene Daten, die der Verantwortliche auf Basis der bereitgestellten Daten erstellt hat (z.B. Nutzerprofile, Scoring-Ergebnisse).
Bedeutung für Unternehmen
Für Unternehmen, die personenbezogene Daten verarbeiten, hat das Recht auf Datenübertragbarkeit weitreichende Konsequenzen:
1. Technische Umsetzung: Unternehmen müssen ihre Systeme so gestalten, dass sie Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format exportieren können.
2. Prozesse: Es müssen Prozesse implementiert werden, um Anfragen zur Datenübertragbarkeit effizient zu bearbeiten.
3. Datenschutz-Management: Das Recht auf Datenübertragbarkeit muss in das gesamte Datenschutz-Management-System integriert werden.
4. Wettbewerbsaspekte: Die Möglichkeit der einfachen Datenübertragung kann den Wettbewerb zwischen Diensteanbietern verstärken.
Herausforderungen und Grenzen
Die Umsetzung des Rechts auf Datenübertragbarkeit stellt Unternehmen vor verschiedene Herausforderungen:
1. Technische Komplexität: Die Bereitstellung von Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format kann technisch anspruchsvoll sein.
2. Datenschutz und Sicherheit: Bei der Übertragung von Daten müssen hohe Sicherheitsstandards eingehalten werden, um unbefugte Zugriffe zu verhindern.
3. Abgrenzung der Daten: Es kann schwierig sein, zwischen Daten zu unterscheiden, die von der betroffenen Person bereitgestellt wurden, und solchen, die vom Unternehmen abgeleitet wurden.
4. Interoperabilität: Die Übertragbarkeit von Daten zwischen verschiedenen Systemen und Diensten kann durch fehlende Standards erschwert werden.
Bedeutung für die Praxis
Das Recht auf Datenübertragbarkeit hat in der Praxis verschiedene Auswirkungen:
1. Stärkung der Nutzerrechte: Es gibt Nutzern mehr Kontrolle über ihre Daten und erleichtert den Wechsel zwischen verschiedenen Diensteanbietern.
2. Förderung des Wettbewerbs: Durch die erleichterte Übertragbarkeit von Daten wird der Wettbewerb zwischen Diensteanbietern gefördert.
3. Innovationsförderung: Die Möglichkeit, Daten einfach zu übertragen, kann zur Entwicklung neuer Dienste und Geschäftsmodelle führen.
4. Datenschutz by Design: Unternehmen müssen die Datenübertragbarkeit von Anfang an in ihre Systeme und Prozesse integrieren.
Fazit
Das Recht auf Datenübertragbarkeit ist ein wichtiger Baustein im modernen Datenschutzrecht. Es stärkt die Rechte der betroffenen Personen und fördert gleichzeitig den Wettbewerb und die Innovation im digitalen Markt. Für Unternehmen bedeutet es einerseits eine Herausforderung in Bezug auf die technische und organisatorische Umsetzung, andererseits aber auch eine Chance, das Vertrauen der Nutzer zu stärken und neue Geschäftsmodelle zu entwickeln.
Die praktische Umsetzung des Rechts auf Datenübertragbarkeit wird sich in den kommenden Jahren weiter entwickeln. Unternehmen sollten diese Entwicklungen aufmerksam verfolgen und ihre Systeme und Prozesse kontinuierlich anpassen, um den Anforderungen gerecht zu werden und die Chancen zu nutzen, die sich aus der erhöhten Datenmobilität ergeben.