Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Widerklage
Einleitung In Rechtsstreitigkeiten kann es vorkommen, dass nicht nur eine Partei Ansprüche gegen die andere erhebt, sondern auch die beklagte Partei eigene Ansprüche gegen den ...
Einleitung In Rechtsstreitigkeiten kann es vorkommen, dass nicht nur eine Partei Ansprüche gegen die andere erhebt, sondern auch die beklagte Partei eigene Ansprüche gegen den ...
Inzwischen ist der Influencer-Markt steuerlich kein Sonderfall mehr, sondern ein klar erkennbares Geschäftsmodell. Das zeigt sich besonders deutlich am Beispiel...
Mehr lesenDetails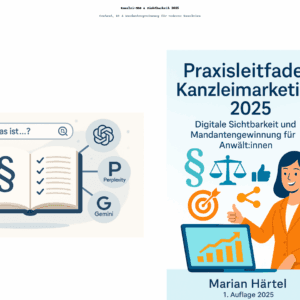 Kanzlei-SEO & Sichtbarkeit 2025: Das Content- und KI-Bundle für moderne Rechtsanwält:innen
54,99 €
Kanzlei-SEO & Sichtbarkeit 2025: Das Content- und KI-Bundle für moderne Rechtsanwält:innen
54,99 €inkl. MwSt.
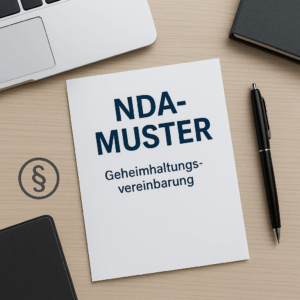 Verschwiegenheitserklärung / NDA – Muster mit Alternativen
0,00 €
Verschwiegenheitserklärung / NDA – Muster mit Alternativen
0,00 €inkl. MwSt.
 120 Minuten: Videoberatung via Microsoft Teams 120 Minuten – Ausführlich, vertieft und individuell
535,50 €
120 Minuten: Videoberatung via Microsoft Teams 120 Minuten – Ausführlich, vertieft und individuell
535,50 €inkl. MwSt.
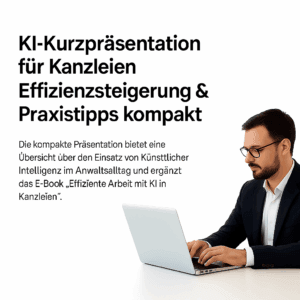 KI-Kurzpräsentation für Kanzleien – Effizienzsteigerung & Praxistipps kompakt
9,99 €
KI-Kurzpräsentation für Kanzleien – Effizienzsteigerung & Praxistipps kompakt
9,99 €inkl. MwSt.
 Videoberatung via Microsoft Teams 30 Minuten – Schnell, unkompliziert und fokussiert
163,63 €
Videoberatung via Microsoft Teams 30 Minuten – Schnell, unkompliziert und fokussiert
163,63 €inkl. MwSt.
In dieser Episode des Itmedialaw Podcasts nimmt euch Rechtsanwalt und Unternehmer Marian Härtel mit auf eine Reise durch den rechtlichen...
Mehr lesenDetailsIn diesem Video rede ich ein wenig über transparente Abrechnung und wie ich kommuniziere, was es kostet, wenn man mit...
Mehr lesenDetails

















