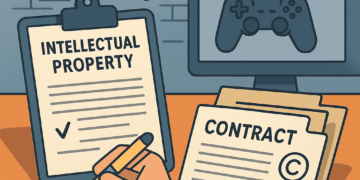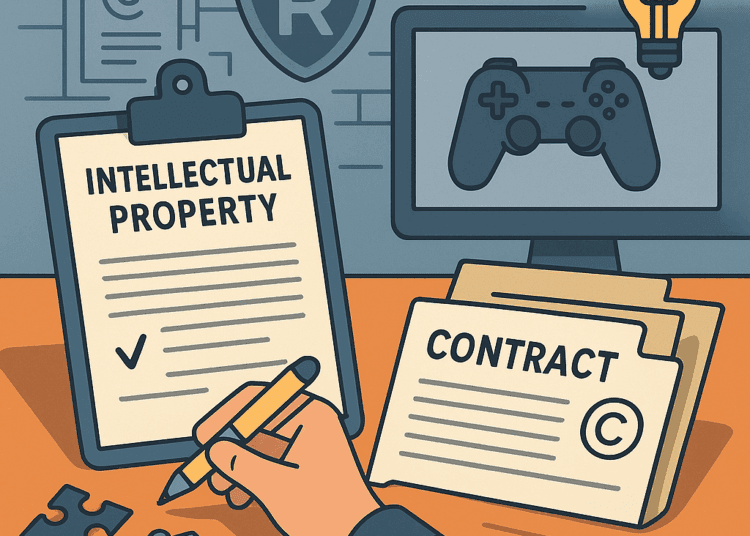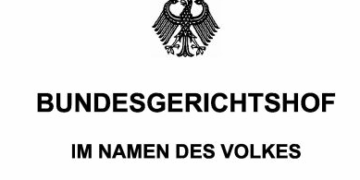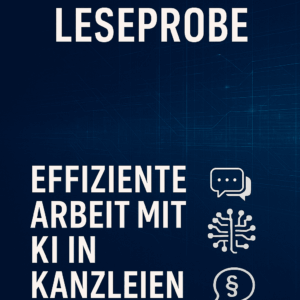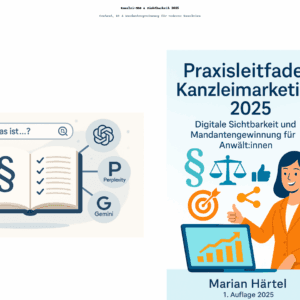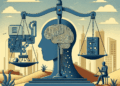Eine lückenlose Chain of Title ist die rechtliche Grundvoraussetzung für Finanzierung, Publishing, Distribution und spätere Verwertung eines Videospiels. Gemeint ist die vollständige und prüfbare Rechtekette an allen Bestandteilen des Spiels – vom Quellcode über Art-Assets und Audio bis hin zu Marken und Lizenzmaterial. Ohne belastbare Dokumentation steigen Transaktionskosten, es drohen Verzögerungen beim Release, Retractions aus Stores, Ansprüche Dritter sowie Deckungslücken in Versicherungen. Dieser Beitrag ordnet den Begriff rechtlich ein, zeigt die maßgeblichen deutschen und europäischen Normen, überträgt Best-Practices aus Film und Musik auf Games und liefert eine praxisorientierte Vertrags- und Dokumentationsarchitektur für Studios, Publisher und Investoren. Kern ist die vorausschauende Vertragsgestaltung mit Gründer:innen, Mitarbeitenden, Freelancer:innen und externen Rechtegebern sowie ein belastbares Rights-Clearance- und Audit-Konzept.
Begriff und Relevanz der Chain of Title
Unter Chain of Title wird in der Medienpraxis die Gesamtheit der Dokumente verstanden, die Eigentum/Nutzungsrechte an allen relevanten Materialien eines Projekts belegen. In Film und TV ist diese Dokumentationskette seit Jahrzehnten Standard, weil ohne „clean chain“ Finanzierung, E&O-Versicherung, Distribution und Verkauf kaum möglich sind. Der gleiche Maßstab setzt sich im Game-Bereich durch: Publisher, Plattformen und Investoren verlangen Nachweise über die Rechtekette an Code, Assets, Musik, Markenzeichen, Lizenzen und Drittinhalten.
Rechtsrahmen: Deutschland und EU
Urheberrechtliche Grundsätze
In Deutschland werden Nutzungsrechte gemäß § 31 UrhG eingeräumt; ergänzend regeln §§ 31a, 32, 32a, 32d, 32e UrhG u. a. unbekannte Nutzungsarten, angemessene Vergütung, Bestseller-Ausgleich sowie Auskunfts- und Rechenschaftspflichten – die beiden letztgenannten inzwischen ausdrücklich entlang der Lizenzkette. Für Computerprogramme gelten § 69a ff. UrhG; wichtig ist § 69b UrhG für Programme von Arbeitnehmern.
EU-Software-Richtlinie
Die Richtlinie 2009/24/EG stellt klar: Wird ein Computerprogramm von einer/einem Arbeitnehmer:in im Rahmen der Pflichten oder nach Weisungen des Arbeitgebers geschaffen, stehen die ausschließlichen wirtschaftlichen Rechte dem Arbeitgeber zu, sofern vertraglich nichts anderes geregelt ist (Art. 2 Abs. 3).
Games sind hybride Werke: Software, Grafik, 3D-Modelle, Animation, Text, Musik/SFX, Sprachaufnahmen, Logos/Marken, ggf. echte Persönlichkeitsrechte (Darsteller, Sprecher). Die Rechtekette muss jede dieser Ebenen abdecken. Software kann arbeitsrechtlich anderen Regeln folgen als z. B. ein Soundtrack eines externen Komponisten; bei Letzterem gilt typisches Urhebervertragsrecht mit Anspruch auf angemessene Vergütung und ggf. Bestseller-Ausgleich. Die Aufklärungspflichten in der Lizenzkette (§§ 32d, 32e UrhG) erleichtern heute die Durchleuchtung gegenüber nachgelagerten Verwertern.
Typische Bruchstellen in der Rechtekette von Games
- Fehlende IP-Abtretungsvereinbarungen im Gründerteam oder bei frühen Contributors.
- Unklare Abgrenzung von Arbeitnehmer-Software (§ 69b UrhG) gegenüber freien Beiträgen.
- Mündliche Absprachen mit Freelancern; keine schriftliche Rechteübertragung für Assets.
- Verwendung von Stock-Material ohne belegte Lizenz oder mit falscher Lizenzart (z. B. redaktionell statt kommerziell).
- Open-Source-Komponenten ohne Lizenzinventar; Inkompatibilitäten mit Copyleft-Lizenzen.
- Audio-Rechte: Komposition vs. Aufnahme; GEMA-Repertoire; fehlende Sync- und Master-Licenses.
- Marken/Logos und Persönlichkeitsrechte (Schauspieler, Streamer, Sportler) ohne Freigaben.
- Mods/UGC, bei denen die EULA keine klare Lizenz/Moderations-Policy vorsieht. (
Vertragsarchitektur für eine saubere Chain of Title
Gründer- und Gesellschafterebene
Bereits im Founders’ Agreement sollte eine umfassende IP-Zuweisung an die Gesellschaft geregelt werden: Abtretung an allen bestehenden und künftigen Werken, inklusive Quellcode, Tools, Pipelines, Dokumentation und Pre-Production-Material. Für nicht-Software-Beiträge gilt das allgemeine Urhebervertragsrecht; für Programmcodes im Angestelltenverhältnis greift § 69b UrhG kraft Gesetzes. Bei vorbestehenden Werken einzelner Gründer:innen ist eine Lizenz mit klarer Einräumung, Laufzeit, Gebiet, Nutzungsarten und Buy-Out/Upgrade-Optionen sinnvoll.
Mitarbeitende
Arbeitsverträge sollten eine präzisierende IP-Klausel enthalten, die § 69b UrhG spiegelt und über Software hinaus auch alle sonstigen schutzfähigen Beiträge (Grafik, Story-Texte etc.) vertraglich lizenziert. Zusätzlich sind Geheimhaltung, Wettbewerbs- und Nebentätigkeitsregeln sowie ein Inventions-/Tools-Rider sinnvoll, um Konflikte mit privaten Side-Projects zu vermeiden.
Freelancer und Studios (Subcontracting)
Mit externen Dienstleistern sind klare Werk-/Lizenzverträge nötig, die die vollständige Einräumung oder Abtretung der erforderlichen Nutzungsrechte regeln (§ 31 UrhG). Angemessene Vergütung (§ 32 UrhG), möglicher Bestseller-Ausgleich (§ 32a UrhG) sowie Auskunfts- und Rechenschaftspflichten der Lizenzkette (§ 32e UrhG) sollten adressiert werden. In der Praxis wird ein Buy-Out-Modell häufig angestrebt; rechtlich bleibt die Angemessenheit der Vergütung zu beachten.
Externe Rechte: Musik, Fonts, Marken, Persönlichkeitsrechte
Musikrechte erfordern Trennung zwischen Kompositions-Recht und Master-Recht; bei GEMA-Repertoire greifen zusätzliche Regeln. Für Fonts gelten Lizenzbedingungen des Foundries-Anbieters (App-/Embed-Lizenzen). Marken/Logos benötigen explizite Lizenzen; Persönlichkeitsrechte (Bild/Name/Stimme) klare Einwilligungen. In E&O-Kontexten ist eine „clean chain“ conditio sine qua non.
UGC und Mods
Wenn das Spiel Mods zulässt, sollte die EULA definieren, ob und wie UGC erstellt, geteilt, moderiert und lizenziert wird. Plattformverträge (z. B. Steam Workshop) gewähren oft weitreichende Lizenzen zugunsten der Plattform; Entwickler:innen sollten dies gegenüber den eigenen Nutzer:innen vertraglich spiegeln und klare verbotene Inhalte, Kommerzialisierungsregeln und Takedown-Prozesse vorsehen.
Wichtige Klauselblöcke in Developer-, Mitarbeiter- und Freelancer-Verträgen
Rechteübertragung/Nutzungsrecht
Klarer Umfang (Exklusivität, Laufzeit, Gebiet, Medien/Nutzungsarten), Bearbeitungs- und Unterlizenzrechte, Zweckübertragungslehre vermeiden, soweit möglich eindeutige Typisierung der Nutzungsarten und „künftige Werke“ (§ 40 UrhG) berücksichtigen. Für Software im Arbeitsverhältnis greift § 69b UrhG; außerhalb dessen gilt § 31 UrhG.
Angemessene Vergütung, Bestseller-Ausgleich, Reporting
Die Vergütung muss angemessen sein; bei „Hits“ kann § 32a UrhG nachträgliche Anpassungen ermöglichen. Empfehlenswert sind klare Reporting-/Audit-Regeln und Informationsrechte entlang der Lizenzkette (§§ 32d, 32e UrhG), damit Urheber:innen ihre Ansprüche prüfen können.
Zusicherungen, Gewährleistungen, Freistellung
Studios geben gegenüber Publishern Garantien zur Rechtekette und stellen von Ansprüchen Dritter frei. Diese Zusagen werden intern an Mitarbeitende und Freelancer „durchgereicht“. Umfang und Grenzen der Freistellung (Cap, Mitwirkungs- und Kontrollrechte) sollten sorgfältig austariert sein.
Moral Rights/Urheberpersönlichkeitsrechte
In Deutschland sind Urheberpersönlichkeitsrechte ausgeprägt; vollständige „Waiver“ sind unzulässig. Zulässig sind Einwilligungen in bestimmte Änderungen und Nennungsregelungen. Vertragsklauseln sollten sorgfältig formuliert werden, um spätere Konflikte bei Edits, Ports und Live-Ops zu vermeiden.
Open-Source-Compliance
Eine OSS-Policy mit Kompatibilitätsprüfung der Lizenzen (insb. Copyleft), Third-Party-Notices, Source-Code-Bereitstellungspflichten und SBOM-Dokumentation ist Pflicht. Publisher fragen zunehmend nach OSS-Inventaren; Verstöße können Store-Delistings und Vertragsstrafen nach sich ziehen. (Allgemeine Branchenpraxis; Vertrags-Checklisten bei Publishern und Plattformen nehmen OSS-Inventare regelmäßig auf.)
Marken, Domains, App-Store-Kennungen
Marken-Clearing vor Annahme eines Game-Titels verhindert Rebranding-Kosten. Domains, Social-Handles und Store-Kennungen sollten zentral auf die Gesellschaft registriert werden; Rechtezuweisung im Gründer- und Mitarbeitervertrag verhindert spätere Blockaden.
Prüf- und Dokumentationssystem: Von der Rechte-Matrix bis zur Due-Diligence-Map
Ein tragfähiges Rights-Clearance-System besteht aus:
- Asset-Register mit eindeutigen IDs (Quelle, Autor, Lizenz, Datum, Scope).
- Vertrags-Repository mit Volltextsuche und Versionierung.
- OSS-Inventar inkl. Lizenzen und Pflichten (Notices, Copyleft-Trigger, Compliance-Check).
- Musikrechte-Map (Komposition, Master, GEMA-Status, Territory, Laufzeit).
- Talent-Releases (Sprecher, Performer, Influencer-Cameos).
- Marken-/Logo-Freigaben und Kühneprüfung geplanter In-Game-Werbeformen.
- Change-Request-Prozess: jede Pipeline-Änderung triggert Rechte-Update.
- DD-Pack für Publisher/Investoren: Zusammenfassung von Kette, Verträgen, Versicherungen, Policies, Audit-Trail.
Die Praxis aus Film zeigt: Ohne klare Chain of Title scheitern Finanzierungen und Versicherungen – eine Erfahrung, die sich 1:1 auf Games übertragen lässt.
Publisher-Perspektive: Wieso „Clean Chain“ über den Vertrag entscheidet
Publisher-Verträge enthalten representations & warranties zur Rechtekette und weitreichende Indemnities. Unklare Ketten führen zu „Exceptions“ in Disclosure-Schedules, höheren Rückbehalten, strengeren Audit-Rechten oder zu Kill-Rights. Recoup-Mechaniken und Approval-Gates sind häufig mit Rechte-Nachweisen verknüpft. Frühzeitige Vorbereitung senkt die Transaktionskosten und verbessert die Deal-Terms.
Beispiel-Struktur für eine vertragliche Rechteklausel (Blueprint)
- Einräumung exklusiver, zeitlich, räumlich und inhaltlich umfassender Nutzungsrechte an sämtlichen vom/der Vertragspartner:in geschaffenen Werkelementen, einschließlich Bearbeitungs-, Umgestaltungs-, Vervielfältigungs-, Verbreitungs-, Vortrags-, öffentlicher Zugänglichmachungs-, Senderechte etc., jeweils für alle bekannten und unbekannten Nutzungsarten, soweit gesetzlich zulässig.
- Einwilligung in Bearbeitungen und in die Verbindung mit anderen Werken, soweit urheberpersönlichkeitsrechtlich möglich; Regelung der Nennung.
- Zusicherung der Freiheit von Rechten Dritter; Pflicht zur Beschaffung erforderlicher Zustimmungen/Lizenzen.
- Freistellung mit Cap und verteilter Mitwirkungspflicht, inkl. Notice- und Defense-Control-Mechanik.
- Reporting- und Dokumentationspflichten; Pflicht zur Mitwirkung bei Register-/Store-Formalitäten.
- Vergütungsregelung unter Beachtung § 32 UrhG; Transparenz-/Auskunftsregelungen entlang der Lizenzkette gemäß §§ 32d, 32e UrhG; Hinweis auf § 32a UrhG.
Mods/UGC: Rechtekette in Live-Ökosystemen
Wenn der Titel Modding erlaubt, schaffen Nutzer:innen fortlaufend neue Inhalte. Die EULA sollte deshalb:
- eine nicht-exklusive, weltweite, übertragbare Lizenz an UGC zugunsten des Studios vorsehen (Zweck: Hosting, Distribution, Marketing, Portierungen),
- klare Verbote (IP-Dritter, Persönlichkeitsrechtsverletzungen, circumventing DLC, NSFW etc.) normieren,
- kommerzielle Nutzung regeln (verboten, Spenden erlaubt, spezielle Creator-Programme),
- Moderations- und Takedown-Prozesse definieren,
- Plattform-AGBs (z. B. Steam Workshop) konsistent spiegeln.
Beispiele aus der Praxis verdeutlichen diese Punkte; auch große Publisher präzisieren UGC-Lizenzen in ihren EULAs oder Modding-Guidelines.
Due Diligence und Versicherbarkeit
E&O-Carrier und Finanzierer verlangen eine belastbare Dokumentation. Ein sauberer Audit-Trail und eine aktuelle Rechte-Matrix beschleunigen Prozesse, senken Prämien und verhindern Sperren auf Plattformen. In der Filmwirtschaft gelten diese Anforderungen seit Langem; Games folgen dieser Praxis zunehmend. (WIPO)
Praxisleitfaden: Schritt-für-Schritt zur „Clean Chain“
- IP-Inventar anlegen (Code, Assets, Audio, Texte, Marken, Verträge).
- Vertragstemplates harmonisieren (Founder, Employment, Freelancer, Composer, Voice, Brand License).
- OSS-Policy und SBOM etablieren; regelmäßige Reviews in CI-Pipeline.
- Rechte-Check vor jeder Milestone-Abnahme (intern, dann extern).
- UGC/Modding-Policy in EULA implementieren; Moderation/Notice-and-Takedown definieren.
- Marken-/Titel-Clearing vor Marketingstart; Domain/Handles sichern.
- DD-Pack pflegen: Rechtekette, Versicherungen, Releases, Audits, Register-Auszüge.
- Alert-System bei Drittcontent (Fonts/Stock/Voice Models).
- Schulung des Teams: „kein Asset ohne Lizenz“ – Dokumentationspflicht in der Pipeline.
- Vertragliche Back-to-Back-Absicherung sämtlicher Zusicherungen.
Häufige Missverständnisse im Studio-Alltag
- „Angestellte entwickeln Software – damit gehört alles automatisch dem Studio.“
Richtig für Computerprogramme nach § 69b UrhG; falsch für andere kreative Beiträge ohne vertragliche Regelungen. - „Ein Pay-Once-Buyout löst jede Frage zur Vergütung.“
Die Angemessenheit und ein möglicher Bestseller-Ausgleich bleiben zu beachten. - „Einmalige Lizenz reicht für alle Plattformen und Formate.“
Unbekannte Nutzungsarten und Portierungen erfordern explizite Regelungen. - „Mods regeln sich über die Plattform-AGB von allein.“
Eigene EULA-Regeln sind nötig, um Studio- und Community-Interessen auszubalancieren. (S
Publisher- und Plattformverträge: Schnittstellen sauber schließen
Publisher-Term-Sheets enthalten neben Funding/Advance regelmäßig weitreichende Representations/Warranties zur Rechtekette, Audit-Rechte, Approval-Gates sowie Recoup-Mechanismen. Wer als Studio die Chain of Title proaktiv dokumentiert, kann härter über IP-Ownership, ROFR/Sequel-Rechte und Cap-Logiken verhandeln. Branchenberichte und Praxisbeiträge belegen, dass unklare Ketten zu Takeover-Rechten und einseitigen Schutzklauseln zulasten der Entwickler führen.
Checklisten und Musteranhänge für Verträge
- Anlagenverzeichnis mit Rechtegrids pro Asset.
- OSS-Inventar: Paket, Version, Lizenz, Pflichten, Kompatibilität, Trigger.
- Composer-Agreement-Rider: Work-for-Hire-äquivalent (DE-tauglich), Master-/Sync-Regeln.
- Voice-Talent-Release: Einwilligungen, Buy-Out, KI-Stimmnutzung nur bei ausdrücklicher Regelung.
- Brand/Logo-License: Territorium, Medien, Umfang, Laufzeit, Qualitätskontrolle, Morals-Klausel.
- UGC-Policy-Anhang zur EULA: Lizenzumfang, Monetarisierung, Moderation, Takedown.
Fazit
Wer die Rechtekette frühzeitig strukturiert, verkürzt Verhandlungen, reduziert Haftungsrisiken, erhöht Versicherbarkeit und stärkt die eigene Verhandlungsposition gegenüber Publishern und Plattformen. Rechtliche Leitplanken liefern § 31 UrhG ff. und § 69b UrhG sowie die EU-Software-Richtlinie – die praktische Umsetzung verlangt jedoch ein systematisches Vertrags- und Dokumentationsdesign quer über alle Beteiligten im Projekt. Studios, die diese Hausaufgaben erledigen, schließen schneller, günstiger und zu besseren Konditionen ab.