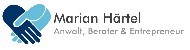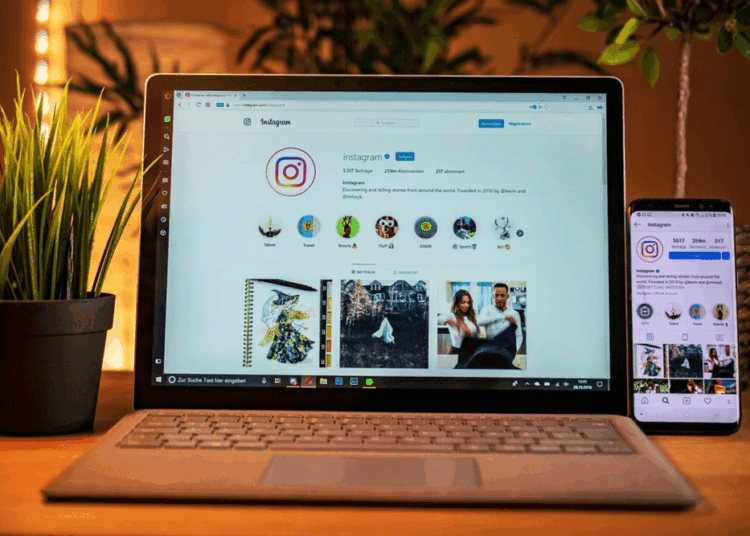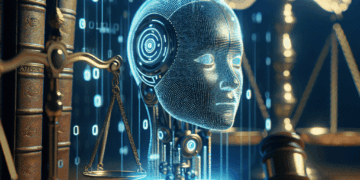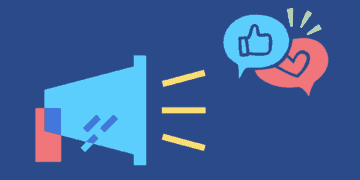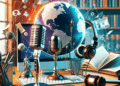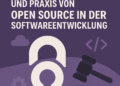Influencer-Marketing und Agenturkooperationen haben in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen. Mit neuen Technologien, globaler Vernetzung und veränderten Geschäftsmodellen stehen sowohl Creator-Verträge als auch Agenturverträge vor neuen Herausforderungen. Dieser Fachbeitrag beleuchtet zwei Schwerpunktthemen: Zum einen die Zusammenarbeit mit Influencern (Creator-Verträge) und zum anderen die Zusammenarbeit zwischen Agenturen und Kunden (Agenturverträge 2.0). Welche Rechte und Pflichten sollten in modernen Verträgen geregelt sein? Wo lauern rechtliche Fallen? Und wie lässt sich Flexibilität mit Rechtssicherheit in Einklang bringen? Im Folgenden erhalten Sie einen fundierten Überblick – basierend auf aktuellem deutschen Recht (und relevantem EU-Recht) – der zugleich auf wichtige Trends wie künstliche Intelligenz (KI), Deepfakes und neue Arbeitsmodelle eingeht. Ziel ist es, praxistaugliche Lösungsansätze für Werbekunden, Influencer und Agenturen aufzuzeigen, um rechtliche Risiken zu minimieren und erfolgreiche Kooperationen zu ermöglichen.
Creator-Verträge 2025: Rechte, Pflichten und Fallen in der Zusammenarbeit mit Influencern
Ein gut gestalteter Creator-Vertrag bildet die Basis für erfolgreiche Influencer-Kampagnen in den sozialen Medien.
Moderne Influencer- oder Creator-Verträge regeln detailliert die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen (Werbekunden) und Content Creators. Da Influencer-Marketing oft auf Authentizität und Reichweite baut, müssen Verträge einen Spagat zwischen Kontrolle und kreativer Freiheit meistern. Im Jahr 2025 spielen zudem KI-Technologien und virtuelle Avatare eine immer größere Rolle, was in Verträgen berücksichtigt werden muss. Im Folgenden werden die wichtigsten Regelungsbereiche und Stolperfallen eines Creator-Vertrags beleuchtet.
Klare Leistungsbeschreibungen und Pflichten der Parteien
Ein Creator-Vertrag sollte zunächst die konkreten Leistungen klar umreißen. Unternehmen beauftragen Influencer in der Regel, bestimmte Produkte oder Dienstleistungen in sozialen Netzwerken zu präsentieren. Damit beide Seiten wissen, was erwartet wird, sollte der Vertrag festhalten: Welche Inhalte auf welchen Plattformen veröffentlicht werden, wie viele Beiträge oder Stories geschaltet werden und wann diese online gehen sollen. Auch qualitative Vorgaben gehören hierher – etwa Briefing-Vorgaben zur Marke, gewünschte Botschaften, Hashtags oder Design-Richtlinien. Wichtig ist, einen Zeitrahmen bzw. Posting-Zeitraum festzulegen. Oft genießt der Influencer zwar gewisse Freiheit, den exakten Zeitpunkt eines Posts selbst zu wählen, dennoch kann der Werbekunde einen Endtermin definieren. Wird ein fester Veröffentlichungstermin als Fixgeschäft vereinbart (vgl. § 323 Abs.2 Nr.2 BGB), kann der Auftraggeber bei Nichteinhaltung sogar sofort vom Vertrag zurücktreten. In jedem Fall sollten Fristen und Meilensteine eindeutig sein, um Missverständnisse zu vermeiden.
Pflichten des Influencers: Im Gegenzug zur Vergütung verpflichtet sich der Creator, die vereinbarten Inhalte ordnungsgemäß zu erstellen und zu posten. Hierbei sollte im Vertrag festgehalten sein, wie lange ein Beitrag mindestens online bleiben muss (z. B. mindestens X Monate nicht löschen oder archivieren). Zudem ist festzulegen, ob und wie der Influencer auf Kommentare reagieren oder anderweitig nachbetreuen soll. Eine weitere essenzielle Pflicht ist die Kennzeichnung von Werbung: Der Vertrag sollte den Influencer ausdrücklich verpflichten, alle Posts gemäß den gesetzlichen Vorgaben (UWG und Medienrecht) als Werbung zu markieren (z. B. durch Hashtags wie #Werbung oder die Plattform-Funktion „Bezahlte Partnerschaft“). Unterlässt der Influencer dies, drohen Abmahnungen wegen Schleichwerbung – ein Risiko, das auch der Auftraggeber nicht unterschätzen sollte. Daher kann es sinnvoll sein, eine Vertragsstrafe für Verstöße gegen Kennzeichnungspflichten vorzusehen, um den Influencer zur Compliance anzuhalten. Allerdings muss eine Vertragsstrafe angemessen sein; überzogene Strafen wären nach deutschem Recht unwirksam (§ 307 BGB bei AGB-Klauseln, bzw. § 138 BGB bei Sittenwidrigkeit).
Pflichten des Werbekunden: Auch das Unternehmen hat Mitwirkungspflichten. Üblich ist etwa, dass es dem Influencer die beworbenen Produkte kostenlos zur Verfügung stellt. Der Vertrag sollte regeln, ob die Produkte nach dem Posting zurückzugeben sind oder der Influencer sie behalten darf. Ebenso sollte der Werbekunde dem Creator rechtzeitig alle Informationen, Logos, Hashtags etc. liefern, die für die Beitragserstellung notwendig sind. Nicht zuletzt muss der Auftraggeber die vereinbarte Vergütung fristgerecht zahlen – darauf gehen wir als Nächstes ein.
Vergütungsmodelle: Pauschale, Reichweitenvertrag und Erfolgsbeteiligung
Die Honorarvereinbarung ist Kern jedes Influencer-Vertrags. Grundsätzlich gilt: Keine Leistung ohne Gegenleistung. Influencer stellen ihre Reichweite und ihren Zugang zur Zielgruppe zur Verfügung und erhalten dafür ein Entgelt. Dieses kann klassisch als Pauschalvergütung vereinbart werden (z. B. fixer Betrag pro Beitrag oder Kampagne). Bei sehr reichweitenstarken Influencern können solche Pauschalen leicht mehrere Tausend Euro pro Post betragen – daher sollten Unternehmen hier verhandeln und nichts dem Zufall überlassen. Ohne klare Honorarvereinbarung müsste im Streitfall die „übliche Vergütung“ gezahlt werden (§ 612 BGB), was insbesondere bei bekannten Influencern unangenehm hoch ausfallen kann.
Neben Festbeträgen gibt es moderne Modelle wie Reichweitenverträge oder erfolgsbasierte Vergütungen. Ein Reichweitenvertrag koppelt das Honorar an die tatsächlich erzielte Reichweite des Beitrags – etwa an Views, Likes, Klicks oder generierten Umsatz (Affiliate-Links, Rabattcodes). Hier kann z. B. ein Grundhonorar mit Bonus pro 1.000 Views vereinbart werden. Vorteil: Der Influencer hat einen Anreiz, die Performance zu maximieren; das Risiko des Werbekunden sinkt, da er bei geringer Resonanz weniger zahlt. Allerdings erfordert dies verlässliche Metriken und eine eindeutige Definition, wie Erfolg gemessen wird (Screenshot der Insights, Zugriff auf Analytics oder Tracking-Links). Beide Seiten sollten zudem eine Obergrenze und Abrechnungszeitraum festlegen, um Streit über Messzeitpunkte zu vermeiden. Alternativ oder ergänzend kann eine Erfolgsbeteiligung vereinbart werden – z. B. der Influencer erhält Provisionen für jeden Verkauf, der über seinen Link generiert wurde. Solche Modelle ähneln eher Affiliate-Vereinbarungen und können im Vertrag zusätzlich oder anstelle einer Grundvergütung vorgesehen werden.
Nicht selten erfolgt die Bezahlung teilweise auch in Sachleistungen: Gratis-Produkte, Einladungen (etwa Reisen/Events) oder Gutscheine können als Teil des Entgelts dienen. Das ist zulässig, muss aber ebenfalls genau im Vertrag quantifiziert werden (ggf. mit einem Geldwert, schon aus steuerlichen Gründen). Sollte ausnahmsweise gar keine Vergütung fließen – etwa weil es sich um einen reinen Produkttest ohne Honorar handelt – gehört auch das schriftlich festgehalten („Kooperation ohne monetäre Vergütung – Produkt wird zu Testzwecken gestellt“). Hintergrund: Zum einen besteht sonst Unklarheit, zum anderen will man dokumentieren, dass bei fehlender Bezahlung der Post ggf. als privat gelten könnte (Stichwort Kennzeichnungspflicht – nach § 5a Abs.4 UWG muss Werbung grundsätzlich nur als solche gekennzeichnet werden, wenn eine Gegenleistung erfolgt; jedoch ist Vorsicht geboten, da Eigenwerbung oder Imagepflege ebenfalls als geschäftlich eingestuft werden können, wie der BGH 2021 entschied).
Buyout-Klauseln und Nutzungsrechte: Wem gehören die Inhalte?
Ein zentraler Punkt moderner Creator-Verträge sind die Nutzungsrechte an den vom Influencer erstellten Inhalten (Fotos, Videos, Texte, etc.). Im Influencer-Marketing werden häufig Fotos oder Clips produziert, die nicht nur auf dem Kanal des Creators erscheinen, sondern vom werbenden Unternehmen weiterverwendet werden sollen – etwa auf der eigenen Website, in Social-Media-Ads oder sogar in Printkampagnen. Ohne ausdrückliche Vereinbarung hat der Auftraggeber aber nur ein sehr begrenztes Nutzungsrecht: Nach der gesetzlichen Zweckübertragungslehre (§ 31 Abs.5 UrhG) erhält er implizit nur die Rechte, die für den Vertragszweck unbedingt erforderlich sind. Das könnte im Zweifel nur das einmalige Posten durch den Influencer selbst umfassen – nicht aber die weitergehende Verwertung durch den Werbekunden.
Daher empfiehlt es sich dringend, im Vertrag eine ausführliche Rechteübertragung zu regeln. Üblich ist eine einfache oder ausschließliche Nutzungsrechtseinräumung an allen erstellten Medien. Viele Unternehmen verlangen heute einen „Buyout“, also die umfassende, exklusive Nutzungsmöglichkeit der Inhalte. Dies umfasst z. B. das Recht, Fotos/Videos des Influencers zeitlich unbegrenzt, weltweit, auf allen Medien (Social Media, Webseite, Flyer, TV etc.) für Werbezwecke zu verwenden und auch Unterlizenzen an Konzernunternehmen zu erteilen. Ein solcher Total-Buyout bietet dem Werbekunden maximale Flexibilität – er kann die Kampagneninhalte auch in Zukunft frei einsetzen, ohne erneut fragen oder zahlen zu müssen. Für den Influencer bedeutet es allerdings, dass er die Kontrolle über seine Inhalte weitgehend abgibt; er sollte dafür eine entsprechend höhere Vergütung verlangen. Tipp: Aus Influencer-Sicht ist es sinnvoll zu prüfen, ob der Umfang der Rechteübertragung wirklich erforderlich ist. Oft kann man sich auf spezifische Nutzungsarten einigen (z. B. Online-Nutzung für 1 Jahr im deutschsprachigen Raum) anstatt pauschal „alle Rechte“ abzugeben. So bleibt die eigene Marke geschützt und es besteht die Möglichkeit, für weitergehende Nutzungen später ein zusätzliches Honorar zu verhandeln.
In jedem Fall muss der Umfang der Rechteeinräumung detailliert im Vertrag beschrieben werden – welche Medien, welcher Zeitraum, Exklusivität ja/nein, Recht zur Bearbeitung der Inhalte etc. Gerade das Bearbeitungsrecht ist heikel: Ohne Zustimmung dürfte ein Unternehmen das vom Influencer gelieferte Foto z. B. nicht nachträglich verfremden oder zuschneiden, wenn dadurch die Persönlichkeitsrechte des Influencers berührt werden. Der Influencer als Urheber oder abgebildete Person hat ein Recht am eigenen Bild und am Schutz vor Entstellung. Verträge sollten daher regeln, inwieweit der Auftraggeber Änderungen vornehmen darf. Aus Unternehmenssicht sollte mindestens erlaubt sein, die Größe/Zuschnitte anzupassen oder kurze Ausschnitte aus einem Video zu verwenden, solange der Charakter nicht entstellt wird. Bei weitreichenden Bearbeitungen (z. B. Montagen) empfiehlt sich die vorherige Abstimmung mit dem Creator, um Konflikte zu vermeiden.
Kontrolle vs. kreative Freiheit: Regeln zur Content-Abstimmung
Ein häufiges Spannungsfeld ist das Verhältnis zwischen Kundenkontrolle und kreativer Freiheit des Influencers. Auf der einen Seite möchte das werbende Unternehmen sicherstellen, dass die Markenbotschaft korrekt und rechtlich einwandfrei transportiert wird. Auf der anderen Seite lebt Influencer-Marketing von der Authentizität – der Creator kennt seine Community am besten und weiß, welcher Ton ankommt. Übermäßige Reglementierung kann die Posts steif und unglaubwürdig wirken lassen.
Lösungsansatz: Im Vertrag sollten klare Briefing- und Abnahmeprozesse vereinbart werden. Etwa kann festgelegt sein, dass der Influencer vor Veröffentlichung dem Auftraggeber den Beitragentwurf zur Freigabe vorlegt. Der Kunde darf dann prüfen, ob markenrechtliche Vorgaben, inhaltliche Wünsche und rechtliche Anforderungen (Kennzeichnung, keine irreführenden Aussagen, kein verbotenes Inhalt) eingehalten sind. Allerdings sollte diese Prüfung innerhalb kurzer Fristen erfolgen, um den kreativen Prozess nicht zu sehr zu bremsen. Zudem muss dem Influencer belassen werden, wie er die Botschaft in seine Sprache übersetzt – denn er allein verfügt über die authentische Ansprache seiner Follower. Praktisch bedeutet das: Der Vertrag kann einen Rahmen stecken (Do’s & Don’ts, z. B. keine vulgäre Sprache, bestimmte Produktinformationen müssen genannt werden, Wettbewerber nicht erwähnen etc.), aber innerhalb dieses Rahmens sollte der Creator eigenständig formulieren und gestalten dürfen. Beide Seiten sollten einander als Partner auf Augenhöhe betrachten: Das Unternehmen liefert die inhaltlichen Kernpunkte, der Influencer bringt die Kreativität und Reichweite ein.
Exklusivität und Wettbewerbsverbote: Zur Kontrolle gehört auch der Wunsch vieler Werbekunden, dass ihr Influencer nicht gleichzeitig für konkurrierende Marken wirbt. Exklusivitätsklauseln sind üblich – etwa dass der Creator während der Kampagnenlaufzeit und X Monate danach keine Werbung für direkte Mitbewerber des Auftraggebers machen darf. Diese Klauseln müssen jedoch zeitlich angemessen sein. Influencer, die von Werbeaufträgen leben, können es sich wirtschaftlich nicht leisten, allzu lange gebunden zu sein. Gerichte sehen überlange Bindungen kritisch: Ein Vertrag, der die berufliche Weiterentwicklung des Influencers unverhältnismäßig hemmt, könnte als sittenwidrige Knebelung (§ 138 BGB) unwirksam sein. So hat z. B. das LG Potsdam 2021 einen überzogenen Exklusivvertrag kassiert, der einen Influencer über Gebühr einschränkte. Als Faustregel gilt analog das, was für Handelsvertreter oder Künstler vereinbart werden darf: nachvertragliche Wettbewerbsverbote von mehr als 2 Jahren sind unwirksam, und für die Dauer des Verbots muss eine Karenzentschädigung gezahlt werden (vgl. § 74a HGB analog). In der Praxis verzichten viele auf lange Nachbindungen und beschränken Exklusivität auf die Laufzeit der Kooperation oder wenige Monate danach. Für beide Seiten ist es wichtig, ein gesundes Mittelmaß zu finden – etwa ein branchenbezogenes Werbeverbot für 3–6 Monate, das den Werbewert der Kampagne schützt, ohne den Creator in einen „goldenen Käfig“ zu sperren. Im Zweifel sollte der Influencer für eine längere Exklusivität zusätzlich vergütet werden.
KI-Einsatz, Deepfake-Stimmen und virtuelle Influencer: Regelungsbedarf
Künstliche Intelligenz hält Einzug ins Influencer-Business. Creator nutzen KI-Tools, um Inhalte zu erstellen (z. B. automatisierte Video- oder Bildgenerierung), und es entstehen sogar virtuelle Influencer – computergenerierte Persönlichkeiten mit echten Followern. Diese Entwicklungen werfen neuartige Rechtsfragen auf, die in heutigen Verträgen proaktiv adressiert werden sollten.
KI-generierte Inhalte durch den Creator: Verwendet ein Influencer KI, um Fotos, Texte oder Stimme zu erzeugen (z. B. ein Tool, das seine Stimme als Deepfake synthetisiert oder einen digitalen Avatar seiner selbst erstellt), stellt sich die Frage nach Urheberrechten und Persönlichkeitsrechten. Generative KI kann problematisch sein, da die erstellten Werke oft keinen menschlichen Urheber haben – somit könnten sie urheberrechtlich schutzfrei sein. Das bedeutet, theoretisch dürfte jeder Dritte solche Bilder verwenden, weil kein klassisches Copyright greift. Für den werbenden Kunden ist das heikel: Man zahlt für Content, an dem man mangels Schutz keine Exklusivrechte erwerben kann. Andererseits besteht das Risiko, dass KI-Outputs doch geschütztes Material Dritter enthalten (Stichwort Trainingsdaten) – dann drohen sogar Urheberrechtsverletzungen. Vertragstipp: Der Influencer sollte zusichern, dass er nur KI-Tools einsetzt, deren Nutzung rechtlich unbedenklich ist, und dass die Ergebnisse frei von Rechten Dritter sind. Gegebenenfalls kann vereinbart werden, dass bei KI-Content die rechteneutrale Gestaltung gewährleistet sein muss oder dass der Creator im Zweifel auf klassische Herstellung zurückgreift. Außerdem sollte geregelt sein, wer die Nutzungsrechte an KI-Inhalten erhält – sicherheitshalber so, als wären es normale urheberrechtliche Werke, inklusive aller erforderlichen Befugnisse für den Auftraggeber.
Deepfakes und virtuelle Avatare: Eine weitere Frage ist, ob der Influencer persönlich in Erscheinung treten muss. Dank KI könnte ein Creator z. B. statt eigener Videos einen digitalen Avatar von sich in beliebiger Menge produzieren lassen oder seine Stimme per KI in verschiedenen Sprachen generieren, ohne selbst zu sprechen. Für Werbekunden mag das auf den ersten Blick egal sein, solange die Außenwirkung stimmt – doch rechtlich sollte Transparenz herrschen. Die EU arbeitet mit dem kommenden AI Act an Vorgaben, wonach KI-generierte deepfake-Inhalte gekennzeichnet werden müssen, wenn sie täuschend echt menschliches Auftreten simulieren. Verträge sollten daher vorsehen, dass der Influencer den Einsatz solcher Techniken offenlegt. Zudem betrifft ein virtueller Klon stets das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Influencers (Recht am eigenen Bild und an der Stimme): Ohne ausdrückliche Erlaubnis dürfte weder der Influencer selbst noch erst recht der Auftraggeber einen digitalen Doppelgänger einsetzen. Wenn ein Unternehmen z. B. nach Ende der Zusammenarbeit einfach einen KI-Klon des Influencers weiter als Werbefigur nutzt, würde dies gravierend gegen Persönlichkeitsrechte verstoßen – Schadensersatz und Unterlassungsansprüche wären die Folge. Daher ist zu empfehlen, im Vertrag klar zu regeln, ob und wie KI zum Einsatz kommen darf. Etwa könnte man festhalten, dass der Influencer persönlich die Leistungen erbringt und KI nur als Hilfsmittel einsetzt, ohne das Erscheinungsbild künstlich vorzutäuschen. Umgekehrt sollte ein Influencer-Management, das die Rechte an einem Creator hält, nicht ohne Zustimmung des Creators einen Avatar von ihm vermarkten dürfen. Solche Szenarien mögen heute futuristisch klingen, werden aber mit der Technik schnell Realität – vorausschauende Vertragsklauseln schaffen hier Sicherheit.
Arbeits- und Steuerrecht: Scheinselbstständigkeit, Künstlersozialabgabe & Co.
Influencer sind in der Regel selbstständig tätige Unternehmer ihrer eigenen Marke. Doch Vorsicht: Unter bestimmten Umständen kann ein Creator rechtlich als Arbeitnehmer gelten, mit weitreichenden Folgen für alle Beteiligten. Scheinselbstständigkeit lautet das Stichwort, das insbesondere dann relevant wird, wenn ein Influencer sehr eng und exklusiv für einen Auftraggeber arbeitet.
Scheinselbstständigkeit vermeiden: Ob jemand wirklich frei schaffend oder faktisch angestellt ist, prüft in Deutschland vor allem die Deutsche Rentenversicherung (DRV). Typische Kriterien sind: Hat der Influencer Weisungen des Auftraggebers zu befolgen (Inhalt, Zeit, Ort der Arbeit)? Ist er in die Organisation des Unternehmens eingegliedert (feste Arbeitszeiten, regelmäßige Meetings, Firmen-E-Mail-Adresse)? Hat er nur einen Auftraggeber und tritt gar nicht selbstständig am Markt auf? Nutzt er eigene Arbeitsmittel oder die des Auftraggebers (z. B. Büro beim Kunden)? Ein Beispiel: Wenn eine Agentur einen kleinen Influencer unter Vertrag nimmt, ihm genau vorgibt, was er wann zu posten hat, ihn vielleicht sogar täglich im Office mitarbeiten lässt und der Influencer keine anderen Kunden annimmt – dann ist die Grenze zur Scheinselbstständigkeit überschritten. Der Influencer wäre de facto ein Arbeitnehmer der Agentur, egal wie man den Vertrag nennt.
Die Konsequenzen einer solchen Fehleinordnung sind drastisch: Stellt die DRV oder ein Sozialgericht im Nachhinein ein Arbeitsverhältnis fest, muss der vermeintliche Auftraggeber alle Sozialversicherungsbeiträge nachzahlen – Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil! Das kann bis zu 4 Jahre rückwirkend eingefordert werden (bei Vorsatz sogar bis zu 30 Jahre). Zusätzlich macht sich der Verantwortliche unter Umständen strafbar (Straftatbestand des Vorenthaltens von Sozialversicherungsbeiträgen, § 266a StGB). Für den Auftraggeber kämen außerdem arbeitsrechtliche Pflichten ins Spiel: Kündigungsschutz, Urlaubsansprüche, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall – all das würde plötzlich gelten. Man stelle sich vor, ein wichtiger Influencer wird offiziell „festgestellt“ – er könnte dann z. B. kündigungsschutzklagen oder Urlaubstage verlangen. Das möchte kein Unternehmen erleben.
Praktische Absicherung: Um sicherzugehen, können Parteien bei längerfristigen Engagements ein Statusfeststellungsverfahren nach § 7a SGB IV bei der DRV beantragen. Dabei wird verbindlich entschieden, ob Selbstständigkeit vorliegt. Diese Möglichkeit sollte erwogen werden, wenn ein Influencer über einen langen Zeitraum quasi exklusiv für einen Kunden tätig ist, man aber keine Festanstellung wählen will. Alternativ – falls die Einbindung tatsächlich sehr eng ist – kann es sogar sinnvoller sein, den Creator anzustellen (z. B. befristet für die Kampagnenlaufzeit). Einige große Unternehmen gehen dazu über, besonders wichtige Influencer als Arbeitnehmer oder arbeitnehmerähnliche Personen zu führen, um Renten- und Unfallversicherung abzudecken. Natürlich hat eine Festanstellung auch Nachteile (Lohnnebenkosten, weniger Flexibilität bei Trennung), doch sie kann rechtliche Risiken eliminieren und für den Influencer gewisse soziale Absicherungen mit sich bringen.
Künstlersozialkasse (KSK): Eine oft übersehene Pflicht im Influencer-Marketing ist die Künstlersozialabgabe. Influencer, die kreativen Content erstellen, gelten nämlich zunehmend als Künstler oder Publizisten i.S.d. Künstlersozialversicherungsgesetzes. Die Künstlersozialkasse selbst führt “Influencer” bereits in ihrer Liste typischer künstlerischer Berufe. Das bedeutet: Unternehmen, die Influencer beauftragen, müssen unter Umständen auf die gezahlten Honorare eine Abgabe (circa 5%) an die KSK entrichten – ähnlich wie Sozialabgaben, nur dass hier der Auftraggeber diese alleine trägt. Diese Abgabe dient der Sozialversicherung freischaffender Künstler. Noch ist die Rechtslage nicht in Stein gemeißelt, aber die Tendenz in der Praxis ist klar: Regelmäßig mit Influencern werbende Firmen oder Agenturen werden wie Verwerter künstlerischer Leistungen behandelt und entsprechend veranlagt. Daher sollte jeder Auftraggeber prüfen, ob er bei der KSK meldepflichtig ist, um Nachzahlungen und Bußgelder zu vermeiden. Es kommt dabei auf den Charakter der Tätigkeit an: Präsentiert der Influencer kreativ ein Produkt (eigene Gestaltung, Foto/Video-Erstellung), spricht vieles für Abgabepflicht. Wird er bloß wegen seines Namens gebucht, ohne kreative Leistung (z. B. reines Testimonial mit vorgefertigtem Text), könnte man arguieren, es sei eher eine Namensrechtsverwertung – doch auf solche feinen Unterschiede sollte man sich nicht verlassen.
Steuerliche Stolpersteine im grenzüberschreitenden Kontext: Eng mit dem Arbeitsrecht verknüpft ist die steuerliche Behandlung, insbesondere wenn ein Creator aus dem Ausland für deutsche Kunden arbeitet. Hier lauern zwei Hauptaspekte: die Quellensteuer und die Umsatzsteuer. Nach § 50a EStG kann ein deutsches Unternehmen verpflichtet sein, von Zahlungen an im Ausland ansässige Dienstleister Quellensteuer einzubehalten und ans deutsche Finanzamt abzuführen. Diese Regel kennt man klassisch bei ausländischen Künstlern, die in Deutschland auftreten – sie gilt aber auch für „Darbietungen“, die im Inland verwertet werden. Ein Influencer-Posting, das für ein deutsches Publikum gemacht wird und hier Einnahmen generiert, kann als solche Darbietung gewertet werden. Folge: Der deutsche Auftraggeber muss z.B. 15% des Honorars an das Finanzamt als Quellensteuer abführen, sofern kein Doppelbesteuerungsabkommen entgegensteht oder der Influencer keine Befreiung nachweist. Unternehmen sollten sich hierzu beraten lassen, da die Regeln komplex sind und Fehler zu Haftung für die Steuer führen.
Zudem sollte bei Auslands-Influencern an die Umsatzsteuer gedacht werden. Erbringt ein Influencer aus Nicht-EU-Staaten eine Dienstleistung für einen deutschen Unternehmer, greift oft das Reverse-Charge-Verfahren: Der Leistungsempfänger schuldet die Umsatzsteuer in Deutschland (während der Influencer netto fakturiert). Dies sollte korrekt im Vertrag und der Rechnung abgebildet sein, um Vorsteuerabzug und Compliance sicherzustellen. Handelt es sich beim Influencer um einen Kleinunternehmer oder EU-Ausländer mit USt-IdNr., gelten wieder andere Vorgaben. Diese Punkte sprengen zwar den Rahmen eines einzelnen Vertrags, doch sie zeigen: Grenzüberschreitende Influencer-Kooperationen erfordern einen Rundumblick auf Recht und Steuern. Daher ist es ratsam, bei internationalen Kampagnen zusätzlich eine Rechtswahlklausel (z. B. deutsches Recht) und eine Gerichtsstandsvereinbarung oder Schiedsklausel zu treffen, damit im Ernstfall klar ist, wo gestritten wird.
Nicht zuletzt sind Datenschutz-Aspekte zu klären: Influencer erhalten mitunter Zugang zu personenbezogenen Daten (etwa wenn ihnen der Werbekunde Produktproben samt Adresslisten von Testern schickt, oder wenn ein Influencer-Gewinnspiel Teilnehmerdaten an den Sponsor weiterleitet). Hier greift die DSGVO. Es sollte vereinbart werden, wer in solchen Fällen Verantwortlicher ist und ob ein Auftragsverarbeitungsvertrag nötig wird. Meist dürfte der Influencer eigenverantwortlich posten (dann ist er selbst Verantwortlicher für seine Followerdaten) – doch sobald er im Auftrag des Unternehmens Daten verarbeitet, muss die DSGVO-Konformität vertraglich abgesichert sein (z. B. Standardvertragsklauseln, wenn Daten in Drittstaaten fließen). Dieser Bereich gewinnt angesichts strenger Datenschutzaufsicht an Bedeutung, gerade wenn Influencer-Teams international verteilt sind.
Zusammenfassend ist ein Creator-Vertrag 2025 weit mehr als eine simple Vereinbarung über einen Instagram-Post. Er muss ein breites Spektrum abdecken – von kreativen Leistungen über Rechteübertragungen bis hin zu arbeits-, steuer- und datenschutzrechtlichen Fragen. Sorgfältige Vertragsgestaltung unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen (wie KI) schützt beide Seiten vor bösen Überraschungen und legt den Grundstein für eine erfolgreiche, langfristige Zusammenarbeit.
Agenturverträge 2.0: Zwischen agiler Zusammenarbeit und rechtssicherer Leistungspflicht
Die Zusammenarbeit zwischen Marketing-Agenturen und ihren Kunden hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt. Starre Projektpläne weichen immer öfter einer agilen Arbeitsweise, in der Flexibilität und schnelles Reagieren auf Trends im Vordergrund stehen. Gleichzeitig erwarten Kunden natürlich weiterhin verlässliche Leistungspflichten und rechtliche Klarheit darüber, was die Agentur schuldet. Moderne Agenturverträge 2.0 versuchen, dieses Gleichgewicht herzustellen: Sie bieten genug Elastizität für kreative Prozesse und dynamische Kampagnenanpassungen, ohne an rechtlicher Verbindlichkeit einzubüßen. Im Folgenden beleuchten wir zentrale Aspekte solcher Verträge – von Retainer-Modellen über Zielvereinbarungen bis hin zu Nutzungsrechten und Haftungsfragen.
Retainer-Modelle: Agile Dauerbeziehung statt starrer Einzelauftrag
Ein wichtiger Trend in Agentur-Kunden-Beziehungen sind Retainer-Verträge. Statt jeden Auftrag einzeln abzurechnen, vereinbaren Agentur und Kunde einen laufenden Pauschalbetrag (z. B. monatlich), der die Verfügbarkeit der Agentur für eine bestimmte Leistungspalette sicherstellt. Dieses Modell fördert eine langfristige Partnerschaft und ermöglicht agiles Arbeiten, da das Budget kontinuierlich bereitsteht und flexibel auf verschiedene Aktivitäten verteilt werden kann.
Vertragsgestaltung bei Retainern: Ein Retainer-Vertrag sollte klar definieren, welche Leistungen von der Pauschale abgedeckt sind. Beispielsweise könnte geregelt sein, dass die Agentur pro Monat bis zu X Stunden Beratungsleistung, Y Social-Media-Posts und Z Grafiken erbringt. Wichtig ist, Erwartungen zu managen: Ist der Retainer eine reine Bereitschaftspauschale (d.h. die Agentur hält Kapazitäten frei, egal ob abgerufen oder nicht), oder ein Kontingent (d.h. es werden tatsächlich bestimmte Umfänge geliefert)? Wenn der Kunde in einem Monat weniger Leistung abruft, stellt sich die Frage, ob ungenutzte Stunden verfallen oder in den nächsten Monat übertragbar sind. Umgekehrt, bei Mehrbedarf: Wie werden Überstunden oder Zusatzprojekte vergütet? All das sollte transparent im Vertrag niedergelegt sein, um spätere Unstimmigkeiten zu vermeiden.
Retainer-Verträge laufen oft unbefristet mit einer gewissen Kündigungsfrist (z. B. drei Monate zum Quartalsende). Beide Seiten profitieren von Planbarkeit, können aber bei Bedarf den Vertrag beenden. Aus rechtlicher Sicht sind Retainer meist als Dienstvertrag (§§ 611 ff. BGB) einzuordnen – die Agentur schuldet ihre Tätigwerden (Beratung, Kreativleistungen), aber keinen bestimmten Erfolg. Gerade weil der konkrete Output nicht im Voraus feststeht, lässt sich schwer ein Werk definieren, das abzunehmen wäre. Dennoch kann der Vertrag bestimmte Qualitätskriterien enthalten (z. B. “entwickelt Social-Media-Strategien zur Steigerung der Engagement-Rate um X%” – als Ziel, nicht als Garantiewert). Der Vorteil des Dienstvertrags: er passt gut zur laufenden Zusammenarbeit; der Nachteil: der Kunde trägt das Risiko, dass trotz Bezahlung kein greifbarer Erfolg erzielt wird. Dieses Risiko wird in Retainer-Models jedoch durch enge Kommunikation und laufende Erfolgskontrolle gemindert.
Vorteile und Risiken: Für den Kunden bedeutet ein Retainer kalkulierbare monatliche Kosten und bevorzugte Betreuung (die Agentur hält Ressourcen bereit). Die Agentur hat ein regelmäßiges Einkommen und Planungssicherheit. Allerdings muss die Agentur aufpassen, nicht in eine Auslastungsfalle zu geraten – wenn der Kunde weit mehr Aufgaben verlangt, als das Honorar abdeckt, droht Überarbeitung oder Streit. Daher sollte intern getrackt werden, ob der Retainer wirtschaftlich aufgeht, und ggf. das Modell angepasst werden. Umgekehrt sollte der Kunde sicherstellen, dass er für sein Geld entsprechenden Einsatz erhält – regelmäßige Reportings können hier helfen (siehe unten). Insgesamt schafft ein Retainervertrag eine Rahmenstruktur, innerhalb der flexibel agiert werden kann, ähnlich einem “Sprint-Budget” pro Monat.
Zielvereinbarungen und KPI: Erfolg messbar machen, ohne Gewährleistungsfalle
Kunden möchten verständlicherweise den Erfolg der Agenturleistung sehen. Daher enthalten moderne Agenturverträge oft Zielvereinbarungen oder definieren Key Performance Indicators (KPI), die erreicht werden sollen – z. B. eine bestimmte Anzahl Leads, eine Steigerung der Follower-Zahl um X%, Klickraten, Conversion Rates usw. Diese Ziele dienen der gemeinsamen Ausrichtung und Erfolgskontrolle. Wichtig ist jedoch, sie juristisch sauber einzubetten, um keine unerwünschten Haftungsversprechen abzugeben.
Abgrenzung: Ziel vs. Garantie: Ein heikler Punkt ist die Frage, ob die Agentur die Erreichung dieser KPIs als Erfolg schuldet oder ob es sich um unverbindliche Orientierungswerte handelt. Wird im Vertrag formuliert, die Agentur “garantiere” dem Kunden 100.000 neue Follower innerhalb von 6 Monaten, so hätte sie ein sehr strenges Erfolgskriterium, dessen Verfehlen einen Vertragsmangel darstellen könnte. Das wäre rechtlich ein Werkvertrag mit geschuldetem Erfolg, und bliebe der Erfolg aus, könnte der Kunde Gewährleistung fordern oder das Honorar mindern. Da Marketing-Erfolge aber von vielen externen Faktoren abhängen (Markttrends, Algorithmusänderungen, Mitwirkung des Kunden etc.), wäre eine solche Garantie für die Agentur äußerst riskant.
In der Praxis spricht man daher lieber von “anvisierten Zielen” oder “KPIs zur Erfolgsmessung”. Der Vertrag kann z. B. festhalten: “Die Agentur entwickelt Maßnahmen, um innerhalb von 6 Monaten eine Steigerung der Reichweite um ca. 20% zu erzielen. Dieses Ziel dient der Orientierung; es wird angestrebt, aber nicht als Beschaffenheit im Sinne eines Werkvertrages geschuldet.” So ist klar, dass die Agentur sich bemühen muss (-> Dienstleistungscharakter), aber kein Erfolg garantiert ist. Der Kunde behält dennoch ein Instrument, um die Leistung zu bewerten: Bleiben die KPI weit hinter den Erwartungen, kann er z. B. außerordentlich kündigen oder im Rahmen von vertraglich vereinbarten Feedbackrunden Nachsteuerung verlangen.
Bonussysteme: Alternativ lassen sich Zielvereinbarungen mit Bonusregelungen verbinden. Wird ein bestimmtes Ziel übertroffen, erhält die Agentur einen Bonus; wird es deutlich verfehlt, könnte sie einen Malus akzeptieren (z. B. Bonus-Malus-System). Ein Bonus schafft Anreiz für die Agentur, über sich hinauszuwachsen, ohne dass der Kunde im Misserfolgsfall automatisch im Regen steht – er zahlt dann ja auch weniger. Diese Modelle müssen aber in AGB-konformen Grenzen bleiben (überzogene Malus-Vereinbarungen könnten als Vertragsstrafe gewertet und unwirksam sein). Oft genügt schon die Aussicht auf Verlängerung des Vertrags bei guten Ergebnissen als Motivation.
Reporting-Pflichten: Um Ziele zu überwachen, sollte der Vertrag Reporting- und Meeting-Pflichten festhalten. Z.B.: monatliches Reporting der wichtigsten KPI, vierteljährliche Strategie-Meetings zur Auswertung. Das schafft Transparenz. Sollte die Performance hinterherhinken, kann früh gegensteuert werden, anstatt erst am Vertragsende das böse Erwachen zu haben. Aus juristischer Sicht dienen solche Berichte auch der Dokumentation, dass die Agentur ihre Pflichten erfüllt hat – oder eben nicht. Bei Streit kann ein lückenloses Protokoll der Maßnahmen und Ergebnisse Gold wert sein.
Agile Projektstruktur und Change-Management in Verträgen
Viele Agenturen arbeiten heute nach agilen Methoden – sei es Scrum-inspiriert in der Kampagnenentwicklung oder generell iteratives Vorgehen mit fortlaufender Optimierung statt starrem Plan. Das wirft die Frage auf: Wie bildet man Agilität im Vertrag ab? Klassische Verträge gehen von einem Pflichtenheft aus, das zu Vertragsbeginn fertig definiert ist. In agilen Projekten jedoch werden Anforderungen unterwegs verfeinert oder geändert.
Vertragliche Flexibilisierung: Um das zu ermöglichen, kann ein Agenturvertrag z. B. einen Leistungskatalog auf hoher Ebene definieren, aber Details über einen definierten Prozess klären. Beispielsweise könnte vereinbart werden, dass die Agentur eine Marketing-„Produktvision“ mit dem Kunden erarbeitet (z. B. Steigerung der Markenbekanntheit in Zielgruppe X), und die konkreten Maßnahmen quartalsweise in Abstimmung festlegt. Man kann hier vom IT-Bereich lernen: Dort werden agile Verträge oft als Rahmenvertrag gestaltet, der Iterationen (Sprints) vorsieht. Für jede Iteration werden in einem Sprint-Backlog bestimmte Aufgaben (User Stories) definiert, die dann abgearbeitet und vom Kunden abgenommen werden. Übertragen auf Marketing hieße das: pro Monat oder Quartal werden z.B. Kampagnenschwerpunkte geplant (Themen, Kanäle, Inhalte), die Agentur setzt sie um und berichtet Ergebnisse, dann wird gemeinsam entschieden, was im nächsten Zyklus passiert.
Change Requests: Ein gutes Agenturvertrag beinhaltet auch ein Änderungsmanagement. Oft zeigt sich erst im Verlauf, dass zusätzliche Leistungen erforderlich werden oder bestimmte ursprünglich geplante Maßnahmen entfallen können. Hier sollte geregelt sein, wie Änderungen beantragt und freigegeben werden. Zum Beispiel: Der Kunde kann per schriftlichem Change Request eine neue Leistung anfragen (etwa zusätzliche Videoerstellung); die Agentur kalkuliert den Mehraufwand und teilt eventuelle Zusatzkosten oder Auswirkungen auf den Zeitplan mit; erst nach Zustimmung des Kunden werden die Änderungen verbindlich. So vermeidet man Streit, ob etwas vom ursprünglichen Honorar umfasst war oder nicht. Gerade wenn kein Pauschalhonorar, sondern nach Aufwand (Time & Material) abgerechnet wird, ist Transparenz über Änderungen wichtig, um Budgetüberschreitungen vorzubeugen.
Zwischenabnahmen: Bei agilen Projekten empfiehlt es sich, Zwischenergebnisse regelmäßig abzunehmen bzw. abzusegnen. Auch wenn der Vertrag insgesamt vielleicht als Dienstvertrag läuft, kann man Teilabschnitte definieren, bei denen der Kunde Ergebnisse bestätigt. Beispiel: Die Agentur erstellt im ersten Monat einen Redaktionsplan und Designkonzept – der Kunde prüft und genehmigt dies schriftlich. Später kann darauf nicht mehr beanstandet werden, was bereits freigegeben wurde. Das schafft beidseitig Klarheit. Ist der Vertrag als Werkvertrag konzipiert (etwa bei einem größeren Deliverable wie “Entwicklung einer kompletten Marketingkampagne bis Datum X”), könnten auch Etappenziele mit Teilabnahmen definiert werden, sodass am Ende nicht alles auf einmal abgenommen werden muss. So nähert man sich schrittweise dem Enderfolg.
Sicherung von Arbeitsergebnissen und Know-how bei agilen Prozessen
In agilen oder retainerbasierten Zusammenarbeiten entstehen laufend Arbeitsergebnisse – Strategiepapiere, Entwürfe, Grafiken, Texte, Datenanalysen, Reports u.v.m. Diese Zwischenergebnisse sind häufig ebenso wertvoll wie ein finales Endprodukt. Aus Kundensicht ist es daher entscheidend, dass er Zugriff und Rechte an allen relevanten Ergebnissen erhält, selbst wenn die Zusammenarbeit vorzeitig endet.
Dokumentation: Der Vertrag sollte die Agentur verpflichten, wesentliche Arbeitsergebnisse laufend zu dokumentieren und herauszugeben. Beispielsweise könnte festgelegt sein, dass die Agentur monatlich alle erstellten Content-Dateien (Bild- und Videodateien in Originalauflösung), Reports (Performance-Auswertungen, Social-Media-Statistiken) und sonstige Deliverables dem Kunden in einem vereinbarten Format zur Verfügung stellt. Im Zeitalter cloudbasierter Zusammenarbeit ist es ideal, wenn der Kunde einen direkten Lesezugriff auf Arbeitsordner oder Projektmanagement-Tools hat. Sollte das aus Sicherheitsgründen nicht gewünscht sein, reicht auch eine regelmäßige Übergabe per E-Mail oder Filesharing-Link. Wichtig: Zugangsdaten zu im Auftrag des Kunden erstellten Accounts gehören dem Kunden. Wenn die Agentur z.B. einen Google-Ads-Account oder eine Facebook-Seite für den Kunden einrichtet, muss sie am Vertragsende die Admin-Rechte sauber an den Kunden übertragen. Ähnliches gilt für jegliche Online-Accounts, Domains oder Software, die im Rahmen des Projekts genutzt wurden.
Vorzeitige Beendigung: Falls der Vertrag gekündigt wird, braucht der Kunde die bereits erstellten Ergebnisse, um ggf. mit einer anderen Agentur oder intern weiterzumachen. Daher sollte im Vertrag ein Herausgabeanspruch aller bis dahin entstandenen Werke und Unterlagen vereinbart sein. Die Agentur wiederum hat ein berechtigtes Interesse, bis dahin unbezahlte Aufwände bezahlt zu bekommen – hier greifen dann die gesetzlichen Vorschriften (bei Kündigung eines Werkvertrags z.B. § 648 BGB: Vergütung abzüglich ersparter Aufwendungen). Um Streit zu vermeiden, kann man schon im Vertrag regeln, dass im Kündigungsfall der Kunde alle bis dahin entstandenen Leistungen pro rata zu vergüten hat, bevor er die Ergebnisse nutzen darf. Zudem sollten Vertraulichkeitsklauseln sicherstellen, dass intern genutztes Know-how der Agentur, das evtl. in Unterlagen steckt, beim Kunden vertraulich bleibt.
Know-how-Schutz für die Agentur: Agil hin oder her – Agenturen bringen oft eigene Tools, Templates und Erfahrungen ein. Sie möchten ungern, dass der Kunde nach kurzer Zusammenarbeit all dieses Know-how mitnimmt und womöglich künftig selbst (oder mit Wettbewerbern) einsetzt, ohne die Agentur. Hier hilft eine vertragliche Nutzungsbeschränkung: Der Kunde darf die gelieferten Arbeitsergebnisse natürlich für seine Zwecke nutzen, nicht aber z.B. an Dritte weitergeben oder sie außerhalb des Vertragszwecks verwenden, sofern dem nicht ausdrücklich zugestimmt wurde. Ein Beispiel: Die Agentur entwickelt ein spezielles Marketing-Konzept oder ein Analyse-Tool. Sie kann im Vertrag festlegen, dass die Nutzung dieses Konzepts/Tools dem Kunden nur im Rahmen der gemeinsamen Zusammenarbeit oder für eine definierte Zeit gestattet ist. Allerdings stößt man hier an Grenzen – was einmal an Wissen transferiert wurde, lässt sich kaum kontrollieren. Wichtig ist, geistiges Eigentum der Agentur (z. B. urheberrechtlich geschützte Templates, Code, Design-Systeme) als solches zu definieren und nur lizenziert, nicht verkauft, zu übertragen, sofern es nicht exklusiv für den Kunden entwickelt wurde.
Nutzungsrechte an erstelltem Content: Wem gehört die Kampagne?
Ähnlich wie bei Influencer-Verträgen stellt sich bei Agenturleistungen die Frage der Nutzungsrechte. Wenn eine Agentur z.B. Grafiken, Werbetexte, Videos, Slogans oder Software (etwa eine Website) für den Kunden erstellt, entstehen automatisch Urheberrechte bei den kreativen Schöpfern (oft den Mitarbeitern der Agentur). Ohne spezielle Vereinbarung darf der Kunde diese Werke nur im notwendigen Umfang verwenden – was im schlimmsten Fall eng ausgelegt werden könnte. Um Rechtssicherheit zu haben, muss der Agenturvertrag die Rechteübertragung an den Kunden klar regeln.
Umfassende Rechte für den Kunden: In Werbe- und IT-Verträgen ist es üblich, dass der Auftraggeber alle erforderlichen Nutzungsrechte an den Arbeitsergebnissen erhält, regelmäßig ausschließlich, zeitlich und räumlich unbegrenzt. Für den Kunden ist das ideal: Er kann die Inhalte beliebig einsetzen (z. B. ein von der Agentur gestaltetes Logo auf all seinen Produkten weltweit, ohne zeitliche Limitierung). Wenn der Kunde die erstellten Materialien später ändern oder in anderen Zusammenhängen erneut nutzen will, muss er niemanden um Erlaubnis fragen. Ausnahmen sollte es nur geben, wo es nicht anders geht – etwa bei Nutzung von lizenziertem Drittmaterial (z. B. Stockfotos mit begrenzter Lizenz). Hierauf muss die Agentur aber hinweisen und möglichst im Vorfeld klären, ob buyouts solcher Fremdmaterialien möglich sind.
Interessen der Agentur schützen: Für Agenturen kann es dennoch wichtig sein, gewisse Rechte vorzubehalten. Zum einen möchten sie oft die Eigenwerbung erlauben – also die erstellten Kampagnen in ihrem Portfolio zeigen dürfen. Ein Vertrag sollte daher eine Klausel enthalten wie: “Die Agentur darf die für den Kunden entwickelten Arbeiten in angemessenem Umfang als Referenz für die eigene Werbung nutzen, sofern der Kunde nicht aus wichtigem Grund widerspricht.” Zum anderen entwickeln Agenturen oft Ideen und Konzepte, die evtl. nicht umgesetzt werden oder generischer Natur sind. Man denke an eine Pitch-Präsentation: Der Kunde erhält viele kreative Vorschläge, beauftragt aber am Ende nur einige davon. Ohne Regelung könnte der Kunde auch die abgelehnten Ideen später selbst umsetzen – was die Agentur ungern sieht, zumal dafür keine Vergütung gezahlt wurde. Hier hilft eine sogenannte Pitch-Schutz-Klausel: Nicht beauftragte Konzepte bleiben geistiges Eigentum der Agentur. Nur für tatsächlich vergütete Leistungen gehen die Nutzungsrechte über. In der Praxis lässt sich das nicht immer vollständig durchsetzen, aber der Hinweis schreckt zumindest ab, ungefragt Ideen zu verwenden.
Mitarbeiter und Freelancer: Agenturen sollten intern darauf achten, dass sie die Rechte an Arbeiten ihrer Mitarbeiter und Subunternehmer übertragen bekommen, um sie überhaupt an den Kunden weitergeben zu können. Angestellte erstellen in aller Regel im Rahmen ihres Jobs die Werke, und nach deutschem Urheberrecht steht das Nutzungsrecht zunächst dem Urheber (Mitarbeiter) zu, sofern nichts anderes vereinbart. Üblich ist jedoch arbeitsvertraglich festzulegen, dass Ergebnisse, die im Rahmen der Tätigkeit entstehen, auf den Arbeitgeber übergehen. Ähnliches gilt bei Freelancern: Der Agenturvertrag mit dem Kunden sollte vorsehen, dass bei Einschaltung Dritter die Agentur dafür einsteht, dass alle benötigten Rechte erworben wurden. Zudem sollte eine Freistellungsklausel vorhanden sein: Falls doch ein Dritter (etwa ein Fotograf oder Musiker) Ansprüche wegen unlizenzierter Nutzung geltend macht, muss die Agentur den Kunden von solchen Ansprüchen freistellen und den Schaden tragen. Um solche Fälle zu vermeiden, ist gründliche Rechteklärung vor Veröffentlichung essenziell.
Haftung, Gewährleistung und rechtssichere Leistungspflicht
Auch wenn es nicht explizit in der Überschrift steht, spielen Haftungsfragen in jedem Agenturvertrag eine wichtige Rolle – insbesondere im Kontext agiler Zusammenarbeit, wo nicht immer eindeutig ist, was als mangelhaft gilt.
Gewährleistung bei Werkleistungen: Erbringt die Agentur ein Werk (z. B. entwickelte Website, gedrucktes Werbematerial, fertig produziertes Video), haftet sie wie ein Hersteller für Sach- und Rechtsmängel. D.h., der Kunde kann Nachbesserung verlangen, wenn etwas nicht dem Vertrag entspricht – etwa technische Fehler, falsche Produktangaben im Text, oder Nicht-Einhaltung von Vorgaben. Bei agilen Abnahmen sollte jeder Sprint-Output so geprüft werden, damit Mängel früh auffallen. Ist ein Werk am Ende trotzdem fehlerhaft und Nachbesserung schlägt fehl, kann der Kunde Vergütung mindern oder Schadensersatz verlangen. Agenturen versuchen oft, die Gewährleistung vertraglich zu begrenzen, was im B2B-Bereich in gewissem Umfang möglich ist (solange keine Arglist oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt). Typisch sind Klauseln, die die Haftung auf vorsätzliche und grob fahrlässige Pflichtverletzungen beschränken und bei einfacher Fahrlässigkeit nur für Kardinalpflichten haften lassen. Außerdem werden oft Haftungshöchstbeträge vereinbart (z. B. maximal in Höhe des Auftragsvolumens). Solche Klauseln müssen sorgfältig formuliert sein, um der AGB-Kontrolle standzuhalten.
Haftung für Beratung und Dienstleistung: Im reinen Dienstvertrag (z. B. Strategieberatung ohne garantierten Erfolg) schuldet die Agentur keinen Erfolg, haftet aber natürlich, wenn sie Pflichten verletzt. Gibt die Agentur z.B. einen rechtlich falschen Rat (sagt, man brauche Kennzeichnung XY nicht, obwohl doch nötig), kann sie für daraus entstehende Schäden haften. Daher sollten Agenturen, die auch rechtliche oder regulatorische Aspekte beraten, stets betonen, dass sie keine Rechtsberatung im engeren Sinne leisten und im Zweifel einen Rechtsanwalt hinzuziehen. Zudem ist eine Berufshaftpflichtversicherung ratsam, was im Vertrag erwähnt werden kann.
Freistellungen zugunsten des Kunden: Oft verlangt der Kunde, dass die Agentur ihn von bestimmten Haftungsrisiken freistellt. Zum Beispiel: “Die Agentur garantiert, dass die von ihr gelieferten Inhalte keine Rechte Dritter verletzen, und stellt den Kunden von allen Ansprüchen Dritter wegen solcher Rechtsverletzungen frei.” Das schützt den Kunden etwa, wenn ein Stockfoto doch keine gültige Lizenz hatte oder ein Text plagiiert war. Für die Agentur bedeuten solche Zusicherungen viel Verantwortung – sie muss sehr sorgfältig arbeiten, um keine Claims zu provozieren. Allerdings sind sie branchenüblich und letztlich fair: Die Agentur steuert die Erstellung der Inhalte, also soll sie auch dafür gerade stehen, dass alles sauber ist (insoweit das in ihrer Kontrolle liegt).
Agilität vs. Rechtssicherheit – Fazit: Ein gut gemachter Agenturvertrag 2.0 ist flexibel in der Leistungserbringung, aber präzise in den Rechten und Pflichten. Die Kunst besteht darin, genug Spielraum für kreative Änderungen zu lassen, ohne dass Unklarheit über den Vertragsgegenstand entsteht. Dieser Balanceakt erfordert klare Sprache: Wo Verbindlichkeit nötig ist (etwa bei Terminen, Vertraulichkeit, Zahlungen, Rechten), muss sie auch formuliert werden. Wo Offenheit gewünscht ist (bei Leistungsumfang, Ideenfindung), sollte ein Verfahren beschrieben werden statt eines Ergebnisses. So wird Flexibilität vertraglich kontrollierbar.
Aktuelle Trends: KI in der Agenturarbeit und neue Technologien
Abschließend sei noch auf aktuelle Tech-Trends eingegangen, die Agenturverträge beeinflussen. Ähnlich wie bei Influencern nutzen auch Agenturen vermehrt KI-Tools, sei es für automatisierte Texterstellung, Programmatic Advertising oder Datenanalyse. Dies kann Effizienz und Output steigern, hat aber rechtliche Implikationen: Wenn eine Kampagnenidee von ChatGPT mitentwickelt wurde, stellt sich die Urheberschaftsfrage. Agenturen sollten möglichst transparente Prozesse pflegen und ihren Kunden gegenüber offenlegen, wenn KI wesentlich mitgewirkt hat – insbesondere, wenn daraus Lizenzfragen entstehen könnten. Vertraglich könnte man festhalten, dass der Einsatz von KI zulässig ist, die Agentur aber dafür einsteht, dass keine unrechtmäßigen Inhalte übernommen werden. Auch der Umgang mit neuen Content-Formaten wie NFTs, Metaverse-Events oder Virtual-Reality-Werbung könnte in modernen Verträgen angesprochen werden – hier geht es dann um neuartige Rechte (z. B. an 3D-Modellen oder Token) und ungewohnte Haftungsfragen (z. B. Haftung für Smart Contracts bei NFT-Marketing). Noch sind diese Themen Nischen, aber zukunftsorientierte Agenturverträge lassen Raum, um solche Technologien einzubeziehen, ohne gleich alles neu verhandeln zu müssen.
Datenschutz & Data Ownership: Da Marketing zunehmend datengetrieben ist, regeln fortschrittliche Verträge auch, wem die im Projekt erhobenen Daten gehören und wer sie weiterverwenden darf. Sammeln Agenturkampagnen z.B. Leads ein, sollte klar sein, dass diese Daten dem Kunden zustehen. Gleichzeitig muss die Agentur die DSGVO beachten und ggf. als Auftragsverarbeiter auftreten. Eine AVV (Auftragsverarbeitungsvereinbarung) kann als Anhang Teil des Vertrags sein, um hier Klarheit zu schaffen.
Zum Abschluss lässt sich festhalten, dass sowohl im Influencer- als auch im Agentur-Bereich die Vertragsgestaltung 2025 komplexer geworden ist – aber auch wichtiger denn je. Gut ausgearbeitete Verträge schaffen Vertrauen, minimieren Rechtsrisiken und legen den Grundstein für erfolgreiche Geschäftsbeziehungen. Unternehmen und Agenturen tun gut daran, diese Verträge regelmäßig zu aktualisieren, um neuen Entwicklungen (von Gesetzesänderungen bis Technologietrends) Rechnung zu tragen. So positionieren Sie sich als rechtssichere und zugleich innovative Player im dynamischen Umfeld des digitalen Marketings. Jede investierte Stunde in die Vertragsverhandlung zahlt sich später aus, denn sie verhindert teure Konflikte und hält den Rücken frei für das, worauf es ankommt: kreative, wirkungsvolle Kampagnen in Zusammenarbeit mit zufriedenen Influencern und Partneragenturen.