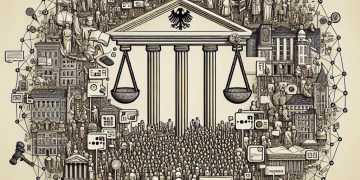Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Wichtigste Punkte
Wichtigste Punkte
- Schadensersatz erfordert Rechtsgutverletzung, Verantwortlichkeit und einen bezifferbaren Schaden im deutschen Zivilrecht.
- Es gibt vertragliche und deliktische Schadensersatzansprüche, abhängig von der Art der Pflichtverletzung.
- §249 BGB legt fest, dass der Schädiger den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen hat, durch Naturalrestitution oder Geldzahlung.
- Verschulden ist oft Voraussetzung; Schadensersatz gilt meist nur bei vorsätzlichem oder fahrlässigem Verhalten.
- Startups sollten vertragliche Schadensersatzansprüche ernst nehmen, um Forderungen bei mangelhafter Leistung zu vermeiden.
- Beweislast liegt beim Geschädigten, der den Schaden und die Pflichtverletzung nachweisen muss.
- Schadensersatzansprüche unterliegen einer Verjährung von meist 3 Jahren, abhängig von der Schadensart.
Schadensersatz bedeutet, dass jemand, der einem anderen einen Schaden zugefügt hat, diesen ersetzen muss. Im deutschen Zivilrecht greift das, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind: Rechtsgutverletzung, Verantwortlichkeit (Verschulden) und ein bezifferbarer Schaden.
Es gibt vertragliche Schadensersatzansprüche (wenn jemand eine Vertragspflicht verletzt, z. B. Lieferverzug, und dem anderen dadurch ein Schaden entsteht) und deliktische Ansprüche (aus unerlaubter Handlung, z. B. jemand beschädigt fremdes Eigentum oder verletzt eine Person).
Die zentrale Vorschrift ist § 249 BGB: Der Schädiger hat den Zustand wiederherzustellen, der bestehen würde, wenn der schädigende Umstand nicht eingetreten wäre. Das kann durch Naturalrestitution (Reparatur, Ersatzbeschaffung) oder Geldzahlung geschehen, je nachdem was möglich/angemessen ist.
Arten von Schäden: Es gibt materielle Schäden (z. B. kaputte Sache, entgangener Gewinn, Behandlungskosten) und immaterielle Schäden (Schmerzensgeld für Körper-/Persönlichkeitsverletzungen). Immaterielle werden nur ersetzt, wenn Gesetz es vorsieht (klassisch: Schmerzensgeld nach Körperverletzung oder Entschädigung bei schweren Persönlichkeitsrechtsverletzungen).
Verschulden: In der Regel setzt Schadensersatz voraus, dass der Schädiger vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat. Bei leichter Fahrlässigkeit kann vertraglich Haftung beschränkt sein (siehe Haftungsausschlüsse oben). Es gibt auch Fälle von Gefährdungshaftung (kein Verschulden nötig, z. B. Halterhaftung bei Kfz-Unfall – wer ein Auto betreibt, haftet auch ohne eigenes Verschulden bis zu gewissen Grenzen).
Für Startups sind vor allem vertragliche Schadensersatzansprüche relevant: Wenn man selbst eine Leistung nicht richtig erbringt und dem Kunden entsteht dadurch Schaden – dann drohen Forderungen. Deshalb wichtig: Verträge sorgfältig erfüllen und ggf. Haftung begrenzen (wie oben beim Haftungsausschluss erläutert).
Beweislast: Der Geschädigte muss grundsätzlich den Schaden und die Pflichtverletzung beweisen. Allerdings gibt es Konstellationen wie Produkthaftung oder spezielle Garantieversprechen, wo Beweiserleichterungen greifen. Der Schaden muss außerdem konkret nachgewiesen werden (z. B. Rechnung über Reparaturkosten, Gutachten über Wertminderung etc.).
Berechnung: Man versucht, den Gesamtschaden finanziell auszugleichen. Bei Sachschäden sind es Reparaturkosten oder Wiederbeschaffungswert. Bei Vermögensschäden (z. B. entgangener Gewinn durch verspätete Lieferung) wird es komplizierter: Man muss hypothetisch ermitteln, was ohne die Verzögerung an Gewinn erzielt worden wäre.
Voraussetzungen für Schadensersatz im Überblick
Im Allgemeinen braucht es:
Pflichtverletzung oder Rechtsgutverletzung – entweder eine vertragliche Pflicht wurde verletzt oder ein geschütztes Rechtsgut (Eigentum, Gesundheit, Freiheit etc.) im Delikt.
Verschulden – der Schädiger hat vorsätzlich (absichtlich) oder fahrlässig (außer Acht lassen der erforderlichen Sorgfalt) gehandelt. Fahrlässig ist schon, wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht lässt (§ 276 II BGB).
Schaden beim Geschädigten – eine nachteilige Veränderung seiner Güter/Lage, die messbar ist.
Kausalität – Die Handlung des Schädigers muss ursächlich für den Schaden sein (inkl. Adäquanz, also nicht völlig unvorhersehbar).
Rechtswidrigkeit – in der Regel gegeben, wenn Pflichtverletzung vorliegt (außer bei Rechtfertigungsgründen).
Beispiel vertraglich: Eine Baufirma verzögert sich mit der Fertigstellung eines Bürogebäudes um 3 Monate, sodass der Auftraggeber Miete für Ersatzbüros zahlen muss. Hier liegt eine Pflichtverletzung (Verzug), Verschulden wenn Baufirma es zu vertreten hat (z.B. schlechte Planung), Schaden = zusätzliche Miete, Kausalität offensichtlich. Der Auftraggeber kann Ersatz dieser Kosten verlangen.
Beispiel deliktisch: Ein Kurierfahrer fährt unachtsam und beschädigt ein parkendes Auto. Pflichtverletzung: Verkehrsregel missachtet -> Rechtsgutverletzung (Eigentum am Auto). Verschulden: Fahrlässig. Schaden: Reparaturkosten, evtl. Wertminderung, Nutzungsausfall. Kausalität gegeben, Rechtswidrig (keine Rechtfertigung). Der Halter des Autos kann vom Fahrer (bzw. dessen Versicherung) Schadensersatz fordern.
Naturalrestitution und Geldersatz
Das Gesetz präferiert, dass der Schaden direkt wieder gutgemacht wird (Naturalrestitution). Z.B.: Jemand hat die Wand des Nachbarn beschmutzt, also soll er sie neu streichen (statt Geld zahlen). Oft ist jedoch Geldersatz praktischer – man zahlt den Betrag, damit der Geschädigte es selbst instand setzen lassen kann.
In vielen Fällen wie Körperverletzung kann man den alten Zustand nicht herstellen -> hier kommt dann Schmerzensgeld ins Spiel (Geld als Ausgleich immaterieller Schäden, § 253 BGB).
Entgangener Gewinn (§ 252 BGB) wird auch ersetzt, soweit er wahrscheinlich angefallen wäre. Das ist oft Streitpunkt, weil hypothetisch. Aber z.B. wenn jemand deine Ware zerstört, die du hättest verkaufen können, kann man den entgangenen Gewinn verlangen.
Typische Schadenspositionen
Bei Sachbeschädigung: Reparaturkosten, wenn Reparatur möglich und wirtschaftlich (bis ca. 130% des Wiederbeschaffungswerts sagt man). Ist Totalschaden, dann Wiederbeschaffungswert minus Restwert. Wertminderung, wenn trotz Reparatur der Marktwert sinkt (z.B. Unfallwagen). Mietwagenkosten oder Nutzungsausfall, weil man das Auto nicht nutzen konnte.
Bei Personenschaden: Heilbehandlungskosten, Verdienstausfall, Schmerzensgeld. Eventuell Haushaltsführungsschaden (wenn man wegen Verletzung den Haushalt nicht führen kann und Hilfe braucht).
Bei Verzug im Geschäft: z.B. Kosten für Ersatzbeschaffung, Konventionalstrafen, die man an Dritte zahlen musste, entgangener Gewinn, Mehrkosten durch Preiserhöhung in Zwischenzeit.
Bei Datenverlust: Fall in IT: Wenn durch Fehler des Dienstleisters Daten verloren gehen, kann Schaden z.B. Wiederherstellungskosten oder Arbeitsaufwand zur Neuerstellung sein. Hier problematisch: ideelle Werte lassen sich kaum beziffern, idR nur der finanzielle Aufwand ist ersatzfähig.
Rechtsverfolgungskosten: Wer durch Schuld eines anderen in einen Rechtsstreit oder Abmahnung verwickelt wird, kann i.d.R. die notwendigen Anwaltskosten als Schaden geltend machen (z.B. Unfallgeschädigter darf sich Anwalt nehmen und der Schädiger muss zahlen).
Begrenzung der Haftung
Wie im Abschnitt Haftungsausschluss angesprochen, versuchen Unternehmen oft, die möglichen Schadensersatzpflichten zu begrenzen. Denn unbegrenzt gehaftet, könnte ein einzelner Fehler existenzbedrohend werden.
Man kann z.B. im Vertrag sagen: „Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist auf 100.000 € begrenzt und es werden keine indirekten Schäden ersetzt.“ Dann hat der Vertragspartner zugestimmt, nur bis zu dem Betrag Ersatz zu fordern (sofern wirksam vereinbart).
Im B2C-Bereich sind solche Begrenzungen nur eingeschränkt möglich (keine Begrenzung bei Personenschäden, und auch bei Kardinalpflichten unwirksam, wenn zu niedrig angesetzt).
In der Praxis: Startups sollten auf potentielle Schadensrisiken achten. Zum Beispiel: Du betreibst einen Cloud-Dienst, der bei Ausfall Datenverlust und Produktionsstillstand bei Kunden bewirken könnte => Du möchtest in deinen AGB die Haftung dafür beschränken, etwa „maximal in Höhe eines Monatsbeitrags“ oder so. Ob das hält, hängt vom Kundenkreis (B2B kann man mehr vereinbaren, B2C schwerer) ab, aber es ist besser als nichts.
Durchsetzung und Verjährung
Ein Geschädigter muss seinen Schadensersatzanspruch durchsetzen, notfalls vor Gericht. Dort muss er den Schaden auch belegen (Gutachten, Belege, Zeugenaussagen etc.).
Schadensersatzansprüche verjähren grundsätzlich nach 3 Jahren ab Ende des Jahres, in dem man von Schaden und Person des Ersatzpflichtigen Kenntnis hatte (bzw. grob fahrlässig keine Kenntnis). Es gibt Sonderfristen: Im Kaufrecht Gewährleistung = 2 Jahre, was auch für Mangelfolgeschäden gilt, und bei unerlaubter Handlung, die Leben/ Körper/ Gesundheit betrifft: 30 Jahre (absolute Frist). Auch bei vorsätzlicher Verletzung: 30 Jahre.
Exkurs: Vertragsstrafe vs Schadensersatz
Manchmal wird statt auf ungewissen Schadensersatz eine Vertragsstrafe vereinbart, z.B. in Unterlassungserklärungen („für jeden Verstoß 5.000 € Vertragsstrafe“). Diese muss man dann zahlen, ohne dass der konkrete Schaden nachgewiesen wird. Das ist aber ein eigenständiger Anspruch, nicht identisch mit Schadensersatz, aber es dient quasi als pauschalierter Sanktionsbetrag.
Fazit
Schadensersatz ist im Geschäftsleben allgegenwärtig in dem Sinne, dass man immer im Hinterkopf haben muss: „Wenn ich Mist baue, muss ich dafür geradestehen.“ Juristisch heißt das, den finanziellen Nachteil des anderen ausgleichen. Für Privatleute ist oft die Haftpflichtversicherung der Helfer in der Not (z.B. bei Unfällen). Firmen haben Betriebshaftpflicht oder Produkthaftpflichtversicherungen, um sich vor ruinösen Forderungen zu schützen. Und vorbeugend hilft es, Verträge sauber zu erfüllen, Risiken zu minimieren und wo möglich Haftung zu begrenzen.
Ein Geschädigter wiederum sollte wissen, dass ihm nicht jeder Unmut ersetzt wird – es muss ein bezifferbarer Schaden sein und jemand, dem das rechtlich zugerechnet werden kann. Dann allerdings steht ihm das Recht zu, so gestellt zu werden, als wäre nichts passiert – was letztlich das Ziel des Schadensersatzes ist: Gerechtigkeit durch Ausgleich des erlittenen Verlustes.