Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
BGH zum OS-Link (Streitbeilegungsplattform der EU)
Hin und wieder hab ich als Rechtsanwalt den Verdacht, dass es Kollegen und Gerichte doch zu langweilig ist, wenn diese...
Mehr lesenDetailsDigitale Produkte werden selten noch „direkt“ vom Entwickler an Endkunden verkauft. In App-Ökosystemen steht fast immer ein App-Store zwischen Entwickler und Nutzer: Er stellt die Oberfläche bereit, kuratiert Inhalte, verwaltet Kundenkonten, wickelt Zahlungen ab und erlässt Nutzungsbedingungen. Umsatzsteuerlich ist das nicht bloß Dekor. Entscheidend ist die Frage, wer gegenüber dem Endkunden als Leistender gilt und wo die Leistung steuerlich stattfindet. Genau hier setzt die jüngste Rechtsprechung des EuGH zur Dienstleistungskommission/Leistungskette an – und zwar nicht nur für die Zeit ab 2015 (seit Einführung von Art. 9a MwStVO und § 3 Abs. 11a UStG), sondern ausdrücklich auch für Altjahre vor dem 1. Januar 2015.
Für die Praxis kleiner Studios, Indie-Entwickler und App-/Games-Anbieter bringt das Urteil eine klare Orientierungslinie: Tritt der App-Store im Kaufprozess im eigenen Namen auf und steuert/autorisiert er die Zahlung, wird der Store umsatzsteuerlich als Anbieter fingiert. Der Entwickler erbringt seine Leistung in diesem Fall an den App-Store (B2B), der Store an den Endkunden (B2C). Das ist der Kern der Leistungskette – und der Grund, weshalb Rechnungsstellung, Leistungsort, Steuerlast und AGB-Architektur anders verlaufen als beim Direktverkauf.
Schon vor 2015 galt der Grundsatz der Dienstleistungskommission (im Umsatzsteuerrecht üblicherweise „Leistungskette“): Handelt ein Unternehmer im eigenen Namen, aber für Rechnung eines anderen, wird steuerlich fingiert, dass zwei gleichartige Leistungen vorliegen. Zivilrechtlich vermittelt der Store ggf. „nur“ – steuerrechtlich kauft und verkauft er.
Die Systematik:
Jede dieser beiden fingierten Leistungen folgt eigenständig den allgemeinen Regeln (Leistungsort, Zeitpunkt, Bemessungsgrundlage, Steuerschuldnerschaft). Bei Services gilt für den ersten Umsatz (Entwickler → Store) regelmäßig die B2B-Grundregel: Leistungsort ist der Sitz des App-Stores; es greift also typischerweise Art. 44 MwStSystRL/§ 3a Abs. 2 UStG (Reverse-Charge-Logik bzw. Ortsverlagerung). Der zweite Umsatz (Store → Endkunde) wird dort besteuert, wo der Endkunde sitzt (B2C-Regime für elektronisch erbrachte Leistungen).
Der Knackpunkt in der Vor-2015-Rechtslage lag häufig in der Abgrenzung: tritt der Store im eigenen oder im fremden Namen auf? Und: reichen spätere Hinweise (z. B. in Bestellbestätigungen) aus, um ein fremdes Namenhandeln anzunehmen? Diese Unsicherheiten prägten viele Verfahren – und wurden im „Xyrality“-Fall vom EuGH aufgegriffen und bereinigt.
Im Ausgangsfall (Streitjahre 2012–2014) wurde die App kostenfrei über einen irischen App-Store verteilt; In-App-Käufe (digitale Inhalte) wurden innerhalb der App über ein Store-Popup mit Store-Logo initiiert, die Zahlung lief vollständig über den App-Store, und der Store zog das Entgelt ein. Erst nach Abschluss erhielten Endkunden E-Mails, in denen die Entwicklerin als Leistende benannt und (fälschlich) deutsche Umsatzsteuer ausgewiesen wurde.
Der EuGH bestätigt drei praxistragende Punkte:
Bemerkenswert ist die Brücke zur Zeit ab 2015: Der EuGH betont, dass Art. 9a MwStVO (seit 1. 1. 2015) kein neues Konzept ist, sondern den Inhalt von Art. 28 MwStSystRL verdeutlicht. Mit anderen Worten: Auch vor 2015 war bei Plattform-Zwischenschaltung und eigenem Auftreten des Stores im Kaufprozess die Leistungskette anzuwenden – genau das trägt die Entscheidung.
Seit 2015 greift für elektronische Dienstleistungen über Schnittstellen/Portale (App-Stores, digitale Marktplätze) eine klare Fiktion: Die Plattform gilt als Leistender, wenn sie in die Erbringung der Dienstleistung eingeschaltet ist und typischerweise Zahlungsautorisierung/Abrechnung kontrolliert. Praktisch ist damit in B2C-Konstellationen nahezu immer der Store als Anbieter anzusehen – es sei denn, die Plattform tritt nachweisbar und deutlich „im fremden Namen“ auf und überlässt dem Entwickler den Vertragsschluss und die Zahlungsabwicklung.
Für Entwickler bedeutet dies:
Kurz: Kontrolliert die Plattform den Checkout, wird sie steuerlicher Anbieter; kontrolliert der Entwickler den Checkout, wird er steuerlicher Anbieter. Dazwischen gibt es kaum „Hybridmodelle“, ohne dass Rollen, Vertragswerk und Nutzerführung vollkommen eindeutig ausgerichtet sind.
Ob ein Store im eigenen oder im fremden Namen auftritt, erschließt sich nicht aus späteren Dokumenten, sondern aus dem Kaufprozess selbst: Wer ist für den Kunden erkennbar Vertragspartner? Wer autorisiert die Zahlung? Wer stellt die Allgemeinen Bedingungen der Leistungserbringung? Wer entscheidet über Refunds und Fraud? Wer ermöglicht oder verweigert den Zugang zum digitalen Inhalt?
Die Praxis zeigt ein Muster:
Die Schwelle für „im fremden Namen“ ist hoch. Es genügt nicht, in E-Mails oder PDFs später den Entwickler zu erwähnen. Maßgeblich ist die Erstkommunikation im Kaufmoment.
Rechnungsstellung:
Leistungsort/Steuerschuld:
Vertrags/AGB-Architektur:
Buchhaltung/Compliance:
Apple und Google fungieren selbst als Anbieter im Endkundengeschäft, wenn Services über ihre Kassen laufen. Preis- und Steueranzeige erfolgen brutto; die Stores führen die zutreffende USt/MwSt im Käuferland ab und rechnen netto (abzgl. Provision) mit Entwicklern ab. Das reduziert die Steuer- und Rechnungsbelastung auf Entwicklerseite, verschiebt aber Vertrags- und Haftungsfragen (Refunds, Betrug, Chargebacks, AGB-Hoheit, Delistings) in Richtung Plattform.
Wird hingegen ein externer Zahlungsweg (z. B. „Kauf über Website des Entwicklers“) eröffnet, wechselt die umsatzsteuerliche Rolle: Der Entwickler wird gegenüber dem Endkunden selbst zum Anbieter – mit OSS-Pflichten und Belegerstellung. Entsprechend benötigen AGB, Checkout-Texte und Kundenkommunikation klare Rollenbilder: Wer verkauft? Wessen AGB? Wessen Rechnung? Je uneindeutiger, desto höher das Risiko, dass Steuer- und Zivilrollen auseinanderfallen.
Ablauf festlegen: Wer kontrolliert die Kasse? Wer autorisiert die Zahlung? Wer stellt die Leistungsbedingungen? Antwortet man dreimal „Store“, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass eine Leistungskette vorliegt und der Store steuerlicher Anbieter ist.
Kommunikation im Checkout: Eindeutige, frühzeitige Benennung des Vertragspartners ist Pflicht. Ein „Verstecken“ des Entwicklers/Stores bis zur Bestellmail schafft kein fremdes Namenhandeln.
AGB und Verträge synchronisieren: Entwickler-AGB für B2B-Leistung an den Store vs. Endkunden-AGB beim Direktverkauf. In Store-AGB darauf achten, dass Rechteketten (Lizenzen, Keys, DLC, virtuelle Währung) vollständig an den Store übertragen/nutzbar gemacht werden.
Rechnungslogik:
§ 14c-Kontrolle: Bei falschem USt-Ausweis an Privatkunden – kein Automatismus zur Steuerschuld; dennoch Dokumentation und Korrektur vorsehen, um spätere Diskussionen zu vermeiden.
Technik & Beweisführung: Store-UI, Zahlungs-Flows, AGB-Screens und Checkout-Screens beweisbar archivieren. In Streitfällen zählt der Kaufzeitpunkt – nicht nachgereichte PDF-Hinweise.
Nicht jede Plattform ist Apple/Google. Viele digitale Marktplätze – etwa SaaS-Hubs, App-Stores für Shop-Systeme (z. B. Themes/Plugins), Add-on-Marktplätze für Tools, CMS oder Game-Mods – zwingen Entwickler nicht in ein zentrales Payment. Daraus folgt: Die umsatzsteuerliche Rolle ist gestaltbar, aber auch fehleranfällig.
Zielbild 1: Reiner Vermittler (Listing-/Discovery-Plattform)
Will eine Plattform nicht als steuerlicher Anbieter gelten, muss sie konsequent die Rolle eines reinen Vermittlers leben:
Zielbild 2: „Light-Reseller“ (mischt mit, will aber nicht der Verkäufer sein)
Viele Marktplätze möchten Kontroll- oder Komfortfunktionen (z. B. one-click buy, einheitliche Refund-Policy, „Käuferschutz“), ohne steuerlicher Anbieter zu werden. Gefahr: Je mehr die Plattform den Checkout „besitzt“, Zahlungen autorisiert, Nutzungsbedingungen vorgibt oder Lieferungen freigibt, desto eher liegt Eigenauftreten vor – und damit die Leistungskette zu Lasten der Plattform (sie gilt dann als Anbieter). Wer diesen Mittelweg wählt, muss streng trennen:
Zielbild 3: Voll-Reseller (bewusst Anbieter)
Wer – aus Komfort, Trust oder Monetarisierung – bewusst als Anbieter auftreten will (z. B. um einheitliche Rechnungen zu stellen), sollte die Rolle aktiv annehmen:
Fallstricke und To-dos:
Bottom line: Wer keinen Apple/Google-ähnlichen „Kassen-Monolithen“ betreibt, kann die steuerliche Rolle steuern – aber nur mit konsistenter Rollenentscheidung, klaren AGB, eindeutiger UX und belegbarer Zahlungslogik.
Die Leistungskette ist im digitalen Vertrieb kein Nischenthema, sondern die Regel, sobald eine Plattform sichtbar den Kaufprozess beherrscht. Das EuGH-Urteil „Xyrality“ bestätigt für Altjahre und aktuelle Fälle gleichermaßen: Wer im eigenen Namen auftritt und die Kasse kontrolliert, gilt als Leistender. Für Entwickler heißt das: Mit Store-Kasse wird B2B an den Store abgerechnet; bei eigenem Checkout ist die eigene USt-Engine Pflicht. Plattformanbieter außerhalb des Apple/Google-Modells können die Rolle gestalten – aber nur, wenn Checkout, AGB und Abrechnung konsistent beweisen, dass der Entwickler (und nicht der Marktplatz) der Verkäufer ist. Eine klare Entscheidung für Reseller oder Vermittler spart Diskussionen mit der Finanzverwaltung, schützt vor § 14c-Risiken und schafft belastbare Prozesse – in Games, Apps, SaaS-Ökosystemen und darüber hinaus.
Marian Härtel ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für IT-Recht mit einer über 25-jährigen Erfahrung als Unternehmer und Berater in den Bereichen Games, E-Sport, Blockchain, SaaS und Künstliche Intelligenz. Seine Beratungsschwerpunkte umfassen neben dem IT-Recht insbesondere das Urheberrecht, Medienrecht sowie Wettbewerbsrecht. Er betreut schwerpunktmäßig Start-ups, Agenturen und Influencer, die er in strategischen Fragen, komplexen Vertragsangelegenheiten sowie bei Investitionsprojekten begleitet. Dabei zeichnet sich seine Beratung durch einen interdisziplinären Ansatz aus, der juristische Expertise und langjährige unternehmerische Erfahrung miteinander verbindet. Ziel seiner Tätigkeit ist stets, Mandanten praxisorientierte Lösungen anzubieten und rechtlich fundierte Unterstützung bei der Umsetzung innovativer Geschäftsmodelle zu gewährleisten.
Hin und wieder hab ich als Rechtsanwalt den Verdacht, dass es Kollegen und Gerichte doch zu langweilig ist, wenn diese...
Mehr lesenDetailsWenn du dich entschieden hast, ein Startup zu gründen, wirst du dir Gedanken über die richtige Rechtsform machen müssen. Je...
Mehr lesenDetailsDas Landgericht München II hat den Angeklagten wegen Volksverhetzung in elf Fällen und wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen zu...
Mehr lesenDetailsAI Literacy und die Auslegung von Artikel 4 des EU AI Acts Der am 1. August 2024 in Kraft getretene...
Mehr lesenDetailsIn Zusammenarbeit mit der Hamburger Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Senioren sowie der Finanzbehörde ist es der Hamburger Sportjugend...
Mehr lesenDetailsEs ist Montag morgen und mir fällt gerade eine Grafik in die Hand, die zeigt, dass man als IT-Unternehmen wohl...
Mehr lesenDetailsDer Bundesgerichtshofs hat entschieden, dem Gerichtshof der Europäischen Union Fragen zur Klärung des urheberrechtlichen Begriffs des Pastiches vorzulegen. Sachverhalt: Der...
Mehr lesenDetailsPassend zu den zahlreichen Urteilen und Entwicklungen im Glücksspielrecht, die man hier auf dem Blog ausreichend findet, gibt es nun...
Mehr lesenDetailsEine neue Masche bei Kriminellen wird wohl gerade beliebt und basiert auf den automatischen Content-ID Funktionen von YouTube bzw. auf...
Mehr lesenDetailsMit Urteil vom 27. Januar 2026 (KZR 10/25) hat der Kartellsenat des Bundesgerichtshofs eine Patentverletzungsklage aus standardessenziellen Patenten (SEP) bestätigt...
Mehr lesenDetails 120 Minuten: Videoberatung via Microsoft Teams 120 Minuten – Ausführlich, vertieft und individuell
535,50 €
120 Minuten: Videoberatung via Microsoft Teams 120 Minuten – Ausführlich, vertieft und individuell
535,50 €inkl. MwSt.
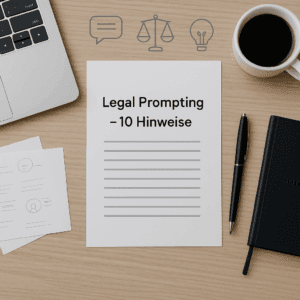 1 Pager „10 wichtigste Hinweise zum Legal Prompting
0,00 €
1 Pager „10 wichtigste Hinweise zum Legal Prompting
0,00 €inkl. MwSt.
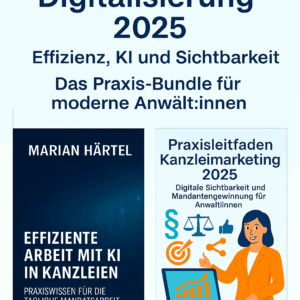 Kanzlei-Digitalisierung 2025: Effizienz, KI und Sichtbarkeit – Das Praxis-Bundle für moderne Anwält:innen
89,99 €
Kanzlei-Digitalisierung 2025: Effizienz, KI und Sichtbarkeit – Das Praxis-Bundle für moderne Anwält:innen
89,99 €inkl. MwSt.
 Videoberatung via Microsoft Teams 60 Minuten – Flexibel, unkompliziert und individuell
327,25 €
Videoberatung via Microsoft Teams 60 Minuten – Flexibel, unkompliziert und individuell
327,25 €inkl. MwSt.
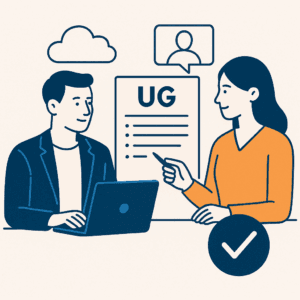 Mustersatzung für eine UG (haftungsbeschränkt)
0,00 €
Mustersatzung für eine UG (haftungsbeschränkt)
0,00 €inkl. MwSt.
In diese Episode wird die komplexe Beziehung zwischen dem 'Fail Fast'-Prinzip und den Verantwortlichkeiten der Gründer gegenüber Investoren und Mitarbeitern...
Mehr lesenDetailsIn diesem Video rede ich ein wenig über transparente Abrechnung und wie ich kommuniziere, was es kostet, wenn man mit...
Mehr lesenDetails
















