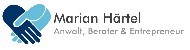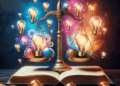„Fail fast, fail often“ – kaum ein Motto prägt die Startup-Kultur so sehr wie die Idee, schnell auszuprobieren und notfalls ebenso schnell zu scheitern. In der Tech-Branche gilt Scheitern oft als Teil des Weges zum Erfolg und wird beinahe romantisiert. Tatsächlich fördert das Fail-Fast-Prinzip agile Experimente und rasches Lernen, um Geschäftsmodelle iterativ anzupassen. Scheitern wird so zum akzeptierten Lernschritt auf dem Weg zu potenziellem Wachstum.
Allerdings bewegt sich dieses Mindset auf dünnem Eis, sobald Fremdkapital und Mitarbeiter im Spiel sind. Was aus Sicht des Gründers als mutige Risikobereitschaft verkauft wird, kann aus Perspektive von Investoren oder Mitarbeitern als leichtfertiger Umgang mit anvertrautem Vertrauen und Vermögen erscheinen. Spätestens wenn Gründer wissentlich ein riskantes Scheitern in Kauf nehmen, stellt sich die Frage: Wann schlägt “fail fast” in Täuschung um?
Diese Ausarbeitung beleuchtet ausführlich die rechtlichen Grenzen der Risikokultur in Startups. Im Fokus stehen die Verantwortung von Gründern gegenüber Business Angels, Frühphaseninvestoren und Mitarbeitern, insbesondere wenn bewusst instabile oder hochriskante Geschäftsmodelle verfolgt werden. Wir betrachten die zivil- und strafrechtlichen Maßstäbe – von Aufklärungspflichten bis Betrugstatbeständen – und erörtern, ab wann kalkuliertes Risiko nicht mehr vom Gründer-Mantra gedeckt ist, sondern als Täuschung oder sittenwidriges Verhalten gegenüber Stakeholdern zu werten ist. Auch besondere Konstellationen wie ausländische Investoren (USA) und typische vertragliche Vorkehrungen (Term Sheets, Mitarbeiterbeteiligungen, Wandeldarlehen, SAFE-Agreements etc.) werden praxisnah analysiert.
Ziel ist ein juristisch fundierter, aber praxisnaher Leitfaden für Gründer, Investoren und Unternehmensjuristen, um die Gratwanderung zwischen innovativer Risikofreude und rechtlicher Verantwortung sicher zu meistern.
Verantwortung des Gründers gegenüber Investoren und Mitarbeitern
Startup-Gründer tragen nicht nur Vision und Risiko, sondern auch Verantwortung gegenüber ihren Stakeholdern. Bereits in der Frühphase entstehen gegenüber Investoren und Mitarbeitern bestimmte Sorgfalts- und Treuepflichten. Auch wenn Startups naturgemäß unsichere Wagnisse sind, entbindet dies Gründer nicht davon, ehrlich und fair mit den berechtigten Erwartungen ihrer Partner umzugehen.
Vertrauensbasis mit Investoren
Frühphasen-Investoren (wie Business Angels oder Seed-Investoren) vertrauen den Angaben der Gründer, da es mangels belastbarer Zahlen vor allem auf die Darstellung des Geschäftsmodells, des Marktes und der Planung ankommt. Hier besteht eine implizite Treuepflicht der Gründer, keine unrealistischen Versprechungen zu machen oder wesentliche Risiken zu verschweigen. Zwar trägt ein Venture-Investor das Risiko des Totalverlusts – und erfahrene Investoren wissen, dass nur ein Bruchteil der Startups erfolgreich wird –, jedoch dürfen Gründer dieses Vertrauen nicht missbrauchen, indem sie Informationen asymmetrisch zu ihrem Vorteil ausnutzen. Informationsasymmetrien prägen jede Startup-Finanzierung: Die Gründer kennen das Produkt und die wahren Herausforderungen meist besser als die Geldgeber. Diese Asymmetrie begründet eine Pflicht, die Geldgeber wahrheitsgemäß über alle wesentlichen Umstände zu informieren, damit diese eine fundierte Entscheidung treffen können.
Eine Verletzung dieser Pflicht kann nicht mit dem Hinweis gerechtfertigt werden, der Investor hätte ja sorgfältiger prüfen können. Selbst wenn ein Investor fahrlässig optimistisch oder unerfahren agiert, entlastet das den Gründer nicht von seiner Verantwortlichkeit: Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung ändert auch grobe Leichtgläubigkeit des Investors nichts an der Beurteilung eines Täuschungsverhaltens als Betrug. Mit anderen Worten: Auch ein leichtsinniger Investor hat rechtlich Anspruch auf wahrheitsgemäße Informationen. Gründer müssen also von Anfang an bewusst sein, dass aktives Täuschen oder verschweigen kritischer Fakten nicht vom „üblichen Startup-Risiko“ gedeckt ist, sondern Haftungsansprüche und sogar Strafbarkeit begründen kann.
Verantwortung gegenüber Mitarbeitern
Ähnlich gilt für Mitarbeiter in jungen Unternehmen: Diese verlassen sich darauf, dass die Gründer eine realistische Perspektive bieten und nicht wissentlich unmögliche Versprechungen machen. Gerade früh angeworbene Mitarbeiter verzichten oft auf sichere Alternativen, weil sie an die Vision des Startups glauben – häufig gelockt durch Mitarbeiterbeteiligungen oder Stock Options, die im Erfolgsfall lukrativ sein sollen. Hier haben Gründer zumindest moralisch, wenn nicht rechtlich, eine Fürsorgepflicht, die Belegschaft nicht ins offene Messer laufen zu lassen.
Rechtlich manifestiert sich diese Verantwortung in vorvertraglichen Aufklärungspflichten beim Einstellen von Personal. Verschweigt ein Arbeitgeber den Neueinsteigern die wahre finanzielle Lage oder das absehbare Scheitern des Unternehmens, kann dies eine Haftung wegen Verletzung vorvertraglicher Pflichten (§§ 280 Abs.1, 311 Abs.2 BGB) auslösen. So hat etwa ein Arbeitsgericht entschieden, dass ein Geschäftsführer die Pflicht des Arbeitgebers verletzte, als er einem Bewerber gegenüber die tatsächlich schlechte Auftragslage verschwieg und stattdessen einen gesunden Eindruck des Unternehmens vortäuschte. In dem Fall konnte der Arbeitnehmer nachweisen, dass er seine vorherige ungekündigte Stelle nur aufgrund der falschen Darstellung aufgegeben hatte. Zwar scheiterte die Klage letztlich mangels nachweisbaren Schadens (der Mitarbeiter konnte kurzfristig zu alten Konditionen weiterarbeiten, doch stellte das Gericht klar, dass der Geschäftsführer hier vorsätzlich eine falsche Vorstellung vermittelt hatte . Die Botschaft ist eindeutig: Gründer dürfen Bewerber nicht arglistig in ein sinkendes Schiff locken. Wer neue Mitarbeiter einstellt, obwohl bereits absehbar ist, dass das Startup in Kürze scheitern oder drastisch Stellen abbauen muss, verletzt die berechtigten Erwartungen der Betroffenen an eine ehrliche Kommunikation. Im Ernstfall können Schadensersatzansprüche für sogenannte “Einstellungsbetrug” entstehen – z.B. Ersatz des Verdienstausfalls, wenn der Mitarbeiter seine alte Stelle aufgegeben hat.
Zusammengefasst besteht eine Vertrauensbasis zwischen Gründern, Investoren und Mitarbeitern, die durch Offenheit und Redlichkeit geschützt werden muss. “Fail fast” entbindet nicht von Fairness: Weder Kapitalgeber noch Mitarbeiter dürfen zu bloßen Figuren in einem hochriskanten Experiment degradiert werden, ohne dass sie um die Risiken wissen.
Rechtliche Grenzen: Von Aufklärungspflicht bis Betrug
Die deutsche Rechtsordnung gesteht Unternehmern zwar weiten Spielraum für Wagnisse zu, zieht aber klare Grenzen bei Täuschung und Betrug. Relevant sind hier sowohl zivilrechtliche Ansprüche enttäuschter Stakeholder als auch strafrechtliche Konsequenzen bei gravierender Täuschung. Im Folgenden ein Überblick über die wichtigsten Normen und Rechtsprechungsgrundsätze, die definieren, wann riskantes Geschäftsgebaren illegal wird.
Zivilrechtliche Aufklärungspflichten und Haftung
Im Zivilrecht gilt der Grundsatz von Treu und Glauben (§ 242 BGB) und der Pflicht zu redlichem Verhalten schon bei Vertragsanbahnung. Konkret bedeutet dies: Wer einen Vertrag (etwa mit einem Investor oder Mitarbeiter) abschließt, muss den anderen Part über entscheidungswesentliche Umstände aufklären, sofern der andere diese Informationen vernünftigerweise erwarten durfte. Unterlässt er dies oder stellt Sachverhalte bewusst falsch dar, kann der Vertrag später angefochten werden oder Schadensersatzansprüche aus culpa in contrahendo (Verschulden bei Vertragsverhandlungen) resultieren.
§ 123 BGB (Anfechtung wegen arglistiger Täuschung) erlaubt es, einen Vertrag rückgängig zu machen, wenn er durch Täuschung zustande kam. Ein getäuschter Investor könnte also seine Beteiligungsvereinbarung anfechten, wenn der Gründer ihn arglistig in die Investition gelockt hat. Die Anfechtung muss innerhalb eines Jahres nach Entdeckung der Täuschung erfolgen. Ist sie erfolgreich, wird der Vertrag als von Anfang an nichtig behandelt – der Investor hätte Anspruch auf Rückzahlung seines Investments, müsste im Gegenzug jedoch erhaltene Geschäftsanteile zurückübertragen (was im Insolvenzfall des Startups faktisch wertlos sein kann). Wichtig: Arglistig ist nicht nur die bewusste Lüge, sondern auch das bewusste Verschweigen von Tatsachen, zu deren Offenlegung man verpflichtet war. Schweigen ist nur dann keine Täuschung, wenn keine Aufklärungspflicht besteht. Bei Kapitalanlagen besteht jedoch regelmäßig eine Pflicht, über alle Umstände, die für die Anlageentscheidung von wesentlicher Bedeutung sind, zutreffend zu informieren. So hat der BGH etwa betont, dass im Anlageprospekt klar auf das maximale Verlustrisiko (bis hin zum Totalverlust) hingewiesen werden muss. Fehlen solche Hinweise oder sind Angaben irreführend, liegt eine aufklärungsrelevante Täuschung vor.
In diesen Fällen kommen Schadensersatzansprüche nach § 280 Abs.1 BGB i.V.m. § 311 Abs.2 BGB in Betracht. Der Getäuschte ist so zu stellen, wie wenn er den Vertrag nie abgeschlossen hätte (sog. negatives Interesse). Im Investitionsfall bedeutet das zumeist: Rückzahlung des investierten Betrags Zug-um-Zug gegen Rückgabe der Anteile, ggf. abzüglich etwaiger zwischenzeitlicher Vorteile. Hätten die Anleger bei wahrheitsgemäßer Aufklärung gar nicht investiert, können sie ihr Geld zurückverlangen – selbst wenn das Startup inzwischen insolvent ist, bestünde dann eine Insolvenzforderung. Ähnliches gilt für Arbeitnehmer: Hätte ein Mitarbeiter ohne Täuschung den Vertrag nicht geschlossen, muss der Arbeitgeber ihn so stellen, als wäre es nicht zum Vertragsschluss gekommen (z.B. Verdienstausfall ersetzen, soweit der Arbeitnehmer seine frühere Stellung aufgegeben hat). Allerdings ist die Kausalität oft schwer nachzuweisen – im genannten Urteil erhielt der Kläger kein Geld, da er kurzzeitig wieder beim alten Arbeitgeber arbeiten konnte und somit kein Schaden verblieb
Neben der Anfechtung und c.i.c.-Haftung gibt es im Kapitalmarktrecht die spezielle Figur der Prospekthaftung. Sie greift insbesondere bei Kapitalanlagen, wenn ein förmlicher Prospekt oder Informationsmemorandum fehlerhaft war. Zwar gelten für öffentliche Angebote (z.B. Börsenprospekte) spezielle Gesetze mit strengen Haftungsregeln, aber auch außerhalb formaler Prospekte können Gründer haften: Die Rechtsprechung anerkennt eine Prospekthaftung im weiteren Sinne, wonach Gründer oder Initiatoren gegenüber Investoren haften, wenn sie für die Erstellung oder Verteilung von Informationsunterlagen verantwortlich sind, die falsche oder irreführende Angaben enthalten. So können z.B. Gründer einer Startup-GmbH persönlich haften, wenn sie den Kapitalgebern ein Informationspapier über das Unternehmen zur Verfügung stellen, das in wesentlichen Punkten unrichtig oder unvollständig ist, selbst wenn gesetzlich kein Prospektzwang bestand. Wer Unterlagen wie Pitch Decks, Businesspläne oder Investment-Memoranda herausgibt, sollte daher größte Sorgfalt walten lassen. Insbesondere Risiken dürfen nicht kleingeredet oder verschwiegen werden – fehlende oder geschönte Risikoaufklärung begründet Haftung.
Zusätzlich kann in Extremfällen § 826 BGB (vorsätzliche sittenwidrige Schädigung) einschlägig sein. Dieser Generaltatbestand greift, wenn jemand einem anderen in verwerflicher Weise Schaden zufügt. Ein Gründer, der etwa wissentlich ein hoffnungsloses Geschäftsmodell propagiert und Gelder “verbrennt”, könnte sich dem Vorwurf aussetzen, die Investoren sittenwidrig geschädigt zu haben – insbesondere, wenn kein konkreter Betrug nachweisbar ist, aber das Gesamtverhalten als grob unredlich einzustufen ist. Die Hürden hierfür sind allerdings hoch: Sittenwidrigkeit erfordert ein objektiv besonders verwerfliches Handeln und Vorsatz gerade in Bezug auf die Schädigung. In der Praxis stützt man Ansprüche geschädigter Anleger daher eher auf konkrete Aufklärungspflichtverletzungen (c.i.c) oder Schutzgesetzverletzungen (wie § 263 StGB über § 823 Abs.2 BGB, siehe unten).
Strafrechtliche Grenzen: Betrug und Kapitalanlagebetrug
Während das Zivilrecht den Fokus auf Wiedergutmachung des Schadens legt, zieht das Strafrecht eine klare rote Linie: Täuschungen zum Zwecke der Kapitalbeschaffung können als Straftat verfolgt werden. Zwei Kernvorschriften kommen im Startup-Kontext in Betracht:
- § 263 StGB – Betrug: Dieser Tatbestand ist erfüllt, wenn jemand durch Täuschung (durch Vorspiegeln falscher oder Verschweigen wahrer Tatsachen) bei einem anderen einen Irrtum erregt und dadurch eine Vermögensverfügung des Getäuschten erlangt, in der Absicht sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen. Übersetzt auf die Startup-Situation: Gründer machen sich strafbar, wenn sie z.B. einem Investor wissentlich falsche Zahlen oder Erfolgsaussichten vorgaukeln, um dessen Investment zu erhalten. Klassische Beispiele wären ein geschönter Businessplan, erfundene Umsatzzahlen oder das Verschweigen, dass die angeblich bahnbrechende Technologie noch gar nicht funktioniert. Schon der Erhalt des Investments unter falschen Vorzeichen erfüllt den Betrugstatbestand, auch wenn das Scheitern oder der Verlust erst später eintritt. Entscheidend ist die Vorsatzlage beim Akt der Täuschung. Die Rechtsprechung hat etwa in Polen – was auf ähnliche deutsche Fälle übertragbar ist – klar gestellt, dass die Beschaffung von Finanzierung basierend auf einem gefälschten Businessplan oder unrealistischen Prognosen als Betrug zu werten ist. Ebenso ist es Betrug, wenn Gründer die Kosten massiv unterschätzen und zugleich wissen, dass das Vorhaben nie profitabel wirtschaften kann. Kurz: “Fake it till you make it” kann strafbar sein, wenn es auf gezielter Irreführung von Kapitalgebern beruht.
- § 264a StGB – Kapitalanlagebetrug: Dieser spezielle Straftatbestand ergänzt den allgemeinen Betrug und zielt auf das Anwerben eines größeren Anlegerkreises ab. § 264a StGB stellt es unter Strafe, im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Wertpapieren oder Unternehmensanteilen gegenüber einem größeren Personenkreis falsche vorteilhafte Angaben über erhebliche Umstände zu machen oder nachteilige Tatsachen zu verschweigen. Wichtig ist hier „größerer Kreis“: Die Norm greift typischerweise bei öffentlichen Angeboten, Crowdinvesting oder wenn viele Kleinanleger angesprochen werden. Beispielsweise könnte ein Startup-Gründer nach § 264a StGB belangt werden, wenn er in einem breit gestreuten Investment-Memorandum oder auf einer Crowdfunding-Plattform unrichtige Angaben macht, um möglichst viele Kleinanleger zur Beteiligung zu bewegen. Der Unterschied zum Betrug ist, dass § 264a StGB schon das abstrakte Gefährdungsdelikt sanktioniert – es kommt nicht darauf an, ob tatsächlich jemand investiert oder ein Schaden eintritt. Bereits die Verbreitung falscher Angaben an die Öffentlichkeit ist strafbar. Die Strafandrohung (bis zu 3 Jahre Freiheitsstrafe oder Geldstrafe) verdeutlicht, dass der Gesetzgeber gerade das Vertrauen der Allgemeinheit in den Kapitalmarkt schützen will. Für Startup-Gründer heißt das: Wer in seinen öffentlichen Verlautbarungen gegenüber potenziellen Investoren die “blauen Himmel” verspricht, läuft Gefahr, sich wegen Kapitalanlagebetrugs strafbar zu machen. Dabei reicht schon beschönigende Werbung oder das Weglassen wesentlicher Risiken, sofern es in Prospekten, Präsentationen oder Online-Plattformen geschieht, die an viele adressiert sind.
Neben Betrug und Kapitalanlagebetrug kennt das StGB noch weitere relevante Delikte im Unternehmenskontext, z.B. § 266 StGB (Untreue), das die Verletzung von Vermögensbetreuungspflichten unter Strafe stellt. Ein Beispiel wäre, wenn ein Geschäftsführer ihm anvertrautes Kapital zweckwidrig verwendet – etwa Investorengelder für private Ausgaben oder für völlig sachfremde Zwecke einsetzt –, könnte dies als Untreue gewertet werden. Ebenso kann das Verschleppen einer Insolvenz (nicht rechtzeitiges Stellen des Insolvenzantrags trotz Zahlungsunfähigkeit, § 15a InsO, strafbewehrt nach § 15a Abs.4 InsO) strafrechtliche Konsequenzen haben. Zwar betreffen diese Straftatbestände eher die Phase nach Eintritt der Krise, sie unterstreichen jedoch: Gründer können persönlich in die Haftung und Strafbarkeit geraten, wenn sie Grenzen überschreiten und Pflichten verletzen.
Fazit der rechtlichen Betrachtung: Die Fail-Fast-Philosophie hat keinen Freibrief im deutschen Recht. Sobald ein Gründer Investoren oder Mitarbeiter durch falsche Versprechungen oder verschwiegenene Risiken zur Mitwirkung bewegt, drohen Anfechtung, Schadensersatz und strafrechtliche Sanktionen. Die juristischen Leitplanken – von Aufklärungspflichten bis Betrugstatbestand – sollen sicherstellen, dass hohes unternehmerisches Risiko nicht in verantwortungslosen Umgang mit dem Vertrauen Dritter umschlägt.
Abgrenzung: Wann ist Scheitern vom unternehmerischen Risiko gedeckt?
Die zentrale Frage bleibt: Wo verläuft die Linie zwischen legitimem Scheitern im Rahmen des allgemeinen Startup-Risikos und einem Scheitern, das auf Täuschung oder unzulässiger Leichtfertigkeit beruht? Mit anderen Worten, ab wann wird dem Gründer das Scheitern rechtlich zum Vorwurf gemacht?
Grundsätzlich erkennt die Rechtsprechung an, dass Startups in einem Umfeld extremer Ungewissheit operieren. Oft wird davon ausgegangen, dass der Erfolg eines Startups statistisch vielleicht nur zu 10% wahrscheinlich ist. Investoren wissen das und kalkulieren hohe Ausfallraten ein – im Erfolgsfall winken ja überproportionale Gewinne. Dieses ex ante geringe Chancen-Risiko-Verhältnis gehört zum Wesen von Venture Capital. Risikobereitschaft alleine ist daher nicht verwerflich, sondern integraler Bestandteil innovativer Geschäftsmodelle.
Allerdings lässt sich nicht jedes Scheitern pauschal mit “Pech gehabt” entschuldigen. Juristisch zeichnet sich eine Abstufung ab:
- Normaler unternehmerischer Fehlschlag: Trotz ordentlicher Geschäftsführung und redlicher Information aller Beteiligten setzt sich das Geschäftsmodell nicht durch – z.B. weil der Markt das Produkt doch nicht annimmt oder ein Konkurrent schneller ist. Solche Fälle sind vom allgemeinen Lebensrisiko gedeckt. Ein Investor kann hier grundsätzlich keinen Vorwurf erheben, solange er korrekt informiert war. Das Scheitern ist dann die Verwirklichung des gemeinsam erkannten Risikos. Hier greift das Prinzip der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit und auch die Business Judgment Rule (für Geschäftsführer einer GmbH oder AG): Solange die Entscheidungen vertretbar und nicht grob fahrlässig waren, besteht keine Haftung für den Misserfolg.
- Scheitern durch gewöhnliche Fehlentscheidungen/Missmanagement: Schwieriger sind Fälle, in denen zwar keine Täuschung vorliegt, aber die Gründer gravante Managementfehler machen oder das Wachstumskonzept sich als völlig verfehlt erweist. Beispiel: Das Gründerteam setzt stur auf eine Strategie, obwohl sich früh Anzeichen zeigen, dass der Markt nicht will. Irgendwann ist das Geld weg. War das noch ein vertretbares Risiko – oder schon pflichtwidrige Vernachlässigung der Sorgfalt? Hier argumentieren Gründer oft, sie hätten im Rahmen des zulässigen Risikos gehandelt, schließlich probiere man Unbekanntes aus. Investoren könnten dem entgegenhalten, dass die Grenzen des vernünftigen Wirtschaftens überschritten wurden. Die Rechtslage ist hier fließend: Ein bloß erfolgloses Geschäftsmodell begründet noch keinen Haftungsanspruch. Aber wenn objektiv jegliche wirtschaftliche Vernunft fehlte oder frühzeitig erkennbar war, dass das Konzept nicht tragfähig ist, kann man von überschrittenen Risikogrenzen sprechen. In manchen Rechtsordnungen existiert sogar ein Straftatbestand für grobe Misswirtschaft (z.B. in Polen der Straftatbestand der fahrlässigen Wirtschaftsschädigung ähnlich einer grob fahrlässigen Untreue. In Deutschland gibt es keine explizite Strafnorm für „schlechtes Management“ – jedoch könnten gravierende Fehlallokationen ggf. über § 266 StGB (Untreue) erfasst werden, sofern eine Vermögensbetreuungspflicht gegenüber dem Unternehmen verletzt wurde. Zivilrechtlich käme allenfalls Haftung des Geschäftsführers gegenüber der Gesellschaft in Betracht (Innenhaftung), nicht unmittelbar gegenüber dem Investor, sofern keine speziellen Garantien verletzt wurden. Für den Investor bliebe in solchen Fällen meist nur der Frust – es sei denn, man konstruiert eine vorsätzliche sittenwidrige Schädigung (§ 826 BGB), was aber hohe Anforderungen hat.
- Scheitern infolge bewusster Täuschung oder unvertretbarer Risiken: Hier überschreitet der Gründer klar die Linie. Fälle, in denen von Anfang an kein ernsthafter Erfolg erwartet wurde, aber dennoch fremdes Geld aufgenommen wurde, gehören hierzu. Beispiel: Ein Gründer weiß, dass sein Produkt technisch noch Jahre von der Marktreife entfernt ist, präsentiert Investoren aber einen unrealistischen Time-to-Market von 6 Monaten, um Finanzierung zu erhalten. Er „pokert“ darauf, dass entweder ein Wunder geschieht oder er zumindest für einige Monate Gehälter und Marketing finanzieren kann, um es zu versuchen. Diese Vorgehensweise wäre schwerlich als normales Risiko zu qualifizieren – vielmehr liegt der Verdacht nahe, dass hier Täuschung im Spiel ist, um Geld zu akquirieren, obwohl das Scheitern vorprogrammiert ist. Die Rechtsordnung reagiert hier streng: Wie oben dargelegt, macht sich ein solcher Gründer möglicherweise wegen Eingehungsbetrugs strafbar und haftet zivilrechtlich auf Schadensersatz. Auch die moralische Bewertung ist eindeutig: Es handelt sich um einen Missbrauch des Fail-Fast-Gedankens, gewissermaßen ein Spiel mit dem Geld anderer Leute. Die Grenze vom mutigen Visionär zum unverantwortlichen Hasardeur ist hier klar überschritten.
Zusammenfassend lässt sich sagen: Solange Gründer im Rahmen anerkannter Geschäftsrisiken agieren, transparent über diese Risiken informieren und nach bestem Wissen Entscheidungen treffen, wird man ihnen ein Scheitern nicht zum Vorwurf machen können. Die Stakeholder tragen das unternehmerische Risiko mit. Kippt die Situation aber dahin, dass Gründer wider besseres Wissen handeln oder sehenden Auges in die Katastrophe laufen und andere mitziehen, endet der Schutz durch das allgemeine Lebensrisiko. Dann sprechen Gerichte von „Überschreiten des erlaubten Risikos“. In solchen Fällen ist Scheitern kein Pech mehr, sondern Folge eines täuschenden oder zumindest grob leichtfertigen Umgangs mit anvertrautem Kapital.
Besonderheiten bei ausländischen Investoren (insbesondere USA)
Die Startup-Welt ist international – viele deutsche Gründer werben Investoren aus dem Ausland, gerade aus den USA, an. Dies wirft die Frage auf: Müssen deutsche Startups bei ausländischen Stakeholdern auch deren Rechtsordnung berücksichtigen? Insbesondere US-Investoren sind bekannt für eine rigorose Durchsetzung ihrer Rechte, und Begriffe wie Disclosure und Fiduciary Duty haben dort großes Gewicht.
Zunächst ist festzuhalten, dass sich die rechtliche Hauptbeziehung typischerweise nach dem gewählten Vertragsstatut richtet. Investiert ein US-Venture-Capital-Fonds in eine deutsche GmbH, wird der Beteiligungsvertrag oft deutschem Recht unterstellt sein (es sei denn, man wählt ausdrücklich z.B. Delaware-Recht). In solchen Fällen gelten primär die oben dargestellten deutschen Regeln. Allerdings bedeutet das nicht, dass US-typische Erwartungen irrelevant wären: Viele US-Investoren verlangen bestimmte vertragliche Zusicherungen und Compliance mit ihren Heimatrechts-Standards, bevor sie investieren. So fließen etwa US-Standards für Due Diligence und Disclosure indirekt in den Vertrag ein – z.B. umfangreiche Garantiekataloge, regelmäßige Reporting-Pflichten, Klauseln zur Einhaltung von Anti-Korruptions- und Sanktionsvorschriften etc.
Wird hingegen ein deutsches Startup in eine US-Rechtsform gebracht (ein verbreiteter Weg ist die Gründung einer Delaware Corporation als Holding), dann unterliegen die Gründer den entsprechenden US-Vorschriften. In den USA bestehen etwa fiduciary duties von Directors gegenüber den Shareholdern, zu denen Treue- und Sorgfaltspflichten gehören. Ein Gründer als Board Member einer Delaware C-Corp muss im Interesse aller Aktionäre handeln. Zielt er nur auf eigenes „Fail Fast“ ohne Rücksicht auf Investorenschutz, könnte er gegen die Duty of Care verstoßen, sofern sein Handeln als grob fahrlässig eingestuft wird (die Business Judgment Rule schützt nur bis zu einem gewissen Grad; bei gross negligence greift sie nicht). Auch die Duty of Loyalty verbietet es, persönliche Vorteile zulasten der Gesellschaft oder der anderen Anteilseigner zu suchen – ein Seriengründer, der etwa Know-how oder Kunden von einer Fast-Fail-Gesellschaft in sein nächstes Projekt transferiert, könnte in den USA schnell in Interessenkonflikte und Haftung geraten.
Besonders zu beachten sind in den USA die Bundeswertpapiergesetze (Securities Laws). Zwar sind klassische VC- oder Angel-Investments meist private placements, die von der Registrierungspflicht befreit sind (z.B. nach Regulation D, Rule 506). Aber auch im Reg-D-Kontext gilt Rule 10b-5 (aus dem Securities Exchange Act 1934), die sinngemäß jede unwahre Angabe oder das Verschweigen wesentlicher Tatsachen im Zusammenhang mit dem Kauf oder Verkauf von Wertpapieren verbietet. Diese Vorschrift ist die Grundlage zahlreicher Betrugsklagen und SEC-Verfahren – sie ähnelt dem deutschen Betrugstatbestand, hat aber zivilrechtlich enorme Durchsetzungskraft (Stichwort: class actions). Ein deutsches Startup, das US-Investoren Anteile anbietet, kann unter Rule 10b-5 haften, wenn es in seinen Offering Documents falsche Angaben macht. Dabei spielt es keine Rolle, ob das Unternehmen selbst in Deutschland sitzt – entscheidend ist, dass US-Investoren beteiligt werden und US-Gerichte Jurisdiktion annehmen (was bei Transaktionen, die in US-Dollar oder via US-Investmentvehikel laufen, schnell bejaht wird).
Ein praktischer Aspekt: US-Investoren erwarten umfassende „Disclosure“, also Offenlegung aller Risiken und Schwachpunkte. Während deutsche Investoren in frühen Phasen manchmal informeller agieren, sind Angels/VCs aus den USA meist sehr dokumentationsgetrieben. Gründer sollten sich darauf einstellen, vollständige und schriftliche Unterlagen bereitzustellen und nichts Wesentliches zu verschweigen. Ein Versäumnis könnte in der Zukunft nicht nur vertraglich, sondern auch vor US-Gerichten negativ ausgelegt werden.
Zudem haben die USA strengere Regeln bei gewissen spezifischen Punkten – etwa Exportkontrollregularien oder dem Umgang mit bestimmten Technologien –, die in Investmentvereinbarungen einfließen können. Besondere Disclosure-Pflichten können sich ergeben, wenn z.B. ein US-VC Gelder von öffentlichen Stellen verwaltet; dieser muss sicherstellen, dass die Beteiligung an einem ausländischen Startup ordnungsgemäß erfolgt. Zwar muss ein deutsches Startup nicht pauschal US-Recht anwenden, aber es muss im Hinterkopf behalten, dass die juristische und regulatorische Kultur des Investors eine Rolle spielt.
Praktischer Tipp: Bei Verhandlungen mit US-Investoren sollte früh geklärt werden, welches Recht gilt und welche Compliance-Vorgaben eingehalten werden müssen. Oft verlangen US-Investoren, dass das Startup für die Investmentrunde eine US-Inc. gründet, wodurch automatisch US-Recht (Delaware Law) gilt. In solchen Fällen sollte dringend US-rechtlicher Rat eingeholt werden, um Pflichten nicht zu verletzen. Andernfalls drohen neben deutschen auch US-amerikanische Rechtsfolgen – man denke an die drastischen Strafen bei Securities Fraud in den USA, die deutlich über deutschen Sanktionen liegen. Auch zivilrechtlich sind in den USA Schadenersatzklagen (mit punitive damages) eine ernstzunehmende Gefahr.
Zusammengefasst: Ein deutsches Startup mit ausländischen (insbesondere US-)Investoren sollte sich nicht in falscher Sicherheit wiegen. Es gilt zwar primär das vereinbarte Recht, aber die Erwartungen und Rechtsdurchsetzungsmethoden der ausländischen Partner können strenger sein. Daher empfiehlt es sich, nach dem höchsten gemeinsamen Standard zu verfahren, d.h. maximale Transparenz, saubere Vertragswerke und Beachtung aller einschlägigen Vorschriften beider Seiten. Im Zweifel muss auch US-Recht berücksichtigt werden, insbesondere was ehrliche Offenlegung und Vermeidung von Irreführung angeht.
Moralische und juristische Bewertung hochriskanter Geschäftsmodelle
“Move fast and break things”, “growth at all costs”, “fake it till you make it” – diese Silicon-Valley-Maximen haben eine gemeinsame Prämisse: Schnelles Wachstum rechtfertigt extreme Risiken, und Erfolg heiligt bis zu einem gewissen Grad die Mittel. Doch wie sind Geschäftsmodelle zu bewerten, die bewusst auf schnelles Wachstum mit hohem Risiko und möglichem Scheitern setzen?
Moralisch lässt sich argumentieren, dass großer Fortschritt ohne beträchtliches Risiko kaum möglich ist. Viele revolutionäre Unternehmen (von Biotech bis Raumfahrt) wären nie entstanden, hätte man nicht bereitwillig Misserfolge in Kauf genommen. Eine Fehlerkultur, die Scheitern nicht stigmatisiert, kann Innovation befeuern. Aus dieser Perspektive erscheint das “fail fast”-Paradigma positiv: Lieber früh scheitern und daraus lernen, als ein totes Pferd ewig reiten. Gründer, die mutig kalkulierte Risiken eingehen, treiben den Fortschritt voran – und Investoren wie Mitarbeiter partizipieren freiwillig an dieser Kultur, in der Hoffnung auf überdurchschnittliche Chancen.
Andererseits ist zu fragen, ob die Romantisierung des Scheiterns nicht auch als Schönfärberei gefährlicher Tendenzen dient. Wenn Misserfolg glorifiziert wird, besteht die Gefahr, dass Sorgfalt und Verantwortung leiden. Es macht einen Unterschied, ob ein Gründer alles Erdenkliche versucht hat und dennoch scheitert – oder ob er von vornherein eine “Hopp oder Top”-Mentalität pflegt, bei der das Unternehmen fast wie ein Wegwerfartikel behandelt wird. Kritiker monieren, dass manche Seriengründer das Scheitern quasi einplanen: Kommt der Erfolg nicht sofort, wird das Projekt fallen gelassen und das nächste gestartet. Zurück bleiben verbrannte Investorengelder und enttäuschte Mitarbeiter, während der Gründer unverdrossen zur nächsten Gründung schreitet. Dieses Muster kann man als strategisches Scheitern bezeichnen – es ist fast Teil des Geschäftsmodells solcher Gründer.
Juristisch ist ein Geschäftsmodell, das auf schnelles Wachstum um jeden Preis setzt, nicht per se unzulässig. Aggressive Expansion, hohe Burn Rates, Verlustjahre in Kauf zu nehmen – all das kann wirtschaftlich vernünftig sein, solange Aussicht besteht, damit entweder die Marktführerschaft zu erlangen oder zumindest eine Chance auf spätere Gewinne zu haben. Das Recht schreibt keine Erfolgsquote vor. Allerdings kollidiert ein “Growth-at-all-costs”-Ansatz mit den oben beschriebenen Pflichten, wenn die Kosten nicht offen kommuniziert werden. Hohe Verlustrisiken müssen ehrlich benannt werden. Ein Startup, das bewusst ein “Blitzscaling”-Modell verfolgt (also extrem schnelle Skalierung mit Inkaufnahme von Verlusten), sollte seinen Geldgebern von Anfang an darlegen: Wir setzen auf Marktanteil, nicht auf kurzfristigen Gewinn; es besteht die erhebliche Möglichkeit, dass das Kapital im Sande verläuft, wenn kein Anschlussinvestment kommt. Ebenso müssen Mitarbeiter, etwa durch transparente Kommunikation, wissen, dass das Überleben des Unternehmens an aggressiven Zielen hängt.
Moralisch fragwürdig wird ein solches Modell, wenn Täuschung ins Spiel kommt, also wenn Gründer intern längst um die Wackeligkeit ihres Konstrukts wissen, aber nach außen heile Welt vorspielen, um Zeit oder weiteres Geld zu gewinnen. Beispiele aus der Startup-Welt zeigen, wie schmal der Grat ist: “Fake it till you make it” – das Prinzip, zunächst den Schein des Erfolgs zu wahren, um tatsächlich Erfolg zu erreichen – hat in Fällen wie Theranos (Biotech) oder FTX (Krypto-Börse) in schwerem Betrug und Skandalen gemündet. Dort wurde das schnelle Wachstum über alles gestellt, selbst als klar war, dass die Versprechen nicht haltbar waren. Diese Extremfälle sind natürlich Ausreißer, doch sie illustrieren die Gefahr, dass ein überzogener Erfolgsdruck kombiniert mit einer Kultur, die Scheitern nicht sauber eingesteht, zu systematischer Täuschung führen kann.
Im deutschen Kontext muss man auch die sozialethische Komponente bedenken: Ein Geschäftsmodell, das von Anfang an darauf baut, im Zweifel das investierte Geld kontrolliert verbrennen zu können, berührt Fragen der Sittenwidrigkeit. Es klingt fast nach Spiel oder Wette mit fremdem Vermögen. Während das Recht Wetten und Spekulationen nicht verbietet, verlangt es Fairness und Transparenz dabei. Gründer sollten sich fragen, ob sie selbst unter den gleichen Bedingungen investieren würden, die sie ihren Geldgebern bieten. Wenn die ehrliche Antwort wäre, dass das Modell eigentlich nur dann attraktiv ist, wenn man gewisse Wahrheit nicht ausspricht, läuft etwas falsch – moralisch und rechtlich.
Zwischenfazit: Fail Fast als Kultur kann positiv sein, solange es mit Disziplin und Integrität praktiziert wird. Eine Studie in Harvard Business Review rät Gründern etwa: Setzt euch ambitionierte, aber realistische Ziele und haltet eure Stakeholder über die Risiken informiert; versteht “Fail Fast” als Aufforderung zu schnellen Lernzyklen, nicht als Freibrief für schlecht durchdachte Risiken; und bleibt bei Prototypen und Ergebnissen ehrlich, anstatt sie zu beschönigen. Daran zeigt sich: Die Startup-Community selbst erkennt die Balance, die nötig ist. Schnell zu scheitern darf kein Selbstzweck sein und erst recht keine Entschuldigung dafür, Stakeholder im Dunkeln zu lassen. Scheitern kann konstruktiv sein – aber nur, wenn es in einer Kultur der Offenheit passiert, nicht der Täuschung.
Seriengründungen und „Fail Fast“ als Strategie – Informationsasymmetrien
Betrachten wir speziell das Phänomen der Serial Entrepreneurs – also Gründer, die ein Startup nach dem anderen aufziehen. Für solche Personen kann das Fail-Fast-Prinzip zu einer bewussten Geschäftsstrategie werden: Schnell ausprobieren, im Misserfolgsfall rasch abschließen und die nächste Idee starten. Aus Gründerperspektive mag das effizient erscheinen; aus Investorensicht kann es jedoch problematisch sein.
Informationsasymmetrie spielt hier eine große Rolle: Ein neuer Investor kennt die Vergangenheit des Gründers unter Umständen nicht im Detail. Ein Seriengründer, der schon mehrere gescheiterte Projekte hinter sich hat, hat zwar Erfahrung – aber möglicherweise auch die Neigung entwickelt, Projekte sehr schnell abzubrechen, sobald Schwierigkeiten auftauchen. Wenn dies nicht offen kommuniziert wird, entsteht ein Mismatch der Erwartungen: Der Investor glaubt vielleicht an einen längeren Atem, während der Gründer mental schon die nächste Firma plant. Das kann zu erheblichen Konflikten führen. Beispielsweise könnte ein Seriengründer nach Erhalt des Investments feststellen, dass das Konzept doch nicht zündet, und anstatt hart zu pivotieren oder um jeden Preis zu retten, entscheidet er sich, das Unternehmen zu liquidieren und sich Neuem zuzuwenden. Der Investor steht vor vollendeten Tatsachen – sein Kapital ist weg, vielleicht wäre das Projekt mit etwas mehr Einsatz oder einem anderen Ansatz noch zu retten gewesen, aber der Gründer hatte nicht genug Motivation, es weiterzuführen. Rein rechtlich kann man dem Gründer schwer einen Vorwurf machen, sofern keine speziellen vertraglichen Verpflichtungen verletzt wurden. Das unternehmerische Ermessen umfasst ja auch die Entscheidung, einen aussichtslosen Kampf zu beenden. Doch aus Investorensicht fühlt es sich wie Treuebruch an, insbesondere wenn der Gründer vielleicht parallel schon an der nächsten Finanzierung für das neue Startup arbeitet.
Interessenkonflikte können sich zuspitzen, wenn ein Seriengründer mehrere Projekte quasi parallel jongliert. Gibt er das eine auf, lebt aber das Geschäftsmodell in leicht veränderter Form in einem neuen Vehikel weiter – womöglich mit anderen Investoren –, könnte der Vorwurf entstehen, er habe Werte oder Chancen “mitgenommen”, die eigentlich dem ersten Startup und dessen Geldgebern gehörten. Juristisch könnte hier eine Verletzung der Loyalitätspflichten oder sogar eine Vermögensverschiebung vorliegen. Hat der Gründer beispielsweise geistiges Eigentum (Code, Erfindungen) aus dem alten Unternehmen ins neue hinübergerettet, wäre das ein klarer Rechtsverstoß (Verletzung von Gesellschaftspflichten, ggf. Diebstahl von Geschäftsgeheimnissen). Selbst wenn es nur um Ideen oder Erkenntnisse geht, bewegt man sich ethisch in einer Grauzone: Die ersten Investoren finanzierten letztlich das Lernen des Gründers, die Früchte ernten aber andere.
Daher ist es im Kontext von Seriengründern besonders wichtig, Transparenz und Fairness zu wahren. Ein erfahrener Gründer sollte offenlegen, wie er im Misserfolgsfall vorzugehen gedenkt. Einige Investoren fragen gezielt nach der Resilienz des Gründungsteams: Wird es bei Gegenwind sofort das Handtuch werfen oder hat es Plan B/C? Hier prallen oft zwei Philosophien aufeinander – die Silicon-Valley-Logik (“fail fast, move on”) und die eher mittelständisch-deutsche Logik (“halte durch und arbeite dich zum Erfolg”). Weder ist per se richtig oder falsch, aber ein Mismatch in der Philosophie muss vorab geklärt werden. Sonst drohen Enttäuschungen oder sogar Rechtsstreit: Z.B. könnte ein Investor argumentieren, der Gründer habe seine Pflichten verletzt, indem er vorschnell aufgegeben hat – was jedoch schwer durchzusetzen ist, solange keine konkreten Vertragsklauseln gebrochen wurden.
Vertraglich kann man solchen Konflikten etwas vorbeugen: Vesting-Klauseln (Rückfall von Anteilen, wenn der Gründer das Unternehmen früh verlässt) stellen sicher, dass ein Seriengründer nicht einfach das Geld nimmt und weiterzieht, ohne “skin in the game” zu haben. Wettbewerbsverbote können verhindern, dass er sofort mit einem konkurrierenden Folgeprojekt startet. Investorenrechte im Gesellschaftsvertrag, z.B. Vetorechte bei der Unternehmensauflösung oder der Veräußerung wesentlicher Assets, können den ungeplanten Totalschluss erschweren – der Gründer kann dann nicht allein entscheiden, das Licht auszumachen, wenn noch Geld in der Kasse ist. All dies dient dazu, die Asymmetrie in der Informations- und Machtposition etwas auszugleichen. Der Gründer hat zwar die operative Kontrolle, aber die Investoren erhalten Mechanismen, zumindest bei wichtigen Schritten mitzureden.
Letztlich erfordert der Umgang mit “Fail Fast” in Seriengründungen Vertrauen – und Vertrauen entsteht durch offenen Umgang. Ein Seriengründer tut gut daran, aus seinen früheren Scheitern kein Geheimnis zu machen, sondern im Gegenteil die Learnings hervorzuheben und klarzustellen, wie er es diesmal anders angeht. Wenn dennoch klar ist, dass er einen experimentellen Ansatz fährt, sollten die Investoren gezielt ausgesucht werden: Manche Investoren, gerade aus den USA, unterstützen eine Portfolio-Strategie (breit streuen, schnelle Pivot/Abbruch-Entscheidungen), während andere mehr Commitment erwarten. Informationsasymmetrie kann hier reduziert werden, indem man sicherstellt, dass beide Seiten dieselbe Erwartungshaltung haben, was im Worst Case passieren soll.
Zwischenfazit: Fail Fast als strategisches Muster bei Seriengründern ist ein zweischneidiges Schwert. Es kann zum effizienten Aussondern schlechter Ideen dienen, birgt aber erhebliche Konfliktpotenziale durch unterschiedliche Erwartungshaltungen. Rechtlich ist ein schneller Abbruch erlaubt, aber nur solange keine Treuepflichten oder Vermögenswerte verletzt werden. Die beste Prävention gegen Streit ist, dass Gründer und Investoren im Vorfeld klar kommunizieren, wie mit einem möglichen Scheitern umgegangen wird, und dies nach Möglichkeit in Verträgen reflektieren (z.B. Exit-Strategien, Liquidationspräferenzen, Entscheidungskompetenzen bei Pivot oder Shutdown).
Rechtssichere Vertragsgestaltung: Schutzklauseln für Risiko und Scheitern
Angesichts der vielen Fallstricke sollten Gründer, Investoren und auch Mitarbeiter frühzeitig auf rechtssichere Vertragsklauseln achten, um sowohl das legitime Scheitern zu ermöglichen als auch Missbrauch oder Enttäuschung vorzubeugen. Im Folgenden einige wichtige Vertragsgestaltungen und Klauseln in Term Sheets, Beteiligungsverträgen, Wandeldarlehen, SAFE-Agreements etc., die im Kontext hoher Risiken besonders relevant sind:
Term Sheets und Beteiligungsverträge
- Transparente Kommunikation von Annahmen: Schon im Term Sheet (Absichtserklärung) kann festgehalten werden, dass beide Seiten sich über bestimmte Risiken im Klaren sind. Beispielsweise können die Gründer dort aufnehmen: “Das Unternehmen befindet sich in einer frühen Experimentierphase; beide Parteien sind sich des beträchtlichen Risikos bewusst, dass das Geschäftsmodell grundlegend angepasst oder eingestellt werden muss, falls die Annahmen sich als falsch erweisen.” Zwar ist ein Term Sheet meist unverbindlich, aber solche Formulierungen schaffen ein gemeinsames Verständnis.
- Keine unerfüllbaren Garantien abgeben: Im Beteiligungsvertrag (z.B. Investment- und Gesellschaftervereinbarung) werden Gründer typischerweise eine Reihe von Garantien abgeben müssen (z.B. dass die Bücher richtig sind, keine Verbindlichkeiten verschwiegen wurden, alle Patente dem Startup gehören etc.). Gründer sollten hier ehrlich sein und nichts zusichern, was sie nicht halten können. Wichtig ist auch, etwaige Forward-Looking Statements richtig einzuordnen: Besser keine Garantie auf Erreichen eines bestimmten Umsatzes geben, sondern höchstens erklären, man habe die Planung nach bestem Wissen erstellt, ohne dafür zu haften. Investoren verlangen in der Regel ohnehin keine Erfolgszusicherung, wohl aber Garantien über den Status Quo (bspw. “keine Insolvenzreife”, “alle wesentlichen Verträge offengelegt”). Diese müssen vollständig und wahrheitsgemäß offengelegt werden, um spätere Haftung zu vermeiden.
- Material Adverse Change (MAC) Klauseln: In manchen Verträgen – insbesondere bei Tranchenmodellen – werden Bedingungen vereinbart, unter denen der Investor vom Investment zurücktreten kann, falls sich vor Vollzug noch gravierende Verschlechterungen ergeben. Zwar sind MAC-Klauseln in frühen Phasen selten, aber bei hochriskanten Modellen könnten Investoren darauf drängen, z.B.: “Sollte vor dem Closing ein wesentliches negatives Ereignis eintreten (etwa Verlust eines Schlüssel-Kunden oder Patentstreit), entfällt die Investitionspflicht.” Für Gründer ist das zunächst unangenehm, aber letztlich fair, denn es gewährleistet, dass der Investor nur einsteigt, wenn die Ausgangslage intakt ist – was auch den Gründer vor späteren Vorwürfen schützt.
- Mitspracherechte bei Pivot oder Geschäftsaufgabe: Investoren sichern sich häufig vertragliche Vetorechte bei grundlegenden Entscheidungen (im Gesellschaftsvertrag festgehalten). Dazu kann gehören: Änderung des Geschäftsgegenstands, Veräußerung des gesamten Unternehmens, Insolvenzantragstellung oder Liquidation. So stellt der Investor sicher, dass ein Gründer nicht eigenmächtig das Geschäftsmodell komplett umkrempelt oder das Handtuch wirft, ohne zumindest den Investor zu konsultieren. Gründer sollten solche Rechte zähneknirschend akzeptieren, da sie im Ernstfall helfen, gemeinsam eine Lösung zu finden (z.B. weiterer Finanzierungsversuch, Verkauf statt Liquidation). Das schützt beide Seiten: den Investor vor voreiligem Abbruch und den Gründer vor dem Vorwurf, er habe eigenmächtig Kapital vernichtet.
- Liquidationspräferenz: Eine Liquidation Preference in der Beteiligungsvereinbarung legt fest, in welcher Reihenfolge und Höhe Investoren im Exit- oder Insolvenzfall Geld zurückbekommen, bevor die Gründer/Aktionsäre etwas erhalten. Bei riskanten Modellen ist es üblich, Investoren zumindest den ursprünglichen Einsatz (1x Liquidationspräferenz) vorrangig zuzusichern, falls doch etwas verwertbar ist. Zwar hilft das bei Totalinsolvenz auch nicht (da nichts da ist), aber in einem Teilerfolg oder Verkauf unter Einstandswert bekommen Investoren zumindest etwas zurück. Für Gründer ist das verkraftbar, solange die Präferenz nicht exorbitant ist. Es mildert den Eindruck, die Gründer könnten sich bei kleinem Exit noch bereichern, während Investoren verlieren.
- Claw-back oder Earn-out Klauseln: In manchen Fällen kann vereinbart werden, dass Gründer Nachschüsse leisten oder auf künftige Gewinne verzichten, falls bestimmte Versprechen sich als falsch herausstellen. Das ist mehr bei M&A üblich, aber denkbar in Startup-Verträgen, falls z.B. Gründer sehr bestimmte Zusagen gemacht haben. Etwa: “Die Gründer versprechen, mindestens 1000 zahlende Nutzer binnen 12 Monaten zu erreichen. Andernfalls reduziert sich ihr Anteil um X% zugunsten der Investoren.” Solche harten Klauseln sind selten und auch rechtlich heikel (da sie wie Vertragsstrafe wirken), doch derlei Mechanismen könnten das Risiko asymmetrisch auf Gründer zurückverlagern. In Verhandlungen muss man abwägen: Zu rigide Bedingungen können demotivieren oder signalisieren Misstrauen. Üblicher sind weichere Methoden wie Meilenstein-Finanzierungen (siehe unten).
- Tranchierung und Meilensteine: Anstatt den vollen Betrag auf einmal zu investieren, können Finanzierungsrunden in Tranchen ausgezahlt werden, abhängig vom Erreichen gewisser Milestones. Das passt gut bei “hochriskantem Wachstum” – der Investor gibt nur weiteres Geld, wenn z.B. ein Prototyp funktioniert oder gewisse KPIs erreicht wurden. So koppelt man die Risikobereitschaft an messbare Erfolge. Für Gründer heißt das Disziplin, aber auch, dass sie bei Nichterreichen fairerweise kein weiteres Geld erwarten können (was besser ist, als dann auf Gedeih und Verderb angewiesen zu sein). Wichtig ist, die Meilensteine realistisch zu definieren, um nicht in Dauerverzug zu geraten.
Wandeldarlehen (Convertible Notes)
Wandeldarlehen sind in Deutschland ein populäres Instrument, um Frühphaseninvestitionen flexibel zu gestalten. Der Investor gewährt zunächst ein Darlehen, das später typischerweise in Anteile umgewandelt wird (oft bei der nächsten Finanzierungsrunde). Aus rechtlicher Sicht ist es ein Darlehensvertrag, kombiniert mit einem Wandlungsrecht (oder Pflicht) und oft vereinbartem Rabatt oder Cap für die spätere Bewertung.
Bei hochriskanten Startups sollten Wandeldarlehen sorgfältig ausgestaltet sein, um Klarheit für den Scheiterungsfall zu schaffen:
- Klare Regelung für den Fall der Insolvenz oder Liquidation vor Wandlung: Was passiert, wenn das Startup pleite geht, bevor eine Wandlung stattfindet? Standard ist häufig, dass der Investor dann Gläubiger bleibt und zumindest theoretisch sein Geld zurückfordern kann. Oft sind Wandeldarlehen jedoch nachrangig gestellt (im Insolvenzfalle nach den normalen Gläubigern). Gründer und Investoren sollten sich bewusst sein: Ein nachrangiges Darlehen ist faktisch Eigenkapital im Kleid des Fremdkapitals – bei Insolvenz gibt es meist nichts zurück. Dennoch sollte die Dokumentation dies klar sagen, um spätere Missverständnisse zu vermeiden.
- Laufzeit und Fälligkeit: Enthält das Wandeldarlehen eine Endfälligkeit, nach der es zurückgezahlt werden muss, wenn bis dahin keine Wandlung erfolgte? Falls ja, besteht das Risiko, dass das Startup diese Rückzahlung nicht stemmen kann (was dann zur Insolvenz führen müsste). Viele Wandeldarlehen werden daher automatisch verlängert oder die Fälligkeit ruht, solange beide Seiten an einer Umwandlung festhalten. Hier ist wichtig: Wenn ein Startup absehbar scheitert und kein Equity Investment mehr kommt, muss geklärt sein, ob der Investor das Darlehen fällig stellen kann (und will). Um Streit zu vermeiden, könnte man z.B. vereinbaren: “Sollte bis Datum X keine Finanzierungsrunde stattgefunden haben, tritt eine automatische Wandlung zu einem festen Bewertungsbetrag Y ein.” Dann wird der Investor Gesellschafter zu einer vorher definierten Bewertung. Dies verhindert, dass der Investor komplett leer ausgeht, aber schützt ihn auch nicht vor Wertverlust – er bekommt dann eben Anteile an einer vermutlich wertlosen Gesellschaft. Immerhin ist der Vorgang klar geregelt.
- Zinsen und Anreize: Üblich ist ein niedriger Zinssatz (Vermeidung von Steuer- und Bilanzproblemen), oft werden Zinsen bis zur Wandlung gestundet. Bei riskanten Vorhaben kann der Investor auf etwas höheren Zinsen bestehen, aber am Ende sind Zinsen bei einem Totalausfall ebenfalls verloren. Daher konzentriert man sich eher auf den Wandlungsrabatt oder die Bewertungsobergrenze (Valuation Cap), um den höheren Risikoappetit zu belohnen. Für Gründer ist das akzeptabel, solange es im marktüblichen Rahmen bleibt (z.B. 20% Discount, Cap vielleicht am oberen Ende der aktuellen Wertvorstellung).
- Keine verdeckte Eigenkapitalfinanzierung: Aus rechtlicher Sicht muss ein Wandeldarlehen so gestaltet sein, dass es tatsächlich als Darlehen durchgeht, bis zur Wandlung. Ansonsten könnte die Einlage ohne notarielle Beurkundung und Handelsregistereintragung erfolgen, was bei einer GmbH problematisch wäre. Daher sollten Wandeldarlehensverträge immer mit kompetenter Hilfe erstellt werden, damit die Wandlung später formal korrekt durchgeführt wird (insbesondere Beschlussfassung über Kapitalerhöhung etc.). Werden hierbei Fehler gemacht, drohen Anfechtbarkeiten oder das Wandlungsrecht ist unwirksam. Für das Thema “Fail Fast” ist das indirekt relevant: Wenn alles gut geht, wandelt man; wenn alles schief geht, will man zumindest keinen formalen Rechtsfehler, der im Nachhinein zu Haftung (z.B. Scheingewinn-Auskehrungen) führt.
SAFE-Agreements (Simple Agreement for Future Equity)
SAFE-Verträge, populär geworden durch Y Combinator in den USA, sind eine Art vereinfachte Wandeldarlehen – allerdings meistens ohne Rückzahlungsanspruch und ohne Zinsen. Der Investor gibt Geld jetzt und erhält das Recht, beim nächsten Equity Event entsprechende Anteile zu bekommen (meist mit Discount oder Cap). In Deutschland wurden SAFE-Agreements teils adaptiert, aber es gibt rechtliche Besonderheiten:
- Rechtsnatur eines SAFE: Im Gegensatz zum Wandeldarlehen ist ein SAFE keine Schuldverschreibung im klassischen Sinne, eher ein vertragliches Vorwegzeichnungsrecht. Das bedeutet, der Investor hat bis zur Kapitalrunde keine Gesellschafterrechte, aber auch keinen Rückzahlungsanspruch. Er trägt also volles Risiko ab Tag 1, ähnlich einem stillen Gesellschafter ohne Stimmrechte. Scheitert das Startup bevor eine nächste Runde kommt, hat der SAFE-Investor meist einfach Pech gehabt – er verliert sein Investment vollständig, da er weder Anteile noch eine Forderung hat.
- Ausgestaltung für Schließungsfall: Gute SAFE-Verträge enthalten eine Klausel, was bei Liquidation des Unternehmens vor Konvertierung passiert. Oft steht dort, dass der SAFE-Investor dann einen Anspruch erhält, entweder sein Investment (nachrangig) zurückzubekommen oder einen Anteil am Liquidationserlös, je nachdem was höher ist. Beispiel: In Y Combinators SAFE ist typischerweise geregelt, dass bei Auflösung dem SAFE-Investor ein Anspruch in Höhe seines Investments zusteht, aber nach den vorrangigen Gläubigern und gleichrangig mit den Anteilseignern. Praktisch heißt das: Gibt es einen kleinen Rest, wird er zwischen SAFE-Investor und Shareholdern pro rata aufgeteilt. Das verhindert zumindest, dass die Gründer noch Geld rausziehen, während der SAFE-Investor leer ausgeht. Gründer und Investoren sollten sicherstellen, dass solche Klauseln im SAFE stehen, um diesen Worst Case zu regeln.
- Anpassung an deutsches Recht: Da in Deutschland eine Kapitaleinlage in eine GmbH grundsätzlich beurkundet werden muss, kann ein SAFE im Moment der Zeichnung nicht einfach Anteile versprechen, ohne den formalen Weg zu gehen. Die Lösung ist meist, es als schuldrechtlichen Vertrag zu formulieren, der einen Anspruch auf Abschluss eines zukünftigen Zeichnungsvertrags verbrieft. Hier sollte unbedingt juristische Expertise hinzugezogen werden, damit der SAFE nicht wegen Formmangels angreifbar ist. Im Kontext unseres Themas: Die formale Korrektheit schützt zwar nicht vor Scheitern, aber sie stellt sicher, dass beim Scheitern nicht auch noch Rechtsunsicherheit herrscht, wer überhaupt welche Ansprüche hat.
- Investorenschutz vs. Einfachheit: SAFE sind investorfreundlich in Boom-Phasen (schnell und einfach zu investieren, ohne großes Anwaltskosten), aber in Bust-Phasen eher gründerfreundlich (kein Rückzahlungsdruck). Deutsche Investoren sind zum Teil skeptisch gegenüber SAFE, gerade weil sie bei Misserfolg ins Leere greifen. Ein Kompromiss kann sein, SAFE-ähnliche Verträge mit gewissen Schutzmechanismen zu versehen – z.B. doch eine Long-stop Date einzubauen, bei der das SAFE in einen kleinen Anteil wandelt, falls keine Runde kommt (ähnlich wie bei Wandeldarlehen angedeutet). Hauptsache, alle Parteien verstehen die ökonomischen Konsequenzen: Ein SAFE-Investor muss sich bewusst sein, dass er faktisch Eigenkapitalrisiko ohne Stimmrechte trägt.
Mitarbeiterbeteiligungen (ESOP, VSOP etc.)
Mitarbeiterbeteiligungsprogramme sind essenziell, um Talente ins Startup zu holen und zu binden. Gerade in riskanten Geschäftsmodellen lockt man Top-Leute oft nur, indem man ihnen einen attraktiven Equity-Anteil in Aussicht stellt. Doch wenn das Startup scheitert, sind diese Optionen oder Anteile nichts wert. Hier ein paar rechtliche und praktische Punkte, um Enttäuschungen vorzubeugen:
- Aufklärung über Risiken: Mitarbeitern sollte man klar kommunizieren, dass Aktienoptionen oder virtuelle Shares keine garantierte Auszahlung bedeuten. In Arbeitsverträgen mit Beteiligungskomponenten kann ein Hinweis aufgenommen werden wie: “Dem Mitarbeiter ist bewusst, dass die gewährten Optionen nur im Falle eines erfolgreichen Exits oder Börsengangs einen geldwerten Vorteil darstellen; ein Totalverlust des Unternehmenswerts würde die Optionen entwerten.” Dies mag selbstverständlich klingen, aber die Praxis zeigt, dass viele Mitarbeiter die Komplexität (v.a. steuerliche) von Beteiligungen nicht verstehen. Hier kann auch ein Informationsblatt helfen, das dem Beitritt zum ESOP beiliegt und die Funktionsweise erklärt. Zwar schützt das den Gründer nicht vor allem (arglistige Täuschung kann man nicht einfach wegbedingen), aber es schafft Transparenz und reduziert falsche Erwartungen.
- Geeignetes Instrument wählen: In Deutschland unterscheidet man grundsätzlich echte Mitarbeiterbeteiligung (z.B. via direkte GmbH-Anteile oder über Stock Option Programme bei AG/SE) und virtuelle Beteiligungen (VSOP), die eher einer Bonusregelung entsprechen. Bei hochriskanten Startups werden häufig VSOPs genutzt, weil sie flexibel sind und keine sofortige steuerliche Belastung auslösen. Allerdings sind VSOPs rein schuldrechtlich – im Insolvenzfall stehen VSOP-ler als Gläubiger mit leeren Händen da, weil meist im Vertrag steht, dass nur im Exit-Fall eine Auszahlung erfolgt. Echte Anteile geben Mitarbeitern zumindest Gesellschafterstatus, aber sind unflexibel und können bei Scheitern genauso ausfallen. Es gibt seit 2023 das Zukunftsfinanzierungsgesetz in Deutschland, das steuerliche Erleichterungen für Mitarbeiterbeteiligungen bringt. Gründer sollten hier beraten werden, um das passende Modell zu wählen. Wichtig ist: Die Gestaltung soll rechtssicher und verständlich sein – Mitarbeiter sollen wissen, woran sie sind.
- Vesting und Good/Bad Leaver: Standardmäßig sollten Mitarbeiteroptionen über mehrere Jahre vesten (z.B. 4 Jahre mit 1 Jahr Cliff), um sicherzustellen, dass Mitarbeiter dem Unternehmen die Treue halten. Im Fail-Fast-Kontext relevant: Wenn das Startup früh scheitert, sind ggf. viele Optionsanteile noch nicht gevestet – diese verfallen dann schlicht. Das kann man als Vorteil sehen (keine “Überhänge”), aber aus Mitarbeitersicht ist es bitter, wenn man z.B. 1,5 Jahre mitgearbeitet hat, 25% der Optionen gevestet sind, dann scheitert die Firma und alles ist wertlos. Das ist jedoch inhärentes Risiko. Wichtig ist eher, Bad Leaver-Klauseln für Gründer vorzusehen: Sollte ein Gründer selbst “frühzeitig das Handtuch werfen” (z.B. aussteigen, weil es schwierig wird), verfallen seine Anteile oder Optionsrechte größtenteils. Das diszipliniert Gründer, nicht vorschnell bei Gegenwind aufzugeben, und schafft einen gewissen Ausgleich für Investoren und Mitarbeiter, dass der Gründer nicht einfach mit seiner noch hohen Beteiligung weitermacht, während andere das Nachsehen haben.
- Steuerfallen vermeiden: Ein Aspekt, der oft übersehen wird: Mitarbeiterbeteiligungen können im Erfolgsfall großartig sein, im Misserfolgsfall aber auch Steuern auslösen, ohne dass Geld fließt (dies war v.a. bei virtuellen Anteilen ein Problem – sog. Trockensteuer). Das Zukunftsfinanzierungsgesetz versucht hier gegenzusteuern, etwa durch Steuerstundung bis zum Exit. Gründer sollten sicherstellen, dass ihre Programme diese neuen Regeln nutzen. Nichts ist demotivierender (und juristisch angreifbar), als wenn ein Mitarbeiter bei Scheitern plötzlich ein Steuerproblem hat, weil z.B. seine Optionen durch Ausscheiden abgefunden werden mussten. Daher: Beteiligungsprogramme sauber aufsetzen mit Experten, damit im Fail-Fall keine unbeabsichtigten Folgen eintreten.
Weitere Schutzklauseln und Praktiken
- No-Shop und Vertraulichkeit: In Term Sheets üblich ist eine Exklusivitätsklausel, dass der Gründer nicht parallel mit anderen investoren verhandelt. Diese schützt Investoren davor, als Lückenfüller benutzt zu werden. Für unser Thema indirekt relevant: Sie fördert ernsthafte Verhandlungen, verringert aber nicht die Risiko-Thematik. Vertraulichkeitsklauseln (NDAs) sind Standard – sie erlauben Investoren tiefe Einblicke ins Unternehmen, ohne dass der Gründer Angst vor Datenmissbrauch haben muss. So kann der Investor das Risiko besser einschätzen. Gründer sollten hier offen sein, anstatt Dinge zu verschleiern aus Sorge, der Investor könnte abspringen.
- Due Diligence erlauben: Gerade wenn große Risiken bestehen, kann ein offenes Buch Vertrauen schaffen. Investoren, die eine gründliche Due Diligence (auch technisch, nicht nur finanziell) machen dürfen, werden hinterher weniger schnell behaupten können, man habe ihnen etwas vorsätzlich verborgen. Natürlich entbindet das den Gründer nicht von der Pflicht zur Wahrheit – aber Transparenz senkt die Wahrscheinlichkeit, dass etwas “übersehen” wird. Der Investor kann später schwer sagen, er sei arglistig getäuscht worden, wenn er alle Unterlagen prüfen konnte und keine Fragen stellte zu offensichtlichen Unklarheiten. (Allerdings, wie erwähnt, schützt Investor-Nachlässigkeit den Täuschenden im Zweifel nicht. Trotzdem: Kooperative Offenheit ist die beste Prävention.)
- Kommunikation im Krisenfall: Sollte sich abzeichnen, dass das Startup scheitert, ist es ratsam, Investoren und Kernteam frühzeitig einzubinden, statt auf Überraschungseffekte zu setzen. Rechtlich kann spätes Informieren zwar auch eine Aufklärungspflichtverletzung sein (z.B. wenn man wider besseres Wissen das Unvermeidliche rauszögert und noch Mittel einwirbt). Aber vor allem pragmatisch: Häufig gibt es gemeinsam noch Rettungsansätze (Pivot, Notfinanzierung, Verkauf). Wer hier als Gründer den Alleingang macht – etwa insolvenzreif wird und allein zum Gericht marschiert, ohne den Beirat/Investor zu informieren –, verbrennt viel Goodwill und riskiert zudem persönliche Haftung wegen Insolvenzverschleppung, falls er zu spät geht. Besser ist, rechtzeitig alle Karten offen auf den Tisch zu legen. Das ist zwar kein Vertragspunkt, aber oftmals gibt es in Gesellschaftervereinbarungen Reporting-Pflichten oder Pflicht, gewisse Events sofort zu melden (z.B. Kündigung eines Großkunden, Patentklage etc.). Solche Klauseln sollte man ernst nehmen – sie sind im ureigenen Interesse des Gründers, um später nicht als Verschweiger dazustehen.
- Juristische Beratung und Dokumentation: Last but not least – beide Seiten (Gründer und Investor, ebenso wie Mitarbeiter bei Beteiligungsprogrammen) sollten sich qualifiziert beraten lassen. Viele potentielle Konflikte lassen sich durch saubere Vertragsgestaltung entschärfen. Im Nachhinein festzustellen, was “gemeint” war, ist schwierig und führt zu Rechtsstreit. Lieber investiert man upfront etwas in Anwalt und Notar, als später vor Gericht viel mehr zu zahlen. Für Gründer ist es verlockend, mit Vorlagen von Freunden oder aus dem Internet zu arbeiten (gerade SAFE/VSOP etc.), doch die Tücke steckt im Detail. Begriffe müssen richtig übersetzt sein, auf deutsche Gesetze angepasst etc. Eine kleine Unachtsamkeit kann ein ganzes Programm unwirksam machen. Zum Beispiel Gewinnbeteiligungen: Verspricht man Mitarbeitern Gewinnanteile, muss man wissen, dass diese im Verlustfall nicht negativ sein dürfen (kein Verlustausgleich). Solche Feinheiten überblickt man mit professioneller Hilfe.
Zusammengefasst dienen all diese vertraglichen Vorkehrungen dazu, das Erwartungsmanagement zwischen Gründer und Stakeholdern zu steuern und rechtliche Konflikte zu minimieren. Wenn Scheitern ein bewusst in Kauf genommener Teil des Plans ist, dann sollte das vertraglich so untermalt sein, dass niemand “getäuscht” wird. Das bedeutet nicht, dass man den Teufel an die Wand malen muss – aber klare Spielregeln für den Worst Case erleichtern allen Beteiligten den Umgang damit, falls er eintritt.
Fazit: „Fail Fast“ – Mut zur Ehrlichkeit als bester Schutz
Die Kultur des schnellen Scheiterns hat zweifellos ihre Berechtigung in der modernen Startup-Welt. Sie kann Innovation befeuern und Lernprozesse beschleunigen. Doch für Gründer bedeutet „fail fast“ nicht, dass sie Sorgfalt, Loyalität und Recht und Gesetz hintanstellen dürfen. Scheitern wird zur Täuschung, wenn Gründer wissentlich oder leichtfertig über die wahren Risiken und den Zustand ihres Unternehmens hinwegtäuschen, um Stakeholder an Bord zu holen oder zu halten. Die Leidtragenden sind dann Business Angels, Frühphaseninvestoren oder Mitarbeiter, die auf falsche Versprechen vertrauen.
Um dies zu vermeiden, sollten Gründer die folgenden Grundsätze verinnerlichen:
- Ehrliche Risikoaufklärung: Es gehört zum Einmaleins seriösen Unternehmertums, Stakeholder über wesentliche Risiken ins Bild zu setzen. Wer ein hochriskantes Modell verfolgt, sollte das nicht kaschieren, sondern offen benennen – sei es im Investorendeck, im Mitarbeitergespräch oder in der Presse. Transparenz schafft Glaubwürdigkeit und schützt rechtlich vor Vorwürfen der Arglist.
- Realistische Kommunikation statt Hype: Natürlich lebt ein Startup vom Enthusiasmus. Doch es gilt, eine Balance zu finden zwischen visionärer Story und faktischer Korrektheit. “Storytelling” darf nicht in “peddling lies” abgleiten. Gründer sollten sich selbst regelmäßig überprüfen: Unterstützen die aktuellen Zahlen und Fakten noch das gezeichnete Bild? Falls nicht, muss das Narrativ angepasst oder zumindest relativiert werden. Kurz: Versprechen nur, was man auch liefern kann – und bei Ungewissheiten Konjunktive benutzen statt Definitivum.
- Fail Fast = schnell lernen, nicht leichtsinnig handeln: Das Motto sollte im Kern heißen, rasch zu experimentieren und Irrwege frühzeitig zu erkennen. Es bedeutet nicht, blind in Abenteuer zu springen. Jeder Schritt sollte verantwortbar sein. Oder wie es treffend formuliert wurde: „Versteht das ‘Fail’ in ‘Fail Fast’ als schnelles Experimentieren, um Alternativen zu finden, nicht als Freibrief für schlecht durchdachte Risiken“.
- Stakeholder-Management im Krisenfall: Wenn sich Misserfolg abzeichnet, proaktiv und ehrlich den Dialog mit Geldgebern und Mitarbeitern suchen. Gemeinsam lässt sich oft ein Plan B oder zumindest ein geordneter Rückzug gestalten (“fail gracefully”). Das ist nicht nur menschlich fairer, sondern bewahrt auch Reputationen und kann rechtlich relevant sein (Stichwort Insolvenzordnung, Haftung für Verzögerungen).
- Rechtliche Beratung und saubere Verträge: Präventiv ist es unerlässlich, die juristischen Hausaufgaben zu machen. Von Anfang an Aufklärungspflichten ernst nehmen, Dokumentationen sorgfältig erstellen und Zusagen rechtlich prüfen. Vertragliche Klauseln gezielt nutzen, um Klarheit zu schaffen, wer welches Risiko trägt. Bei Unsicherheit: rechtlichen Rat einholen – es geht um viel, oft um existenzielle Fragen.
Letztlich ist ein gewisses Maß an Vertrauen unverzichtbar. Investoren wissen, dass nicht jedes Startup fliegt; Mitarbeiter wissen, dass ein Job in einem jungen Unternehmen keine lebenslange Jobgarantie ist. Aber dieses Vertrauen basiert darauf, dass Gründer redlich und verantwortungsbewusst handeln. Die Romantisierung des Scheiterns darf nie so weit gehen, dass Ehrlichkeit und Pflichtgefühl auf der Strecke bleiben. Sonst wird aus dem “Fail Fast” ein “Fail Ugly” – mit rechtlichen und moralischen Trümmern.
Für Gründer heißt das: Mut zur Wahrheit ist der beste Schutz. Wer seine Vision zwar beherzt verfolgt, aber offen über Klippen und Abgründe spricht, wird im Zweifel auf mehr Nachsicht und Unterstützung stoßen – sowohl von Gerichten als auch von seinen Partnern. Scheitern ist dann kein Makel, sondern ein Schritt auf dem Lernweg, den alle gemeinsam gegangen sind, in gutem Glauben. Und nur so bleibt die Start-up-Kultur des Ausprobierens nachhaltig lebbar, ohne in Zynismus oder Rechtsbruch abzugleiten.
tl;dr: Fail Fast – ja, aber fair bleiben. Entschlossen Risiken eingehen, ohne Stakeholder im Dunkeln zu lassen. Dann ist Scheitern kein Betrug, sondern Teil des unternehmerischen Abenteuers, das alle Beteiligten bewusst eingegangen sind.