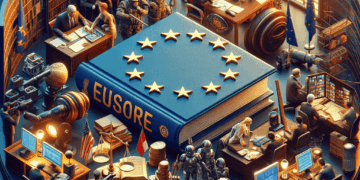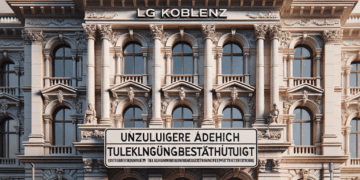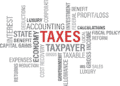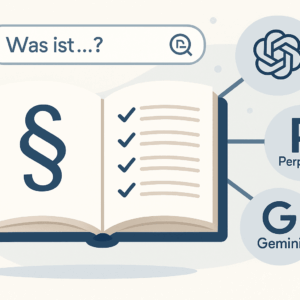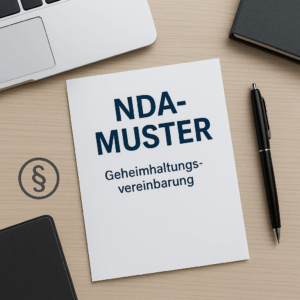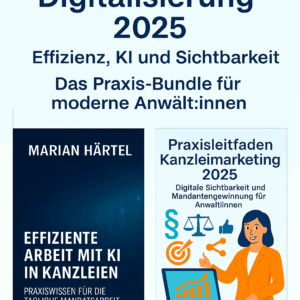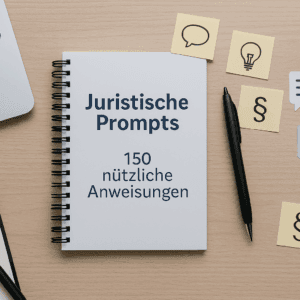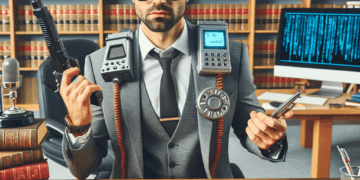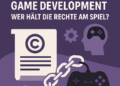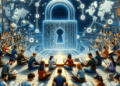Im Mai 2024 wurde mit der Verordnung (EU) 2024/1083 das Europäische Medienfreiheitsgesetz (European Media Freedom Act, EMFA) im Amtsblatt der EU veröffentlicht. Erstmals schafft die EU damit einen gemeinsamen Rechtsrahmen für Medienfreiheit und -pluralismus in allen Mitgliedstaaten. Ziel der Verordnung ist es, grundlegende Prinzipien wie redaktionelle Unabhängigkeit, Medienpluralität und freie grenzüberschreitende Medienangebote im Binnenmarkt zu schützen und zu fördern.
Hintergrund des EMFA sind besorgniserregende Entwicklungen in einigen Ländern: staatliche Eingriffe in Medien, politische Einflussnahme auf öffentlich-rechtliche Sender, intransparente Medieneigentümerstrukturen und die fragmentierten nationalen Regelungen zum Schutz der Medienfreiheit. Zudem tragen die Digitalisierung und die Marktmacht großer Online-Plattformen dazu bei, dass journalistische Inhalte neuen Gefährdungen ausgesetzt sind.
Das EMFA reagiert auf diese Herausforderungen mit verbindlichen Regeln für Medienunternehmen, Online-Plattformen und staatliche Stellen. Es ergänzt damit bestehende EU-Regelungen wie die Digitale-Dienste-Verordnung (DSA) und die Audiovisuelle Mediendienste-Richtlinie (AVMD-RL) um sektorspezifische Vorgaben für den Medienbereich. Die Verordnung ist seit 7. Mai 2024 in Kraft und gilt – nach Übergangsfristen – ab August 2025 unmittelbar in allen Mitgliedstaaten. Nachfolgend werden die zentralen Inhalte des EMFA strukturiert dargestellt.
Redaktionelle Freiheit und Schutz vor staatlichem Eingriff
Kernstück des EMFA ist die Garantie der redaktionellen Unabhängigkeit von Medien und der Schutz journalistischer Arbeit vor staatlicher Einflussnahme. Artikel 4 EMFA statuiert ein umfassendes Gebot an die Mitgliedstaaten, die tatsächliche redaktionelle Freiheit der Mediendiensteanbieter zu achten. Weder staatliche Stellen noch Regulierungsbehörden dürfen demnach versuchen, redaktionelle Entscheidungen zu beeinflussen oder in die inhaltliche Ausrichtung von Medien einzugreifen (Art. 4 Abs. 2 EMFA). Dieses Interventionsverbot zielt darauf ab, jegliche Form indirekter Zensur zu untersagen – es entspricht dem Geist von Art. 11 der EU-Grundrechtecharta und auch dem Zensurverbot des deutschen Art. 5 Abs. 1 Satz 3 GG.
Darüber hinaus stärkt das EMFA ausdrücklich den Schutz journalistischer Quellen und Kommunikation. Artikel 4 Abs. 3 EMFA verbietet den Mitgliedstaaten, Medien oder Journalisten zur Preisgabe von Informationen über vertrauliche Quellen zu zwingen. Ebenso untersagt ist das Überwachen, Abhören, Durchsuchen oder Beschlagnahmen bei Medienschaffenden oder ihren Kontaktpersonen, wenn dies dem Auffinden von Quellen dienen soll. Selbst der Einsatz von Spähsoftware (Spyware) auf Geräten von Journalist:innen oder ihres Umfelds ist grundsätzlich verboten. Diese klaren Vorgaben setzen hohe Hürden für staatliche Eingriffe: Sie greifen bewährte Grundsätze der Rechtsprechung (insb. des EGMR und BVerfG) zum Quellenschutz auf und erheben sie nun zum EU-weit geltenden Standard.
Allerdings erkennt das EMFA an, dass in Ausnahmefällen staatliche Maßnahmen nötig sein können. Artikel 4 Abs. 4–6 EMFA enthält eng begrenzte Ausnahmetatbestände: Ein Eingriff – etwa eine Durchsuchung in einer Redaktion oder der Einsatz von Überwachungssoftware – darf nur erfolgen, wenn er gesetzlich vorgesehen, zur Verfolgung eines überwiegenden legitimen Interesses unerlässlich und verhältnismäßig ist und vorab von einem unabhängigen Gericht gebilligt wurde (Art. 4 Abs. 4 EMFA). Im Fall von Spyware-Einsatz ist zusätzlich erforderlich, dass es um die Aufklärung besonders schwerer Straftaten geht (Art. 4 Abs. 5 EMFA). Diese Voraussetzungen stellen sicher, dass journalistische Schutzrechte nur bei erheblicher Gefahr – etwa Terrorismus – und unter richterlicher Kontrolle eingeschränkt werden dürfen. Eine automatische Massenüberwachung von Medienleuten ist damit klar ausgeschlossen.
Insgesamt verankert das EMFA damit auf Unionsebene einen robusten Schutz der Pressefreiheit. Für Deutschland bedeutet dies keine radikale Umstellung, da Art. 5 GG einen ähnlichen Schutz vorsieht. Vielmehr ergänzt das EMFA den Grundrechtsschutz und schafft verbindliche Mindeststandards in allen EU-Staaten. Deutsche Journalist:innen profitieren direkt: Ihre Quellen und Daten sind nun europaweit besser vor staatlicher Ausforschung geschützt.
Vorgaben für öffentlich-rechtliche Medienorganisationen
Ein weiterer Schwerpunkt des EMFA liegt auf der Unabhängigkeit öffentlich-rechtlicher Medienanstalten. Öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten spielen in vielen Mitgliedstaaten – auch in Deutschland – eine zentrale Rolle für die demokratische Meinungsbildung. Doch ihre Nähe zum Staat birgt die Gefahr politischer Einflussnahme. Artikel 5 EMFA verpflichtet die Mitgliedstaaten deshalb, wirksame Schutzvorkehrungen für die unabhängige Funktionsweise öffentlich-rechtlicher Mediendiensteanbieter zu gewährleisten.
Konkret fordert Art. 5 Abs. 1 EMFA, dass öffentlich-rechtliche Sender redaktionell und organisatorisch unabhängig agieren können und ihrem öffentlichen Programmauftrag unparteiisch nachkommen. Insbesondere müssen Verfahren zur Bestellung und Abberufung der Führungsgremien so ausgestaltet sein, dass die Unabhängigkeit gewahrt bleibt (Art. 5 Abs. 2 EMFA). Geschäftsführer oder Direktoren öffentlich-rechtlicher Sender sind nach transparenten, offenen und diskriminierungsfreien Verfahren auszuwählen, die objektive Kriterien zugrunde legen. Ihre Amtszeit muss eine ausreichende Länge haben, um tatsächliche Unabhängigkeit zu ermöglichen. Eine Abberufung vor Ablauf der Amtszeit darf nur aus wichtigem Grund erfolgen, muss ausreichend begründet sein und den Betroffenen Rechtsschutz (gerichtliche Überprüfung) eröffnen. Damit schreibt das EMFA Grundsätze fest, die in Deutschland durch die Rechtsprechung (etwa das ZDF-Urteil des BVerfG von 2014) bereits angestoßen wurden: weniger politischer Proporz bei Personalentscheidungen und effektive Rechtsschutzmöglichkeiten gegen Absetzungen.
Auch die Finanzierung öffentlich-rechtlicher Medien muss laut EMFA besonderen Kriterien genügen. Art. 5 Abs. 3 EMFA verlangt transparente und objektive Verfahren zur Finanzierung, die angemessene, ausreichende und planbare Mittel sicherstellen. Die Finanzierung soll so beschaffen sein, dass redaktionelle Unabhängigkeit nicht gefährdet wird – z.B. keine jährlichen willkürlichen Budgetkürzungen als Druckmittel. Mehrjährige Finanzierungsentscheidungen werden ausdrücklich empfohlen. Dieser Ansatz deckt sich im Grundsatz mit dem deutschen System der Beitragsfinanzierung durch den Rundfunkbeitrag, der ebenfalls auf Stabilität und Staatsferne angelegt ist. Probleme wie die politisch blockierte Beitragsanpassung 2020/21 zeigen jedoch, dass solche Vorgaben wichtig bleiben: Das EMFA könnte die Mitgliedstaaten anhalten, Verfahren einzuführen, die politische Einflussnahme auf Budgets noch weiter reduzieren.
Schließlich verpflichtet Art. 5 Abs. 4 EMFA die Staaten, unabhängige Stellen einzurichten, die über die Einhaltung der genannten Vorgaben wachen. Diese Aufsichtsmechanismen müssen frei von politischer Einmischung sein; ihre Beobachtungen zur Governance öffentlich-rechtlicher Medien sollen veröffentlicht werden. In Deutschland existieren bereits Gremien wie Rundfunkräte und Fernsehräte, die programmliche Unabhängigkeit überwachen, sowie Kommissionen wie die KEF, die die Finanzbedarfe ermitteln. Ob diese Gremien den Anforderungen des EMFA genügen oder ob neue externe Kontrollinstanzen geschaffen werden müssen, wird der deutsche Gesetzgeber prüfen. Denkbar wäre, die bestehenden Rundfunkgremien zu stärken oder eine koordinierende Stelle auf Länderebene einzurichten, die Einhaltung der EMFA-Grundsätze dokumentiert.
Insgesamt dürfte das EMFA im deutschen Kontext wenig Konflikt, aber einige Anpassungsbedarfe mit sich bringen. Art. 5 GG gewährleistet die Rundfunkfreiheit; das EMFA konkretisiert diese durch verfahrensrechtliche Sicherungen. Zwar fällt die Organisation des Rundfunks laut deutschem Verfassungsrecht in die Hoheit der Länder (Kultur- und Rundfunkhoheit). Doch durch den Binnenmarktbezug der Verordnung (Art. 114 AEUV als Rechtsgrundlage) kann die EU hier gewisse Mindeststandards setzen. Diese stehen im Einklang mit dem gemeinsamen Ziel, einen unabhängigen öffentlichen Rundfunk zu erhalten – ein Ziel, dem auch der Medienstaatsvertrag der Länder verpflichtet ist. Der Medienstaatsvertrag (MStV) selbst enthält allerdings bislang keine detaillierten Vorgaben zur inneren Organisation der öffentlich-rechtlichen Anstalten; diese sind in separaten Rundfunkstaatsverträgen geregelt. Hier werden Bund und Länder bis 2025 die Regelungen anpassen müssen, um z.B. die in Art. 5 EMFA geforderte Transparenz der Berufungsverfahren oder den expliziten Schutz vor politischer Abberufung in deutsches Recht zu überführen.
Transparenzpflichten: Eigentumsverhältnisse und staatliche Werbung
Um Medienpluralismus zu fördern und verborgenem Einfluss vorzubeugen, schreibt das EMFA umfangreiche Transparenzpflichten für Medienunternehmen vor. Bereits in den Erwägungsgründen betont die Verordnung, wie entscheidend es für das Vertrauen der Bürger ist, zu wissen, wem ein Medium gehört und wer hinter der Finanzierung steht. Nur so können mögliche Interessenkonflikte erkannt und die Zuverlässigkeit von Informationen beurteilt werden.
Offenlegung von Eigentümerstrukturen
Artikel 6 Abs. 1 EMFA verpflichtet alle Mediendiensteanbieter, bestimmte aktuelle Informationen leicht zugänglich für ihr Publikum zu machen. Dazu zählen insbesondere:
- Name und Kontaktdaten des Anbieters (i.d.R. im Impressum bereits üblich),
- Direkte oder indirekte Eigentümer, die einen maßgeblichen Einfluss auf das Unternehmen ausüben können (z.B. Gesellschafter mit Kontrollbeteiligungen, einschließlich staatlicher Stellen als Anteilseigner),
- Letztendlich wirtschaftlich Berechtigte (Beneficial Owners) gemäß der Definition des Geldwäsche-Rechts – also die natürlichen Personen, die im Hintergrund über Gesellschaftsgeflechte mehr als 25% der Anteile halten oder Kontrolle ausüben,
- Einnahmen aus staatlicher Unterstützung in Form von Werbung: konkret der jährliche Gesamtbetrag, den das Medium aus staatlicher* Werbung erhält, sowie die Summe etwaiger Werbeeinnahmen von Behörden aus Nicht-EU-Staaten (z.B. Inserate staatlicher Stellen aus Drittstaaten).
Durch diese Pflicht zur Offenlegung sollen Leserinnen und Leser auf einen Blick erkennen, wer die Eigentümer sind und ob ein Medium erheblich von staatlichen Mitteln profitiert. Gerade im Print- und Online-Bereich gab es bisher in Deutschland keine so weitgehende Pflicht: Zwar verlangt das Presserecht typischerweise ein Impressum mit Verlag und Verantwortlichen, doch die offenlegungspflichtigen Beteiligungsverhältnisse waren begrenzt. Nach EMFA müssen nun auch indirekte Beteiligungen und beneficial owners kenntlich gemacht werden. Medienunternehmen werden deshalb ihre Eigentümerstruktur überprüfen und diese Informationen auf ihrer Webseite veröffentlichen (ggf. im Impressumsbereich oder einem Transparenzbericht). Für kleine Verlage mag das unkompliziert sein (etwa „Inhaber: Max Mustermann“). Komplexere Medienhäuser müssen jedoch die Beteiligungsstränge bis zur letzten natürlichen Person offenlegen.
Flankierend sollen die nationalen Behörden öffentliche Datenbanken zum Medieneigentum einrichten (Art. 6 Abs. 2 EMFA). Dies bedeutet, dass in jedem Mitgliedstaat ein Register entsteht, in dem die offengelegten Informationen der Medien zentral abrufbar sind. Eine solche Datenbank erhöht die Transparenz noch weiter und ermöglicht etwa Journalist:innen und der Öffentlichkeit, medienübergreifend Eigentümerverflechtungen zu recherchieren. In Deutschland könnte diese Aufgabe bei den Landesmedienanstalten oder einer neuen Bundesstelle liegen. Bisher gibt es kein zentrales Medienbesitzregister, nur verstreute Handelsregisterdaten und teilweise Medienkonzentrationsberichte für Rundfunk. Das EMFA fordert hier eine neue Infrastruktur für Transparenz, was einen gewissen administrativen Aufwand mit sich bringen wird.
Regeln für staatliche Werbung und kommerzielle Beziehungen
Neben der Offenlegung seitens der Medien zielt das EMFA auch auf Transparenz und Fairness bei staatlicher Medienfinanzierung ab. Staatliche Werbung – definiert weit als jegliche entgeltliche Kommunikationsmaßnahme öffentlicher Stellen in Medien (von Anzeigenkampagnen bis Imagewerbung staatlicher Unternehmen) – soll nicht länger ein Graubereich sein, in dem verdeckte Einflussnahme oder Günstlingswirtschaft gedeihen können.
Die Verordnung schreibt gemeinsame Grundsätze für die Vergabe von staatlicher Werbung vor: Sie muss auf transparenten, objektiven, verhältnismäßigen und nichtdiskriminierenden Kriterien beruhen (Erwägungsgrund 73 EMFA). Praktisch heißt das, öffentliche Stellen – von Ministerien über Landesbehörden bis zu Kommunen – dürfen ihre Anzeigenetats nicht nach politischer Gefälligkeit verteilen. Stattdessen sollen Vergabekriterien (wie Reichweite, Zielgruppenpassung, Preis-Leistungsverhältnis) vorab veröffentlicht werden. Die Verfahren sollen wettbewerblich und fair ausgestaltet sein, sodass eine Vielfalt von Medien – nationale wie lokale, große wie kleine – eine Chance auf Werbeaufträge erhält.
Zugleich verlangt das EMFA eine Veröffentlichungspflicht für die Empfänger staatlicher Werbeausgaben und die jeweiligen Beträge. Die Mitgliedstaaten müssen dafür sorgen, dass Informationen darüber, welche Medien welches Volumen an staatlicher Werbung erhalten haben, in elektronischer Form öffentlich zugänglich gemacht werden. Diese Transparenz soll das Risiko verdeckter Subventionen verringern: Wenn z.B. eine Regierung gezielt bestimmten wohlgesinnten Medien hohe Anzeigenbudgets zuschiebt, wäre dies künftig nachvollziehbar und öffentlich diskutierbar.
In Deutschland könnten solche Regeln Reibungspunkte mit föderalen Strukturen aufwerfen, da staatliche Werbung dezentral von unzähligen Stellen vergeben wird (Bund, Länder, Kommunen, Behörden). Bislang gibt es keine einheitliche Publizität darüber, wie viel Geld die öffentliche Hand insgesamt in Medienwerbung steckt. Das EMFA wird hier wohl die Einführung eines Melde- und Veröffentlichungssystems erfordern. Beispielsweise könnte jährlich berichtet werden, welche Summen an Werbeschaltungen an welche Medien geflossen sind – ähnlich wie es etwa im Bereich der öffentlichen Auftragsvergabe bereits Transparenzregister gibt.
Rechtlich dürften diese Vorgaben vereinbar mit dem deutschen Rahmen sein: Zwar regelt Art. 5 GG die Pressefreiheit, aber Transparenz über staatliche Gelder stellt keinen Eingriff, sondern vielmehr eine gute Verwaltungspraxis dar. Konflikte mit dem Medienstaatsvertrag sind wenig wahrscheinlich, da dieser Bereich – staatliche Werbeaufträge – bisher nicht spezifisch normiert ist. Vielmehr ergänzen die EMFA-Vorgaben das deutsche Vergaberecht und verhindern, dass die Ausnahme des Mediensektors von der klassischen Vergabe (etwa für redaktionelle Inhalte, vgl. § 12 Abs. 2 Nr. 1 VOL/A) missbraucht wird. Behörden werden ihre Vergabepraxis anpassen müssen, um den EMFA-Prinzipien zu genügen, was insbesondere für kleine Medien positiv sein kann: Lokale und unabhängige Medienhäuser erhalten eher eine Chance auf staatliche Anzeigenschaltungen, wenn diese transparent ausgeschrieben und nicht hinter verschlossenen Türen vergeben werden.
Pflichten sehr großer Online-Plattformen im Umgang mit journalistischen Inhalten
Angesichts der wachsenden Bedeutung von Online-Plattformen für die Verbreitung von Nachrichten widmet sich das EMFA auch dem Schutz journalistischer Inhalte im digitalen Raum. Große Plattformen wie soziale Netzwerke, Videoplattformen oder Suchmaschinen fungieren für viele Menschen als „Gatekeeper“ zu Nachrichten. Entsprechend können ihre Algorithmen und Moderationsentscheidungen erheblichen Einfluss darauf haben, welche Medieninhalte sichtbar sind. Um zu verhindern, dass journalistische Beiträge ungerechtfertigt gelöscht, gesperrt oder heruntergestuft werden, enthält das EMFA spezielle Pflichten für „sehr große Online-Plattformen“ (VLOPs) im Sinne der DSA (also Dienste mit über 45 Mio. Nutzern in der EU).
Die Zielsetzung dieser Regelungen ist klar: Redaktionelle Inhalte sollen vor automatischen Löschungen oder Sichtbarkeitsbeschränkungen geschützt werden, solange sie nicht gegen Gesetze verstoßen. Hintergrund sind Fälle, in denen algorithmische Filtersysteme legitime Medienbeiträge irrtümlich als Verstoß markieren – etwa Bilder aus Kriegsgebieten, die als „Gewalt“ gesperrt werden, oder investigativer Content, der fälschlich als Desinformation eingestuft wird. Hier schafft das EMFA nun prozessuale Sicherungen.
Im Kern verlangt die Verordnung von VLOPs, bei Maßnahmen gegen Inhalte anerkannter Medienanbieter besondere Sorgfalt walten zu lassen: Bevor eine Plattform Inhalte eines Mediendienstes löscht oder deren Sichtbarkeit einschränkt (z.B. durch De-Listing oder „Shadow Banning“), muss sie das betroffene Medienunternehmen vorab informieren und anhören. Konkret schreibt das EMFA vor, dass die Plattform eine Begründung für die geplante Entfernung oder Sperrung mitteilen muss – unter Verweis auf die einschlägigen Gemeinschaftsstandards oder AGB-Regeln, gegen die der Inhalt angeblich verstößt. Diese schriftliche Benachrichtigung entspricht den Anforderungen an Transparenz aus der DSA (Art. 17 DSA) und der P2B-Verordnung, geht aber im Medienkontext noch einen Schritt weiter:
Der Mediendiensteanbieter muss nämlich die Gelegenheit erhalten, binnen 24 Stunden auf die Mitteilung zu reagieren und seinen Standpunkt darzulegen. Erst nach Ablauf dieser Frist – oder nach Stellungnahme des Medienanbieters – darf die Plattform die endgültige Entscheidung treffen und entsprechende Maßnahmen ergreifen. In dringenden Fällen, etwa in einer definierten Krise nach Art. 36 Abs. 2 DSA (z.B. bei Desinformationskampagnen im Krieg), kann die Frist verkürzt werden, muss dem Medium aber trotzdem eine sinnvolle Möglichkeit zur Reaktion lassen. Sobald die Plattform eine Entscheidung getroffen hat (etwa die Sperrung bleibt aufrecht), ist der Mediendienst unverzüglich zu benachrichtigen.
Diese Verfahrenspflichten stellen sicher, dass keine automatisierte Löschung im Blindflug erfolgt, ohne dass das betroffene Medium sich äußern konnte. Dadurch können Fehlentscheidungen vermieden werden – z.B. kann ein Nachrichtendienst der Plattform erklären, warum ein scheinbar problematisches Video in seinen Nachrichtenzusammenhang gehört und kein Regelverstoß ist. Für kleine Nachrichtenportale oder freie Journalist:innen ist dies besonders wichtig, da sie sich so gegen ungerechtfertigte Moderation wehren können, bevor der Schaden (Unsichtbarkeit ihrer Inhalte) eintritt.
Neben dieser Vorabbeteiligung schreibt das EMFA vor, dass Beschwerden von Mediendiensten priorisiert behandelt werden müssen. Plattformen müssen ihre internen Beschwerde- und Aufklärungssysteme (bekannt aus Art. 20 DSA) so ausgestalten, dass Beschwerden von Mediendiensteanbietern unverzüglich und vorrangig geprüft und entschieden werden. Medien können sich dabei von Verbänden vertreten lassen, was insbesondere freien Journalist:innen hilft, die sich z.B. über Presseverbände Gehör verschaffen können.
Stellt ein Mediendienst fest, dass eine Plattform wiederholt ohne triftigen Grund seine Inhalte beschränkt, so hat er Anspruch auf einen Dialog mit der Plattform (Art. 17 Abs. 6 EMFA, sinngemäß). Die Plattform muss dann in Treu und Glauben mit dem Medienanbieter zusammenarbeiten, um eine gütliche Lösung zu finden und künftige unberechtigte Sperrungen zu vermeiden. Der Mediendienst kann das neu eingerichtete EU-Gremium (siehe nächster Abschnitt) und die EU-Kommission über solche Fälle informieren und sogar eine Stellungnahme des Gremiums erbitten. Damit wird eine Eskalationsmöglichkeit geschaffen, falls Plattformen sich trotz der Vorgaben stur stellen – das EU-Board kann Empfehlungen aussprechen, wie die Plattform künftig verfahren sollte, um die Medienfreiheit zu respektieren.
Wichtig ist: Diese Privilegierung gilt nicht grenzenlos. Illegale Inhalte oder klar rechtswidrige Posts von Medien fallen nicht unter den Schutz – die Plattform darf und muss solche gemäß DSA und anderen Gesetzen entfernen (für solche Fälle sieht das EMFA vor, dass die Sonderregeln nicht greifen, etwa wenn es um Terrorpropaganda oder strafbare Hate Speech geht). Ebenso nicht geschützt sind Fake-Profile, die sich unberechtigt als „Medien“ ausgeben. Ein Mediendienst muss vermutlich bestimmte Kriterien erfüllen oder eine Erklärung abgeben, dass er sich an journalistische Sorgfalt hält, um in den Genuss der beschriebenen Behandlung zu kommen. Das EMFA erwähnt eine Erklärung des Mediendienstes (wohl in Art. 17 Abs. 1 EMFA), mit der dieser sich zu grundlegenden journalistischen Standards bekennt – etwa zur Einhaltung von Gesetzen und zur Verantwortlichkeit für Inhalte. Dies dient dazu, „Rogue Media“, die nur zum Schein Medienfreiheit beanspruchen (z.B. ausländische Desinformationskanäle), nicht unter den Schutzschirm zu lassen. Für echte Medien stellt die Erklärung kein Hindernis dar, da seriöse Anbieter ohnehin nach solchen Standards arbeiten (z.B. Einhaltung des Pressekodex).
In Summe stärkt das EMFA damit signifikant die Position von Medien gegenüber großen Tech-Plattformen. Für deutsche Medienhäuser – ob großer Verlag oder lokale Online-Zeitung – bedeuten die neuen Regeln einen zusätzlichen Rechtsschutz im digitalen Raum: Ihre publizierten Inhalte können nicht mehr ohne weiteres automatisiert verschwinden, ohne dass eine Begründung und Anhörung erfolgt. Sollte eine Plattform dennoch willkürlich handeln, gibt es auf EU-Ebene ein Forum, das den Fall beleuchtet. Dies unterfüttert letztlich auch Art. 5 GG, der ja die Verbreitung von Informationen schützt: Wo früher faktisch die privaten Plattformregeln die „neue Zensurgefahr“ darstellten, zieht die EU nun Grenzen ein, um journalistische Inhalte zu bewahren. Konflikte mit deutschem Recht sind insoweit kaum zu befürchten – eher eine Ergänzung des Ordnungsrahmens um Aspekte, die national gar nicht geregelt werden könnten (da Plattformen oft nicht national, sondern europaweit operieren).
Europäisches Gremium für Mediendienste (European Board for Media Services)
Zur Umsetzung und Überwachung der neuen Regeln schafft das EMFA eine neue Institution auf EU-Ebene: das Europäische Gremium für Mediendienste, auch European Board for Media Services genannt (Art. 8 EMFA). Dieses Gremium ist als unabhängiges Organ konzipiert, das die Kooperation der nationalen Medienaufsichtsbehörden bündelt und für kohärente Rechtsanwendung sorgen soll.
Das Board setzt sich aus den Vertretern der jeweiligen nationalen Regulierungsbehörden zusammen, die für Medien zuständig sind (Art. 10 Abs. 1 EMFA). In Deutschland wären das voraussichtlich die Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten (für den privaten Rundfunk und Telemedien) sowie eventuell Vertreter für den Pressebereich – wobei zu klären ist, welche Stelle hier offiziell entsandt wird, da es für Presse bisher keine staatliche Regulierungsbehörde gibt. Denkbar ist, dass Deutschland einen Vertreter der Landesmedienanstalten bestimmt, die traditionell auch Jugendschutz und Medienintermediäre beaufsichtigen. Jeder Mitgliedstaat hat jedenfalls eine Stimme im Gremium; Beschlüsse sollen mit Zweidrittelmehrheit gefasst werden (Art. 10 Abs. 2–3). Die EU-Kommission nimmt als Beobachter ohne Stimmrecht teil (Art. 10 Abs. 6).
Organisatorisch ersetzt das Board die bisher informelle ERGA (European Regulators Group for Audiovisual Media Services), die im Rahmen der AVMD-Richtlinie bestand (Art. 8 Abs. 2 EMFA). Das neue Gremium hat aber eine breitere Agenda als ERGA, die primär auf audiovisuellen Medien lag. Es soll alle Mediensektoren im Blick haben, also auch Presse und digitale Medien, soweit diese unter das EMFA fallen. Wichtig ist: Das Board agiert unabhängig und darf keine Weisungen von Regierungen annehmen (Art. 9 EMFA). Seine Unabhängigkeit wird auch dadurch gestützt, dass die EU-Kommission ein Sekretariat stellt (Art. 11 EMFA), welches die administrativen Aufgaben übernimmt und das Gremium fachlich unterstützt, ohne selbst steuernd einzugreifen.
Die Aufgaben des Europäischen Medien-Boards sind vielfältig: Laut EMFA (insb. Art. 12 ff.) soll es die einheitliche Anwendung des Medienfreiheitsgesetzes fördern und bei grenzüberschreitenden Medienfragen koordinierend wirken. Beispielsweise wird das Board:
- Leitlinien und Stellungnahmen ausarbeiten, etwa zur Umsetzung der Transparenzpflichten (z.B. wie die Medien-Eigentümerdatenbanken konkret gestaltet werden) oder zu Kriterien fairer staatlicher Werbevergabe. So ist ausdrücklich vorgesehen, dass das Gremium in Beratung mit der Kommission Stellungnahmen zu Medien-Eigentumsdatenbanken und weiteren Themen abgeben kann.
- Bei Streitfällen zwischen nationalen Behörden vermitteln – etwa wenn eine Maßnahme in einem Mitgliedstaat die Medienfreiheit eines Anbieters aus einem anderen Staat berührt, kann das Board konsultiert werden.
- Konzentrationsentwicklungen beobachten: Die Verordnung verlangt von den Mitgliedstaaten, wichtige Medienmarkt-Konzentrationen auf ihre Auswirkungen auf die Meinungsvielfalt und redaktionelle Unabhängigkeit zu prüfen. Das Board dürfte hierbei eine Rolle spielen, z.B. durch Auswertung der nationalen Berichte und Austausch von Best Practices. So soll vermieden werden, dass medienpolitische Entscheidungen in einem Land die Binnenmarktziele der EU (freier Informationsfluss, Pluralismus) beeinträchtigen.
- Das Board wird ferner in Fällen wiederholter Plattform-Konflikte (wie oben beschrieben) angerufen werden können und Empfehlungen abgeben, um Lösungen herbeizuführen.
- Schließlich soll das Gremium insgesamt einen Überblick über die Lage der Medienfreiheit in der EU behalten und ggfs. Warnungen aussprechen, wenn systematische Probleme auftreten (z.B. staatliche Einschüchterung von Medien in irgendeinem Land, manipulative ausländische Einflussnahme etc.).
Das European Board for Media Services markiert damit einen Paradigmenwechsel: Erstmals gibt es eine förmliche europäische Medienaufsichts-Kooperation jenseits des rein audiovisuellen Bereichs. Während die inhaltliche Medienaufsicht weiter national verbleibt (etwa Presseaufsicht traditionell durch Selbstkontrolle), sorgt das Board dafür, dass die im EMFA gesteckten Grenzen und Vorgaben überall einheitlich respektiert werden.
In Deutschland könnte insbesondere die Verzahnung mit der bisherigen Medienanstalts-Struktur eine Herausforderung sein. Der Medienstaatsvertrag hat bereits eine Kommission (KJM) für Jugendschutz und die KEK für Konzentrationskontrolle im Rundfunk. Die KEK prüft seit Jahren Medienkonzentrationen im TV-Bereich und veröffentlicht Berichte über marktbeherrschende Stellungen (z.B. Zuschaueranteile). Das EMFA fordert nun eine Bewertung „wesentlicher Medienmarkt-Konzentrationen“ auf Meinungsvielfalt. Dies dürfte ähnlich gelagert sein wie die Aufgaben der KEK, allerdings möglicherweise sektorübergreifend (Print, Online und Rundfunk zusammengenommen). Das Board könnte hier länderübergreifende Fusionen begutachten oder Mindeststandards für nationale Fusionsprüfungen empfehlen. Beispielsweise, falls ein großer Verlag in mehreren EU-Ländern Zeitungen aufkauft, könnten nationale Behörden über das Board Informationen austauschen, um die europäische Medienvielfalt zu wahren.
Da das Board rein koordinierende und beratende Funktionen hat, sind Konflikte mit deutschem Verfassungsrecht unwahrscheinlich. Die Hoheit der Länder über Kultur und Medien wird nicht ausgehöhlt, denn das Gremium kann keine hoheitlichen Entscheidungen in Deutschland treffen – es gibt aber der europäischen Dimension der Medienaufsicht eine Stimme. Für deutsche Medienregulatoren bedeutet es Mehraufwand und Zusammenarbeit: etwa regelmäßige Treffen auf EU-Ebene, das Erstellen von Berichten und Stellungnahmen. Langfristig könnte dies aber auch deutsche Interessen schützen, indem Missstände in anderen Ländern nicht unbeobachtet bleiben (z.B. Politisierung öffentlich-rechtlicher Sender in Mitgliedstaat X), die indirekt auch den Wettbewerbsrahmen deutscher Medien tangieren.
Neue Pflichten und Compliance für kleine Medien und Journalist:innen
Das EMFA richtet sich ausdrücklich nicht nur an große Konzerne oder den Staat, sondern an alle Mediendiensteanbieter, wozu auch kleine Verlage, lokale Sender und freie Journalist:innen zählen, sofern sie redaktionell-verantwortliche Dienste für die Allgemeinheit anbieten. Welche praktischen Änderungen kommen auf diese Akteure zu?
Zunächst die Transparenzpflichten: Jede/r Medienanbieter:in muss bis 2025 die eigene Publikation dahingehend prüfen, welche Informationen nach Art. 6 EMFA offengelegt werden müssen. Für Ein-Personen-Journalist:innen oder kleine Online-Magazine ist das meist einfach – sie müssen klarstellen, wer sie sind (Name/Kontakt) und ob es weitere Eigentümer gibt (meist nein außer der Inhaber selbst). Sollte allerdings z.B. ein lokales Nachrichtenportal im Hintergrund einen Investor haben, so muss dessen Identität genannt werden. Auch Anteile öffentlicher Stellen (z.B. eine Stadt hält Beteiligung an einem Anzeigenblatt) sind offenlegungspflichtig. Ebenso müssen alle Medien jährlich ausweisen, ob sie Geld für Anzeigen von öffentlichen Stellen erhalten haben. Ein freier Journalist mit eigenem Blog würde hier z.B. angeben, falls er für ein Ministerium eine Werbekampagne geschaltet hat. Zwar betrifft staatliche Werbung vor allem traditionelle Medien (klassische Printanzeigen, Rundfunkspots) – aber auch Online-Banner eines Rathauses auf einem lokalen Newsportal fallen darunter. Entsprechend müssen selbst kleinere Medien solche Einnahmen überblicken und veröffentlichen.
Diese Transparenzanforderungen bedeuten einen Compliance-Aufwand, der aber überschaubar bleibt: Es geht um das Sammeln und jährlich Aktualisieren einiger Daten. Viele Medienhäuser verfügen intern bereits über diese Informationen (etwa aus dem Beteiligungsbericht oder der Buchhaltung). Neu ist lediglich, dass sie proaktiv veröffentlicht werden müssen. Medienunternehmen sollten daher Prozesse etablieren, um die EMFA-Daten (Eigentümer, Beneficial Owner, staatliche Anzeigenerlöse) zuverlässig zu erfassen und etwa auf ihrer Webseite bereitzustellen. Größere Verlagshäuser könnten dazu jährliche Transparenzberichte veröffentlichen. Für Kleinunternehmen genügt vermutlich eine Rubrik „Über uns“ mit den geforderten Angaben. Zu beachten ist, dass bei Veränderungen (z.B. ein neuer Haupteigentümer steigt ein) die Informationen aktuell gehalten werden müssen.
Ein heikler Punkt könnte die Offenlegung wirtschaftlich Berechtigter sein – insbesondere wenn hinter einem Medium vermögende Privatpersonen stehen, die bislang anonym bleiben wollten. Hier kollidiert potentiell das Interesse an Transparenz mit Datenschutz oder Persönlichkeitsrechten. Das EMFA gewichtet aber das öffentliche Interesse höher: Gerade bei politisch einflussreichen Medien (“politisch exponierte” Eigentümer) soll die Öffentlichkeit erfahren, wer im Hintergrund steht. In Deutschland wird das prinzipiell durch das Transparenzregister (für Unternehmen) und das Presserecht unterstützt, sodass keine unüberwindbaren rechtlichen Hürden bestehen. Dennoch müssen Medienanwälte ihre Mandanten darauf vorbereiten, dass Anonymität von Medienmäzenen nicht länger garantiert ist – die neue Regel ist EU-weit zwingend.
Des Weiteren fordert Art. 6 Abs. 3 EMFA von Nachrichtenanbietern, interne Maßnahmen zur Sicherung redaktioneller Unabhängigkeit zu ergreifen. Dies richtet sich vor allem an die Medienunternehmen selbst: Sie sollen geeignete Vorkehrungen treffen, damit Redaktionen frei von unzulässiger Einflussnahme (etwa durch Eigentümer oder Anzeigenkunden) arbeiten können. Explizit nennt das Gesetz das Ziel, Konflikte offen zulegen und freie Entscheidungen im Rahmen der festgelegten redaktionellen Linie zu ermöglichen. Für die Praxis bedeutet das, dass Redaktionen und Verlage ihre Redaktionsstatute, Compliance-Regeln oder Verhaltenskodizes überprüfen sollten. Viele – insbesondere größere – Medien haben bereits Richtlinien, z.B. zur Trennung von Redaktion und Verlag („Chinese Wall“ zwischen Anzeigenabteilung und Redaktion) oder zur Behandlung von Eigeninteressen. Das EMFA motiviert auch kleinere Redaktionen, solche Grundsätze zu formulieren. Beispielsweise könnte ein lokaler Verlag schriftlich fixieren, dass die Chefredaktion weisungsfrei berichten darf und dass Eigentümer bei bestimmten heiklen Themen keinen Einfluss nehmen. Oder freie Journalist:innen könnten transparent machen, wenn sie über Themen schreiben, in denen sie persönlich engagiert sind (Interessenkonflikt). Zwar sind diese Pflichten etwas ungenau („Maßnahmen, die sie für angemessen erachten“), aber sie setzen doch einen Standard, an dem man sich messen lassen muss. Sollte es zu Streit kommen (z.B. ein entlassener Redakteur behauptet, der Besitzer habe in die Berichterstattung politisch eingegriffen), könnte künftig auch die Frage relevant sein, ob der Verlag die nach EMFA erforderlichen internen Schutzmaßnahmen hatte oder vernachlässigt hat. Mandanten – gerade aus dem Bereich kleiner Medienunternehmen – sollten daher beraten werden, freiwillig ein Redaktionsstatut oder einen Code of Conduct einzuführen, der den EMFA-Zielen entspricht. Dies fördert nicht nur die Compliance, sondern auch das Vertrauen der Leserschaft.
Für freie Journalistinnen und Journalisten bringt das EMFA neben Pflichten vor allem neue Rechte. Sie genießen nun einen europaweit einheitlichen Mindestschutz vor staatlicher Willkür (Durchsuchungen, Beschlagnahmen, Überwachung – unzulässig außer bei schwersten Straftaten und mit Richterbeschluss). Das stärkt ihre Position auch in Deutschland, etwa wenn grenzüberschreitende Ermittlungen stattfinden. Zudem können sich freie Medienschaffende bei Problemen mit Plattformen künftig auf die EMFA-Regeln stützen: Wenn z.B. der YouTube-Kanal einer freien Journalistin wegen angeblicher AGB-Verstöße gesperrt wird, kann sie die in der Verordnung vorgesehenen Verfahren einfordern (Begründung, Anhörung, beschleunigte Beschwerde). Praktisch dürfte dies zunächst über die Beschwerdemanagement-Systeme der Plattform laufen, aber notfalls wäre auch eine Beschwerde bei der zuständigen Behörde möglich, die dann das Board einschalten könnte.
Allerdings sollten Einzeljournalist:innen, um diese Vorteile nutzen zu können, sicherstellen, dass sie im Sinne der Verordnung als Mediendiensteanbieter gelten. Die Definition von „Mediendienst“ im EMFA orientiert sich daran, ob unter redaktioneller Verantwortung Inhalte verbreitet werden (Art. 2 EMFA). Ein journalistischer Blog oder YouTube-Kanal kann darunter fallen, sofern er regelmäßig Nachrichten/Informationsinhalte bietet. Es ist denkbar, dass Plattformen von Medienanbietern eine Selbsterklärung oder Registrierung verlangen, um sie als privilegiert zu behandeln. Daher könnte es für Freelancer sinnvoll sein, sich etwa einer Branchenorganisation (Presseverein o.Ä.) anzuschließen oder auf der eigenen Website deutlich zu machen, dass man journalistische Sorgfaltsstandards befolgt. So kann man im Zweifel gegenüber einer Plattform oder Behörde belegen, dass man die Kriterien eines seriösen Mediendienstes erfüllt.
Zusammengefasst ergibt sich für kleinere Medien und Journalisten ein gewisses Maß an neuen organisatorischen Pflichten (Transparenzinformationen bereitstellen, interne Unabhängigkeits-Regeln beachten) – gleichzeitig aber auch ein Zugewinn an Rechten und Rechtssicherheit in Ausübung ihres Berufs. Die Mühen der Compliance stehen also im Zeichen eines höheren Guts: der Stärkung von Medienfreiheit und integrer Berichterstattung im gesamten EU-Raum. Anwälte im Medienrecht werden ihre Mandanten in den kommenden Monaten dabei unterstützen müssen, diese neuen Anforderungen umzusetzen, etwa durch Beratung beim Erstellen eines konformen Impressums oder beim Entwurf von Redaktionsleitlinien, sowie bei der Wahrnehmung neuer Rechte (z.B. Verfahren vor dem Medien-Board).
Ausblick: Bedeutung des EMFA für Medienfreiheit und Pluralismus
Das Europäische Medienfreiheitsgesetz stellt einen Meilenstein in der europäischen Medienpolitik dar. Erstmals gibt es einen verbindlichen Rechtsakt, der über reine Marktregulierung hinaus direkt freiheitssichernde Normen für den Mediensektor setzt. In einer Zeit, in der in Teilen Europas die Presse unter Druck geraten ist – Stichwort politisierte Medienaufsicht, Oligarchisierung der Medienmärkte oder staatliche Propaganda – zieht die EU mit dem EMFA eine rote Linie: Medienfreiheit und Medienvielfalt sind essenzielle Grundlagen der Demokratie und dürfen im Binnenmarkt nicht zur Disposition stehen.
Für Deutschland, mit seiner langen Tradition starker Pressefreiheit (Art. 5 GG) und dualen Rundfunksystems, mögen viele Regelungen des EMFA selbstverständlich klingen. Doch die Harmonisierung auf EU-Ebene sorgt dafür, dass diese Standards auch andernorts gelten und so grenzüberschreitend faire Wettbewerbsbedingungen entstehen. Deutsche Medienunternehmen profitieren davon, wenn z.B. in Nachbarstaaten transparentere Eigentumsverhältnisse herrschen oder wenn ein in einem EU-Land politisch „gleichgeschalteter“ öffentlich-rechtlicher Sender nicht länger mit versteckter staatlicher Finanzierung Marktverzerrungen betreibt. Umgekehrt werden sich deutsche Regeln – etwa zur Medienkonzentrationskontrolle – ins europäische Gefüge einpassen und möglicherweise weiterentwickeln müssen, um dem Austausch innerhalb des Boards standzuhalten.
Ein Spannungsfeld bleibt die Kompetenzfrage: Kritiker könnten einwenden, die EU überschreite mit medienpolitischen Vorgaben ihre Zuständigkeiten, da Medien kultur- und verfassungsrechtlich sensibel sind. Doch die Kommission hat das EMFA bewusst als Binnenmarktmaßnahme konstruiert, mit der Begründung, dass uneinheitliche Regelungen und medienfeindliche Maßnahmen in einzelnen Ländern den freien Dienstleistungsverkehr und Wettbewerb verzerren. Diese Argumentation ist plausibel, zumal das EMFA keine inhaltliche Medienaufsicht ausübt, sondern Strukturprinzipien vorgibt (ähnlich wie z.B. Korruptionsbekämpfung oder Datenschutz auch auf Binnenmarktklauseln fußen). Aus deutscher Sicht ist die Vereinbarkeit mit Art. 5 GG gegeben, da das EMFA die Pressefreiheit nicht einschränkt, sondern konkretisiert und absichert. Das Grundrecht wird in seinem Kern (freie Gründung von Presse, keine Zensur) nicht angetastet. Vielmehr implementiert die Verordnung sogar auf einfachgesetzlicher Ebene, was das Grundgesetz implizit voraussetzt: Staatsferne der Medien, Vielfaltssicherung, Schutz journalistischer Arbeit.
In der Praxis wird es darauf ankommen, wie effektiv das EMFA durchgesetzt wird. Ein EU-Regelwerk ist nur so gut wie seine Implementierung vor Ort. Hier wird das European Board for Media Services eine tragende Rolle spielen: Wenn etwa ein Mitgliedstaat zögert, unliebsame Transparenzpflichten durchzusetzen (man denke an Länder, in denen regierungsnahe Oligarchen Medien kontrollieren), kann das Board – gestützt durch die Kommission – Druck ausüben oder Öffentlichkeit herstellen. Ebenso bei Missbrauch der staatlichen Werbebudgets: Durch die neuen Publizitätspflichten könnten solche Vorgänge rasch ans Licht kommen und auch innerhalb der EU Thema werden.
Das EMFA versteht sich damit auch als Schutzschild gegen politische Einflussnahme. Gerade kleinen, unabhängigen Medien bietet es einen Rahmen, der ihre Existenzbedingungen verbessert: Wenn sie wissen, dass staatliche Stellen ihre Anzeigen nicht nur den großen regierungsfreundlichen Blättern zuschanzen dürfen, oder wenn sie sich gegen ungerechtfertigte Sperren bei Facebook & Co wehren können, stärkt dies die Vielfalt. Die Verordnung ist auch ein Statement gegen Konzentrationstendenzen: Zwar verbietet sie keine Medienfusionen, aber sie zwingt zur Reflektion auf Meinungsvielfalt bei jedem großen Zusammenschluss. Das Zusammenspiel mit dem deutschen Medienkonzentrationsrecht (z.B. 30%-Zuschaueranteilsgrenze im TV) könnte hier spannend werden – womöglich inspirieren die EU-Vorgaben den deutschen Gesetzgeber, auch für Presse/Online eine stärkere Fusionskontrolle einzuführen, oder jedenfalls die Auswirkungen auf die Öffentlichkeit systematisch bewerten zu lassen (was über das kartellrechtliche Marktanteilsdenken hinausgeht).
Für Mandanten – ob Verlag, Journalist:in oder Rundfunkveranstalter – bedeutet das EMFA, dass Medienfreiheit künftig nicht nur ein Abwehrrecht gegen den Staat ist, sondern mit positiven Pflichten aller Akteure unterlegt wird. Freiheit der Berichterstattung wird so durch Transparenz, Fairness und Rechenschaftspflichten flankiert. Diese Entwicklung entspricht einem modernen Verständnis von Pressefreiheit: nicht absolut schrankenlos, aber resilient gegen Manipulation.
Abschließend lässt sich feststellen: Das Europäische Medienfreiheitsgesetz wird die Medienlandschaft in der EU auf lange Sicht prägen. Es ist ein umfassendes juristisches Instrument, das einerseits den Schutzschirm für freie Medien verstärkt und andererseits gemeinsame Spielregeln für einen fairen Medienmarkt definiert. Gerade in Zeiten, in denen der mediale Informationsraum durch digitale Dynamiken, aber auch gezielte Angriffe (Stichwort Desinformation) herausgefordert ist, setzt die EU hier ein deutliches Zeichen. Für kleinere Medien und Journalist:innen, wie sie von spezialisierten IT- und Medienrechtskanzleien häufig beraten werden, gilt es nun, sich frühzeitig auf die neuen Anforderungen einzustellen – und die Chancen zu nutzen, die das EMFA für eine wehrhafte, pluralistische Medienordnung bietet.