OLG München: Zustellungen an Facebook in Deutsch möglich
Das Problem wirksamer Zustellung Will man für Mandanten auf Facebook oder Instagram, aber auch auf Twitter oder anderen Social Networks...
Mehr lesenDetailsIn meiner Beratungspraxis begegnet mir immer wieder die Frage, ob Anbieter von SaaS-Lösungen oder Onlineshops ihre Nutzer zur aktiven Zustimmung zu Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) oder Datenschutzerklärungen auffordern sollten. Oft geschieht dies aus Unsicherheit oder dem Wunsch, juristisch abgesichert zu sein. Doch genau das Gegenteil kann der Fall sein: Eine solche Aufforderung ist in vielen Fällen nicht notwendig und kann sogar rechtliche Probleme verursachen. In diesem Beitrag erkläre ich, warum eine Zustimmung zu AGB überflüssig ist, warum die Aufforderung zur Zustimmung bei Datenschutzerklärungen problematisch sein kann und wie Sie als Anbieter juristisch korrekt vorgehen können.
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln die vertraglichen Rechte und Pflichten zwischen Ihnen als Anbieter und Ihren Nutzern. Nach deutschem Recht (§ 305 Abs. 2 BGB) müssen AGB lediglich „wirksam einbezogen“ werden, damit sie Vertragsbestandteil werden. Eine aktive Zustimmung der Nutzer ist dafür nicht erforderlich. Entscheidend ist, dass die AGB für den Nutzer zumutbar wahrgenommen werden können, also leicht zugänglich sind, bevor der Vertrag geschlossen wird.
Stellen Sie sicher, dass Ihre AGB gut sichtbar und leicht zugänglich sind – etwa durch einen Link im Footer Ihrer Website oder während des Bestellprozesses. Vermeiden Sie Checkboxen zur Zustimmung und setzen Sie stattdessen auf klare Hinweise wie „Mit Nutzung unserer Dienste akzeptieren Sie unsere AGB.“
Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) schreibt vor, dass Nutzer über die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten informiert werden müssen. Diese Informationspflicht wird durch die Datenschutzerklärung erfüllt. Anders als oft angenommen ist jedoch keine aktive Zustimmung des Nutzers zur Datenschutzerklärung erforderlich – und in vielen Fällen wäre dies sogar juristisch falsch.
Stellen Sie sicher, dass Ihre Datenschutzerklärung leicht zugänglich ist – etwa durch einen Link im Footer Ihrer Website oder während des Registrierungsprozesses. Verlangen Sie keine aktive Zustimmung zur Datenschutzerklärung, sondern informieren Sie Ihre Nutzer klar und transparent über die Datenverarbeitung gemäß Art. 12 DSGVO.
Anstatt Ihre Nutzer aktiv zur Zustimmung aufzufordern, sollten Sie folgende Maßnahmen ergreifen:
Die Aufforderung zur aktiven Zustimmung zu AGB oder einer Datenschutzerklärung mag auf den ersten Blick sinnvoll erscheinen – tatsächlich birgt sie jedoch unnötige Risiken und Hürden für Ihre Nutzer. Stattdessen sollten Sie auf klare Informationen, Transparenz und einfache Prozesse setzen. So erfüllen Sie nicht nur alle juristischen Anforderungen, sondern schaffen auch Vertrauen bei Ihren Kunden.Wenn Sie Unterstützung bei der Gestaltung Ihrer AGB oder Datenschutzerklärung benötigen oder Fragen zum Thema haben, stehe ich Ihnen gerne als Berater zur Seite!
Marian Härtel ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für IT-Recht mit einer über 25-jährigen Erfahrung als Unternehmer und Berater in den Bereichen Games, E-Sport, Blockchain, SaaS und Künstliche Intelligenz. Seine Beratungsschwerpunkte umfassen neben dem IT-Recht insbesondere das Urheberrecht, Medienrecht sowie Wettbewerbsrecht. Er betreut schwerpunktmäßig Start-ups, Agenturen und Influencer, die er in strategischen Fragen, komplexen Vertragsangelegenheiten sowie bei Investitionsprojekten begleitet. Dabei zeichnet sich seine Beratung durch einen interdisziplinären Ansatz aus, der juristische Expertise und langjährige unternehmerische Erfahrung miteinander verbindet. Ziel seiner Tätigkeit ist stets, Mandanten praxisorientierte Lösungen anzubieten und rechtlich fundierte Unterstützung bei der Umsetzung innovativer Geschäftsmodelle zu gewährleisten.
Das Problem wirksamer Zustellung Will man für Mandanten auf Facebook oder Instagram, aber auch auf Twitter oder anderen Social Networks...
Mehr lesenDetailsDer Kunstbegriff und seine juristische Definition Der Kunstbegriff ist ein facettenreiches und oft kontrovers diskutiertes Thema. Kunst kann in vielen...
Mehr lesenDetailsAls Rechtsanwalt begegne ich immer wieder Fällen, in denen Startups durch rechtliche Fallstricke unerwartet ins Straucheln geraten. Ein solcher Stolperstein,...
Mehr lesenDetailsMit Urteil vom 13.09.2018 hat der BGH unter dem Aktenzeichen I ZR 117/15 entschieden, dass ein bei YouTube betriebener Videokanal,...
Mehr lesenDetailsDas Bundesverwaltungsgericht hat entschieden, dass der Betreiber einer Unternehmensseite auf Facebook verpflichtet werden kann, seine Fanpage abzuschalten, falls die von...
Mehr lesenDetailsEin interessantes Urteil aus meinem Gebiet IT-Recht kommt vom Kammergericht in Berlin. Es beschäftigt sich mit der Frage, ob ein...
Mehr lesenDetailsOLG Hamm: Nachweis des E-Mail-Zugangs bleibt Herausforderung Das Oberlandesgericht (OLG) Hamm hat in einem aktuellen Beschluss (Az. 26 W 13/23...
Mehr lesenDetailsIch freue mich, euch eine neue Funktion auf meinem Blog vorzustellen, die darauf abzielt, eure Interaktion beim Lesen der Artikel...
Mehr lesenDetailsImmer wieder taucht im Bereich von Computerspielmandanten die Frage auf, ob Spielregeln geschützt sind oder ob man diese "kopieren" dürfte....
Mehr lesenDetailsEs ist spätabends, der Kaffee neben dem Laptop ist längst kalt, doch ich lächle zufrieden: In wenigen Stunden habe ich...
Mehr lesenDetails 120 Minuten: Videoberatung via Microsoft Teams 120 Minuten – Ausführlich, vertieft und individuell
535,50 €
120 Minuten: Videoberatung via Microsoft Teams 120 Minuten – Ausführlich, vertieft und individuell
535,50 €
 Praxisleitfaden Kanzleimarketing 2025 Digitale Sichtbarkeit und Mandantengewinnung für Anwält:innen
49,99 €
Praxisleitfaden Kanzleimarketing 2025 Digitale Sichtbarkeit und Mandantengewinnung für Anwält:innen
49,99 €
inkl. MwSt.
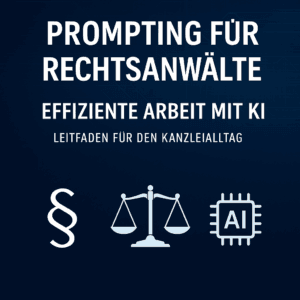 Effiziente Arbeit mit KI in Kanzleien – Praxiswissen für die tägliche Mandatsarbeit
Effiziente Arbeit mit KI in Kanzleien – Praxiswissen für die tägliche Mandatsarbeit
inkl. MwSt.
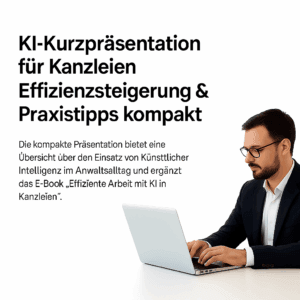 KI-Kurzpräsentation für Kanzleien – Effizienzsteigerung & Praxistipps kompakt
9,99 €
KI-Kurzpräsentation für Kanzleien – Effizienzsteigerung & Praxistipps kompakt
9,99 €
inkl. MwSt.
 Schriftsätze und Verträge mit KI – Intensivkurs am 16.09.2025
416,50 €
Schriftsätze und Verträge mit KI – Intensivkurs am 16.09.2025
416,50 €
Willkommen zur dritten Episode unseres Podcasts "IT Media Law"! In dieser Folge tauchen wir ein in die faszinierende Welt der...
Mehr lesenDetailsIn diesem Video rede ich ein wenig über transparente Abrechnung und wie ich kommuniziere, was es kostet, wenn man mit...
Mehr lesenDetails