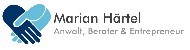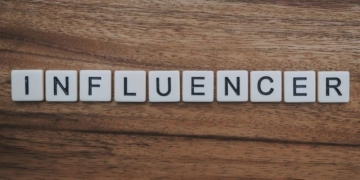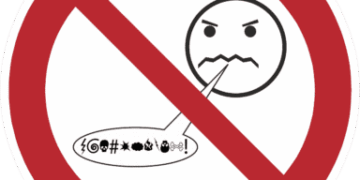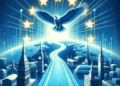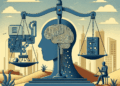In kaum einer Phase eines Startups wird so schnell unterschrieben wie in der Frühphase von Kooperationen, Investments oder Übernahmen. Ein Investor möchte „erst einmal die Eckpunkte festhalten“, ein strategischer Partner schlägt ein „unverbindliches Memorandum“ vor, ein Käufer bittet um ein „Letter of Intent, damit wir vorankommen“. Der Tenor ist fast immer derselbe: Das ist noch kein Vertrag, das bindet euch nicht, das ist nur ein Zwischenschritt.
Genau diese Annahme führt regelmäßig zu rechtlichen und wirtschaftlichen Problemen. Denn das deutsche Recht kennt keine magische Kategorie „unverbindlich“. Entscheidend ist nicht die Überschrift eines Dokuments, sondern sein Inhalt, sein Kontext und das Verhalten der Parteien. Was als unverbindlich gemeint ist, kann rechtlich sehr wohl Bindungswirkungen entfalten – und zwar genau dort, wo Gründer sie am wenigsten erwarten.
Der folgende Beitrag erläutert, warum LOIs, Term Sheets und MoUs für Startups besonders riskant sind, welche rechtlichen Mechanismen greifen, wo typische Streitpunkte entstehen und warum gerade diese Dokumente zu den häufigsten Auslösern frühphasiger Auseinandersetzungen gehören.
Warum Vorverträge gerade für Startups so gefährlich sind
Startups bewegen sich in einem Umfeld aus Zeitdruck, Abhängigkeiten und asymmetrischer Verhandlungsmacht. Wer Kapital sucht oder einen strategischen Partner gewinnen will, befindet sich selten in einer komfortablen Position. Entsprechend groß ist die Bereitschaft, „erst einmal etwas zu unterschreiben“, um den Prozess am Laufen zu halten.
LOIs, Term Sheets und MoUs erfüllen dabei eine psychologische Funktion. Sie signalisieren Fortschritt, Ernsthaftigkeit und Exklusivität. Für Investoren und Partner schaffen sie Verbindlichkeit, ohne sich selbst bereits vollständig festzulegen. Für Gründer entsteht hingegen häufig ein trügerisches Sicherheitsgefühl: Man glaubt, noch jederzeit aussteigen zu können, solange kein „richtiger Vertrag“ geschlossen wurde.
Diese Asymmetrie ist kein Zufall. Vorvertragliche Dokumente werden regelmäßig so gestaltet, dass sie für die eine Seite möglichst flexibel bleiben, während sie für die andere Seite faktische oder rechtliche Bindungen erzeugen. Wer das nicht erkennt, läuft Gefahr, sich frühzeitig in eine Sackgasse zu manövrieren.
Unverbindlich ist kein Rechtsbegriff
Aus juristischer Sicht sind LOI, Term Sheet und MoU zunächst einmal nichts anderes als schuldrechtliche Vereinbarungen. Sie sind nicht per se unverbindlich und nicht per se bindend. Entscheidend ist, welche Verpflichtungen konkret übernommen werden.
Ein häufiger Irrtum besteht darin, die Unverbindlichkeit aus der Bezeichnung des Dokuments abzuleiten. Ob ein Papier „Letter of Intent“, „Term Sheet“ oder „Memorandum of Understanding“ heißt, ist rechtlich nahezu irrelevant. Maßgeblich ist allein, ob und in welchem Umfang sich die Parteien zu einem bestimmten Verhalten verpflichten.
Dabei sind zwei Ebenen zu unterscheiden. Zum einen kann ein Vorvertrag bereits einzelne verbindliche Regelungen enthalten, etwa zu Exklusivität, Vertraulichkeit, Kostenverteilung oder Vertragsstrafen. Diese Regelungen sind regelmäßig isoliert bindend, auch wenn der Rest des Dokuments als unverbindlich bezeichnet wird.
Zum anderen kann bereits die Aufnahme von Vertragsverhandlungen rechtliche Pflichten auslösen. Das deutsche Recht kennt mit der culpa in contrahendo ein Haftungsregime für vorvertragliche Pflichtverletzungen. Wer Verhandlungen aufnimmt, muss dies ernsthaft tun, darf keine falschen Erwartungen wecken und darf den Verhandlungspartner nicht ohne sachlichen Grund schädigen.
Gerade hier liegt ein erhebliches Risiko für Startups. Denn während Gründer häufig davon ausgehen, jederzeit aussteigen zu können, sehen Gerichte das differenzierter. Wer über Wochen oder Monate verhandelt, interne Informationen preisgibt, Ressourcen bindet und sich exklusiv festlegt, kann sich nicht ohne Weiteres folgenlos zurückziehen.
Culpa in contrahendo
Die culpa in contrahendo ist einer der meistunterschätzten Aspekte bei LOIs und Term Sheets. Sie greift immer dann, wenn durch das Verhalten einer Partei beim Vertragsschluss oder in der Vertragsanbahnung ein schutzwürdiges Vertrauen verletzt wird.
Für Startups ist das besonders relevant, weil sie häufig strukturelle Nachteile haben. Wird ein Gründerteam etwa dazu bewegt, andere Investoren abzulehnen, interne Strukturen anzupassen oder erhebliche Vorleistungen zu erbringen, entsteht ein Vertrauenstatbestand. Bricht der Investor die Verhandlungen dann ohne nachvollziehbaren Grund ab, kann dies schadensersatzpflichtig sein.
Umgekehrt kann auch das Startup haften. Wer etwa einem Investor oder Partner signalisiert, dass nur noch Details zu klären sind, während intern längst Zweifel bestehen, setzt sich einem erheblichen Risiko aus. Der bloße Hinweis auf die „Unverbindlichkeit“ eines LOI schützt hier nicht automatisch.
Entscheidend ist die Gesamtsituation: Dauer und Intensität der Verhandlungen, Grad der Einigung, konkrete Zusagen, wirtschaftliche Abhängigkeiten und das Verhalten der Parteien. Je weiter die Verhandlungen fortgeschritten sind, desto höher sind die Anforderungen an einen rechtmäßigen Abbruch.
Exklusivität und Break-up Fees
Besonders konfliktträchtig sind Exklusivitätsklauseln. Sie sind in Term Sheets und LOIs äußerst beliebt, weil sie dem Investor oder Partner Zeit und Sicherheit verschaffen. Für Startups bedeuten sie jedoch häufig eine faktische Blockade.
Wer sich exklusiv bindet, verzichtet darauf, parallel mit anderen Interessenten zu sprechen. Das mag in bestimmten Situationen sinnvoll sein, etwa wenn ein konkretes Angebot ernsthaft verfolgt wird. Problematisch wird es jedoch, wenn Exklusivität ohne klare Fristen, Bedingungen oder Ausstiegsmöglichkeiten vereinbart wird.
Noch brisanter sind sogenannte Break-up Fees oder Kostenerstattungsregelungen. Sie sollen den Aufwand einer Partei absichern, falls der Deal scheitert. In der Praxis führen sie jedoch häufig dazu, dass das Startup unter erheblichen finanziellen Druck gerät, selbst wenn der Abbruch sachlich gerechtfertigt wäre.
Rechtlich sind solche Klauseln nicht per se unzulässig, unterliegen aber strengen Anforderungen. Insbesondere dürfen sie nicht dazu führen, dass eine Partei faktisch gezwungen wird, einen für sie nachteiligen Vertrag abzuschließen, nur um Kosten zu vermeiden. In der Frühphase eines Startups können solche Regelungen existenzbedrohend sein.
Typische Streitkonstellationen aus der Praxis
Die meisten Streitigkeiten rund um LOIs und Term Sheets entstehen nicht wegen spektakulärer Vertragsbrüche, sondern wegen vermeintlicher Selbstverständlichkeiten. Gründer gehen davon aus, dass man „noch nichts fest zugesagt“ habe, während die Gegenseite sich bereits in einer verbindlichen Beziehung sieht.
Häufige Konfliktfelder sind etwa der Umgang mit vertraulichen Informationen, die Nutzung von im Rahmen der Verhandlungen gewonnenem Know-how oder die Frage, ob bestimmte Vorleistungen vergütet werden müssen. Auch interne Umstrukturierungen, die auf Wunsch des potenziellen Investors vorgenommen wurden, spielen regelmäßig eine Rolle.
Besonders problematisch ist, dass diese Streitigkeiten zu einem Zeitpunkt auftreten, an dem das Startup eigentlich wachsen sollte. Statt Produktentwicklung und Marktaufbau stehen dann Anwaltsschreiben, Schadensberechnungen und strategische Blockaden im Vordergrund.
Warum diese Themen klassische Mandatsfälle sind – und kein Randproblem
LOIs, Term Sheets und MoUs sind kein exotisches Spezialthema, sondern Alltag in der Startup-Welt. Genau deshalb werden sie so häufig unterschätzt. Sie wirken harmlos, sind kurz, oft nur wenige Seiten lang. Gerade diese vermeintliche Einfachheit ist gefährlich.
Aus anwaltlicher Sicht handelt es sich um einen klassischen Frühphasen-Beratungsfall. Kleine Formulierungsunterschiede entscheiden darüber, ob ein Dokument steuernd, schützend oder gefährlich ist. Wer hier frühzeitig sauber strukturiert, verhindert spätere Eskalationen.
Für Startups bedeutet das: Vorvertragliche Dokumente sind keine Formalie, sondern ein rechtlich relevanter Schritt. Sie verdienen die gleiche Aufmerksamkeit wie der eigentliche Vertrag – wenn nicht sogar mehr. Denn sie setzen den Rahmen für alles, was folgt.
Fazit:
LOIs, Term Sheets und MoUs sind kein rechtsfreier Raum. Sie können binden, verpflichten und haftungsrelevant sein, auch wenn sie ausdrücklich als unverbindlich bezeichnet werden. Für Startups liegt die Gefahr weniger im Dokument selbst als in der falschen Erwartungshaltung.
Wer diese Instrumente bewusst und strukturiert einsetzt, kann sie sinnvoll nutzen. Wer sie unterschreibt, um „erst einmal weiterzukommen“, ohne die rechtlichen Folgen zu bedenken, setzt sein Unternehmen unnötigen Risiken aus.
Gerade in der Frühphase entscheidet sich oft, ob ein Startup handlungsfähig bleibt oder sich frühzeitig verstrickt. Saubere vorvertragliche Gestaltung ist dabei kein Luxus, sondern Teil unternehmerischer Sorgfalt.