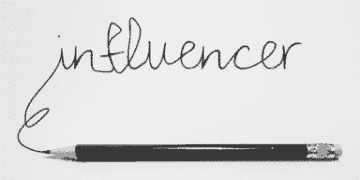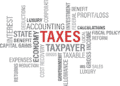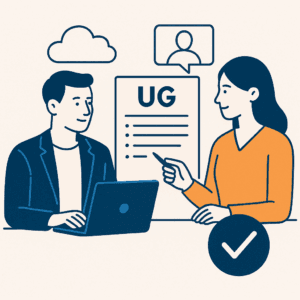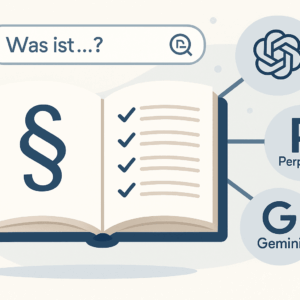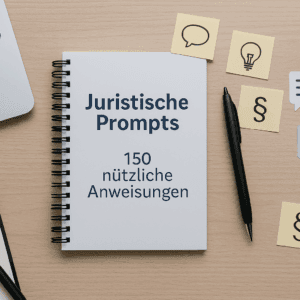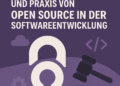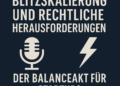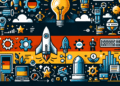So langsam wird es einsam für die Rechtsmeinungen, die vertreten, dass Instagram-Posts von Influencern nur dann entsprechend gekennzeichnet werden müssen, wenn wirklich eine Gegenleistung erfolgt ist. Zahlreiche Landgerichte sind bereits mit Influencer hart ins Gericht gegangen, darunter das Landgericht Itzehoe, das Landgericht Karlsruhe, das Landgericht Heilbronn, und natürlich das Landgericht Berlin. Das Urteil des Landgericht München zu Cathy Hummels steht noch aus, die Landesmedienanstalten werden aber immer aktiver in Sachen YouTube. Auch obergerichtlich wird die Sache nun immer klarer, denn neben dem Kammergericht in Berlin, da die Pflichten nur konkretisiert, dem Landgericht Berlin aber zum Großteil recht gegeben hat, hat nun auch das OLG Braunschweig entschieden.
Dieses urteilte, dass eine die objektive Vermutung bestehen würde, dass es sich um kennzeichnungspflichtige Werbung handeln würde, wenn eine Influencerin bei Instagram, ohne nachvollziehbaren sachlichen Anlass, Nachrichten zu Produkten bekannter Markenherstellern veröffentlichen würde.
Die Influencerin würde daher die Beweislast treffen, zu beweisen, dass es sich bei den Veröffentlichungen tatsächlich nur um eine redaktionelle Berichterstattung handelt. Die Vermutung des Gericht basierte vor allem auf dem üblichen Setup bei Instagram, wonach bei einem Klick auf die präsentierten Bilder die Marken der Hersteller erscheinen, wodurch Nutzer/Follower der Influencerin durch einen Klick zur Instagram-Seite des Herstellers geführt werden. Auch die Gestaltung der Fotos erinnerte im vorliegenden Fall, soweit ebenso nichts Besonderes, eher an einen Modekatalog als an eine redaktionelle Berichterstattung.
Wie schon das Kammergericht und zuletzt das Landgericht Karlsruhe, ist auch das Oberlandesgericht Braunschweig der Meinung, dass Schleichwerbung nicht von einer tatsächlich Bezahlung, zumal für den einen konkreten Post, abhängig sei.
Entsprechend ist die Beklagte auch durchaus bereit, für Produktplatzierungen Entgelte von Drittunternehmen anzunehmen […] Sie differenziert lediglich sachwidrig danach, ob sie ein Entgelt erhält oder nicht, und meint, Werbung liege so lange nicht vor, wie keine materielle Gegenleistung des betreffenden Unternehmens erbracht werde.
Der Erhalt einer Gegenleistung […] zwar ein Indiz für eine geschäftliche Handlung darstellt, aber nicht allein entscheidend ist. Bereits die hier den Umständen nach naheliegende Erwartung, das Interesse von Drittunternehmen an einem Influencer-Marketing in Kooperation mit der Beklagten zu wecken und auf diese Weise Umsätze zu generieren, genügt.
Influencern, sei es auf Twitter, Instagram, Twitch oder YouTube, kann nur weiterhin nur geraten werden, sich qualifizierte Beratung in Sachen Werbung, Wettbewerbsrecht und/oder Unternehmensgründung zu holen.