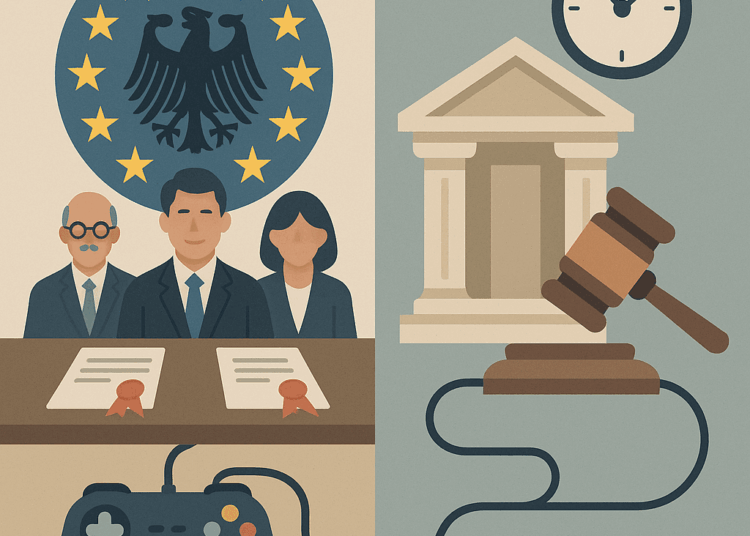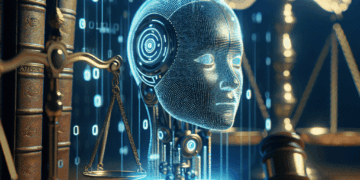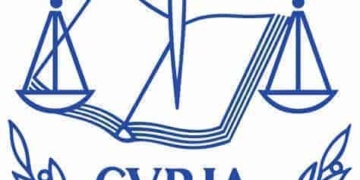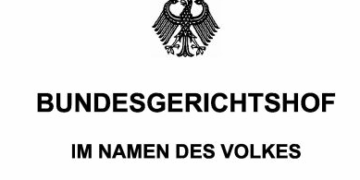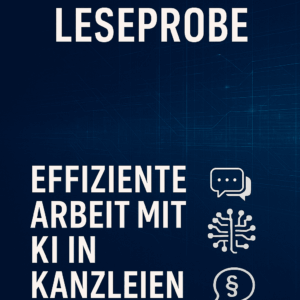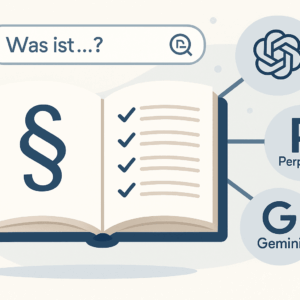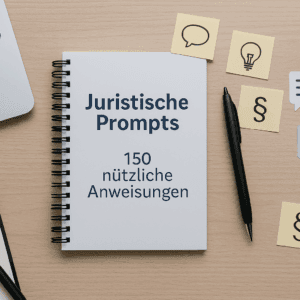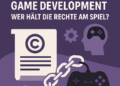Einleitung
Schiedsvereinbarungen haben im Games-Sektor einen guten Klang: vertraulich, schneller, international anschlussfähig. Publisher und Plattformen nutzen sie seit Jahren in Endnutzerlizenzen (EULAs), oft kombiniert mit Sammelklageverzichten. In der Praxis prallen dabei jedoch sehr unterschiedliche Rechtskulturen aufeinander. Während in den USA die verpflichtende Einzel-Schiedsgerichtsbarkeit gegenüber Verbraucherinnen und Verbrauchern etabliert ist, setzt das deutsche und europäische Recht enge Schranken. Parallel hat sich im B2B-Bereich eine eigenständige Vertragskultur entwickelt, in der Schiedsgerichte – richtig gestaltet – handfeste Vorteile bringen: planbare Verfahren, spezialisierte Spruchkörper, flexible Verfahrensgestaltung, Vertraulichkeit, bessere Durchsetzbarkeit über das UN-Übereinkommen von 1958 (New-York-Übereinkommen).
Der Beitrag ordnet die Rechtslage in Deutschland und der EU ein, erläutert die jüngsten Entwicklungen zur Abwahl des AGB-Rechts in Schiedsverfahren, zeigt anhand prominenter EULA-Beispiele, warum Konsumentenschiedsgerichtsbarkeit hierzulande regelmäßig scheitert, und übersetzt diese Erkenntnisse in belastbare Vertragsbausteine für Studios, Co-Development-Partner und Publisher. Ziel ist eine realistische Roadmap: Wo lohnt sich Schiedsgerichtsbarkeit tatsächlich – und wie wird sie so entworfen, dass sie im Games-Alltag trägt.
Rechtsrahmen: Verbraucher, AGB-Kontrolle und Form
Die deutschen Zivilprozessregeln differenzieren klar zwischen B2C und B2B. Der entscheidende Dreh- und Angelpunkt ist § 1031 ZPO. Für Verbraucherverträge verlangt Abs. 5 eine qualifizierte Form: Schiedsvereinbarungen müssen in einer von beiden Parteien eigenhändig unterzeichneten Urkunde enthalten sein. Click-wrap-EULAs, Checkboxen im Launcher oder „I agree“-Buttons genügen diesem Erfordernis nicht. Wer Schiedsgerichtsbarkeit „per Klick“ gegenüber Endnutzern durchsetzen will, scheitert damit in Deutschland regelmäßig bereits an der Form.
Hinzu tritt das AGB-Recht: Klauseln in EULAs unterliegen der Inhaltskontrolle der §§ 305 ff. BGB. Auf europäischer Ebene richtet sich der Maßstab nach der Richtlinie 93/13/EWG über missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen. Deren Anhang nennt exemplarisch als problematisch Klauseln, die die Rechtsverfolgung des Verbrauchers erschweren – wozu insbesondere die Verpflichtung zu Schiedsverfahren zählt, wenn diese die gerichtliche Geltendmachung faktisch vereiteln oder unzumutbar erschweren. Nationale Gerichte haben solche Klauseln streng zu prüfen. In der EU ist die verpflichtende Verbraucher-Schiedsgerichtsbarkeit deshalb nur in engen Grenzen haltbar.
Konsequenz: Eine „US-style“ EULA-Schiedsklausel wird in Deutschland in aller Regel nicht wirksam vereinbart. Wer Endnutzer in der EU an Schiedsgerichte binden möchte, müsste die strenge Schriftform wahren – sprich: eine separat unterschriebene Urkunde einholen. Das ist im Distributionsalltag kaum praktikabel und schon deshalb keine sinnvolle Option für Standard-EULAs.
Aktuelle Rechtsprechung: BGH 2025 zur Abwahl des AGB-Rechts im Schiedsverfahren (B2B)
Während der Verbraucherbereich durch Form und AGB-Kontrolle geprägt ist, hat der Bundesgerichtshof mit Beschluss vom 9. Januar 2025 (I ZB 48/24) eine wichtige Weichenstellung für B2B-Schiedsverfahren vorgenommen: Die Parteien hatten in einem Vertrag deutsches Recht unter Ausschluss des deutschen AGB-Rechts (§§ 305 ff. BGB) für das Schiedsverfahren gewählt. Die Frage, ob eine solche „selektive Rechtswahl“ zulässig ist, hat der BGH nicht selbst abschließend inhaltlich entschieden, aber die Schiedsklausel als solche für wirksam erachtet und betont, dass es Sache des Schiedsgerichts ist, über die Reichweite der Rechtswahl nach § 1051 ZPO zu befinden. Damit ist jedenfalls klar: Die Wirksamkeit der Schiedsklausel hängt nicht daran, ob die begleitende Rechtswahl (deutsches Recht ohne AGB-Recht) später hält. Das erhöht die Rechtssicherheit für B2B-Parteien, die in einem Schiedsverfahren die AGB-Kontrolle bewusst zurückdrängen möchten; staatliche Gerichte greifen erst im Anerkennungs-/Vollstreckungsverfahren über den ordre public ein. (
Die Entscheidung hat unmittelbare Relevanz für Games-typische B2B-Konstellationen: Publishing-, Co-Dev- und Subcontracting-Verträge mit internationalem Bezug können zugeschnittene Schiedsklauseln vorsehen, ohne dass die Klausel schon deshalb ins Wanken gerät, weil im Schiedsverfahren ein enges materielles Regime (z. B. deutsches Recht mit modifizierter AGB-Kontrolle) gelten soll. Ob und inwieweit die AGB-Kontrolle tatsächlich „abgewählt“ werden kann, bleibt dem Schiedsgericht und im Ergebnis dem ordre-public-Vorbehalt vorbehalten; die Schiedsklausel bleibt davon unberührt.
EULAs großer Publisher: gelebte Praxis – und ihre Grenzen in der EU
Ein Blick in prominente EULAs zeigt, wie stark die Rechtskulturen auseinanderlaufen:
- Epic/Fall Guys: Die EULA verweist ausdrücklich auf eine Schiedsvereinbarung und einen Sammelklageverzicht („class action waiver“). Das Konzept zielt klar auf den US-Markt; in der EU/DE fehlt es regelmäßig schon an der qualifizierten Form und an der inhaltlichen Tragfähigkeit.
- Blizzard: Neben der Schiedsklausel findet sich ein 30-Tage-Opt-out-Mechanismus, der Nutzerinnen und Nutzern die Abwahl der Schiedsgerichtsbarkeit erlaubt. Das verbessert die Fairnessbilanz – ändert aber nichts an der deutschen Form- und AGB-Problematik.
- Nintendo: Neuere Fassungen der EULA setzen – aus US-Perspektive – ebenfalls auf verbindliche Einzelschiedsverfahren mit Opt-out-Fenster und Sammelklageverzicht. In der EU wird eine solche Klausel an den genannten Hürden scheitern.
Aus dieser Praxis lassen sich zwei Lehren ziehen. Erstens: Globale EULAs arbeiten bewusst mit regionalen Differenzierungen; US-Klauseln sind für den hiesigen Markt kein Blaupausen-Material. Zweitens: B2C-Schiedsgerichtsbarkeit lässt sich im deutschen Massengeschäft kaum rechtssicher implementieren – und sollte deshalb nicht das Kerninstrument zur Streitbeilegung mit Spielerinnen und Spielern sein.
Was stattdessen in die EULA gehört
Die EULA bleibt gleichwohl ein wichtiger Governance-Baustein. Realistische, EU-taugliche Alternativen zur verpflichtenden Schiedsgerichtsbarkeit sind:
- Mehrstufige Eskalationsklauseln ohne Zwangsschiedsgerichtsbarkeit: informelle Klärung, danach Mediation/Schlichtung, erst dann staatliche Gerichte am vereinbarten Gerichtsstand.
- Transparente Gerichtsstands- und Rechtswahlklauseln unter Beachtung der verbraucherschützenden Kollisionsregeln (insb. Art. 6 Rom-I-VO; nationale zwingende Normen bleiben unberührt).
- Hinweise auf außergerichtliche Streitbeilegung (z. B. Schlichtungsstellen nach VSBG) und die EU-ODR-Plattform, ohne Verbraucher auf ein bestimmtes ADR-Verfahren zu verpflichten.
- Klare, verständliche Sprache ohne Überraschungseffekte – die AGB-Kontrolle prüft auch Transparenz und Zumutbarkeit.
Diese Konstruktion vermeidet die formelle Unwirksamkeit, senkt Reibung mit Verbraucherbehörden und mindert Reputationsrisiken, ohne dass auf geordnete Eskalationspfade verzichtet werden muss.
B2B: Schiedsgerichtsbarkeit als echter Effizienzhebel – wenn präzise gestaltet
Zwischen Studio und Publisher, im Co-Dev-Netzwerk oder gegenüber spezialisierten Subcontractors (Audio, Art, Porting) bietet Schiedsgerichtsbarkeit substantielle Vorteile. Die DIS-Schiedsordnung 2018 ist für deutsche und europäische Konstellationen eine tragfähige Grundlage; sie enthält moderne Verfahrensinstrumente, Konsolidierungs- und Mehrparteien-Optionen, Regeln zur Effizienzsteuerung und Model-Clauses als Formulierungshilfe.
Sitz, Sprache, anwendbares Recht
Die Schiedsklausel sollte Sitz (z. B. Berlin, Köln, München), Sprache (Deutsch/Englisch) und anwendbares Recht klar definieren. Der Sitz steuert Aufhebungs- und Vollstreckungszuständigkeiten; die Sprache beeinflusst Tempo und Kosten; die Rechtswahl legt die materiellen Leitplanken fest. Der BGH-Beschluss 2025 erhöht hier die Gestaltungsfreiheit: Eine selektive Rechtswahl (z. B. deutsches Recht mit modifizierter AGB-Kontrolle) wird nicht schon deshalb die Schiedsklausel zu Fall bringen; ob die materielle Auswahl trägt, prüft das Schiedsgericht – mit Sicherheitsnetz des ordre public.
Mehrstufige Streitlösung
Games-Verträge profitieren von Multi-Tier-Clausen (Verhandlungen → Mediation → Schiedsgericht). Das zwingt die Parteien zu einem strukturierten Vorlauf, bevor die Kostenlawine rollt, und erhält Spielräume in Meilensteinphasen. Die DIS hält Modellklauseln für solche mehrstufigen Verfahren bereit, die sich passgenau auf Entwickler-/Publisher-Verhältnisse übertragen lassen.
Konsolidierung und Mitparteien
Game-Projekte binden häufig mehrere Verträge: Engine-Lizenz, Port-Studio, Art-Pipeline, QA, Lokalisierung, Marketing-Co-Op. Eine Konsolidierungsklausel und Joinder-Regeln vermeiden parallele Verfahren. Wer bereits in der Klausel vorsieht, dass eng zusammenhängende Streitigkeiten in einem Schiedsverfahren verhandelt werden können, spart Zeit, Geld und widersprüchliche Ergebnisse.
Eilrechtsschutz und IP-Carve-outs
Nicht alles gehört zwingend ins Schiedsgericht. Einstweiliger Rechtsschutz bei drohenden IP-Verletzungen oder Leak-Szenarien muss schnell sein. Viele Klauseln kombinieren daher Schiedsgerichtsbarkeit mit einem Carve-out für Eilmaßnahmen vor staatlichen Gerichten („injunctive relief without prejudice to arbitration“). Das sichert Handlungsfähigkeit in der Praxis und vermeidet Stillstand bis zur Konstituierung des Tribunals.
Vertraulichkeit, Dokumentenmanagement, technische Expertise
Games-Streitigkeiten sind technik- und produktionslastig. Vertraulichkeitsklauseln im Schiedsverfahren schützen Build-Pipelines, Tools, Quellcode und interne Roadmaps. Verfahrensregeln zur Dokumentenproduktion (Schutz von Quellcode, Source-Escrow-Einsicht nur über neutrale Gutachter, sichere Datenräume) und Qualifikationsanforderungen an Schiedsrichter (z. B. Software-/IP-Erfahrung) sorgen dafür, dass das Verfahren fachlich auf Augenhöhe geführt wird.
Kostensteuerung
Anders als EULAs im Verbraucherbereich können B2B-Parteien Kostenpfade festlegen: Vorschüsse, Kostentragung „loser pays“, Caps für bestimmte Verfahrensschritte. Das erhöht Kalkulierbarkeit und beugt „procedural gaming“ vor.
Typische Streitfelder im Games-B2B – und was die Klausel dazu sagen sollte
Milestones und Abnahmen. Viele Konflikte drehen sich um Terminschuld, Abnahmekriterien, „Definition of Done“. Eine saubere Verzahnung von Abnahmeregime und Schiedsklausel reduziert Eskalationskosten: kurze Fristen, technische Schiedsgutachter-Option, eng getaktete Verfahrensfenster.
Scope-Creep und Change-Requests. Ohne Änderungsmechanismus wird aus jeder Feature-Diskussion eine Grundsatzfrage. Die Schiedsklausel sollte auf ein Change-Control-Board Bezug nehmen und klarstellen, dass nur formal genehmigte Änderungen „streitfest“ sind.
IP-Ownership und Lizenzketten. Streit um Rechte an Tools, Pipelines oder vorbestehenden Assets lässt sich vermeiden, wenn die Schiedsklausel mit den IP-Regeln harmoniert: Welche Fragen sind dem Tribunal zugewiesen, welche Eilmaßnahmen sind staatlichen Gerichten vorbehalten?
OSS-Compliance. Offene Lizenzen werden schnell zum Stolperstein (Copyleft-Effekte). Ein technischer Appendix zur Beibringung von SBOM/Third-Party-Notices und ein beschleunigtes Verfahren für Compliance-Streitpunkte (z. B. schriftliches Verfahren binnen 60 Tagen) verhindern Release-Verzögerungen.
Revenue-Share und Audit. Bei Publisher-Deals sollten Audit-Rechte (Turnus, Umfang, Prüferqualifikation) und eine Schiedsgutachter-Option für reine Rechenfragen vorgesehen werden – getrennt vom eigentlichen Schiedsverfahren.
Beispiele aus der E-Sports-Praxis
Einige Ökosysteme setzen auf spezialisierte Schieds-/Schlichtungsmechanismen für finanzielle und vertragliche Streitigkeiten zwischen Teams, Spielern und Veranstaltern. Das illustriert, dass maßgeschneiderte, sektorspezifische Verfahren funktionieren – allerdings typischerweise B2B-nah und nicht im klassischen Verbraucher-EULA-Kontext.
Entwurfsskizze für belastbare Schiedsklauseln (B2B)
Die folgenden Gestaltungspunkte haben sich in Games-Verträgen bewährt; sie sind bewusst textnah formuliert, damit sie sich sauber in Werk-, Co-Dev- oder Publishing-Verträge integrieren lassen. Zur institutionellen Anbindung eignet sich die DIS mit ihren Model-Clauses als Referenz.
(1) Geltungsbereich. „Alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag, einschließlich seiner Gültigkeit, werden endgültig nach der Schiedsordnung der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit (DIS) entschieden.“
(2) Sitz und Sprache. „Sitz des Schiedsgerichts ist Berlin. Verfahrenssprache ist Englisch.“
(3) Zusammensetzung. „Das Schiedsgericht besteht aus drei Schiedsrichtern; die Parteien benennen je eine/n, die/der Vorsitzende wird von der DIS bestellt.“
(4) Anwendbares Recht. „Das Schiedsgericht entscheidet nach deutschem Recht.“ – Optional: selektive Rechtswahl, etwa Klarstellung zur Reichweite der AGB-Kontrolle im Schiedsverfahren; die Wirksamkeit beurteilt das Tribunal (unter Beachtung des ordre public).
(5) Multi-Tier. „Vor Einleitung des Schiedsverfahrens ist eine 30-tägige Verhandlungsphase, anschließend ein Mediationsversuch nach DIS-Regeln durchzuführen; nach fruchtlosem Ablauf steht der Weg ins Schiedsverfahren offen.“ (DIS)
(6) Konsolidierung/Joinder. „Das Tribunal kann – auf Antrag – Verfahren mit engem sachlichem Zusammenhang konsolidieren oder Dritte beiziehen, sofern diese der Schiedsvereinbarung unterliegen.“
(7) Eilrechtsschutz/IP-Carve-out. „Unbeschadet der Schiedsvereinbarung bleibt der Gang zu staatlichen Gerichten für einstweilige Maßnahmen zur Sicherung von Rechten aus diesem Vertrag zulässig.“
(8) Vertraulichkeit/Quellcode. „Die Parteien verpflichten sich zur Vertraulichkeit des Verfahrens; Einsicht in Quellcode erfolgt ausschließlich über gerichtlich vereidigte Sachverständige/NDA-gebundene Prüfer in abgesicherten Datenräumen.“
(9) Kosten. „Die Kosten trägt die unterliegende Partei; das Tribunal kann quotal verteilen. Vorschüsse nach DIS-Regeln.“
Diese Skizze ist kein starres Muster, sondern eine Checkliste; die Details hängen vom Gefüge des konkreten Projekts ab.
Was nicht in die EU-EULA gehört – typische Fehlannahmen
„Ein Klick genügt.“ Für Verbraucher*innen stimmt das nicht. § 1031 Abs. 5 ZPO verlangt eine eigenhändig unterzeichnete Urkunde. Ohne diese Form ist die Vereinbarung mit hoher Wahrscheinlichkeit unwirksam.
„US-EULAs zeigen, dass es geht.“ US-EULAs (Epic/Fall Guys, Nintendo, Blizzard) arbeiten mit Opt-out-Fenstern und class-action-Waivern. Diese Mechaniken haben in der EU/DE keine allgemeine Tragfähigkeit. Sie sind für den US-Markt konzipiert und regelmäßig nicht übertragbar.
„Eine Schiedsklausel umgeht das AGB-Recht immer.“ Der BGH hat 2025 klargestellt: Die Schiedsklausel bleibt wirksam, selbst wenn über eine selektive Rechtswahl gestritten wird – doch ob und wie AGB-Kontrolle im Schiedsverfahren verdrängt wird, entscheidet das Tribunal; der ordre public setzt Grenzen. Das ist ein Plus an Gestaltungsfreiheit, kein Freifahrtschein.
Strategische Empfehlungen für Studios und Publisher
EULA/Consumer-Ebene (EU/DE). Realistische, transparente Eskalationspfade ohne Zwangsschiedsgerichtsbarkeit. Hinweise auf freiwillige ADR, klare Gerichtsstände und Rechtswahl unter Beachtung zwingender Normen. Vermeidung komplexer, intransparenter Klausel-Kaskaden.
B2B-Ebene. Frühzeitig auf Schiedsgerichtsbarkeit festlegen, aber nicht „von der Stange“: Passender Sitz, Sprache, institutionelle Regeln (DIS), Multi-Tier-Mechanik, IP-Carve-outs, Konsolidierung und Vertraulichkeitsregeln. Die materielle Rechtswahl (ggf. „deutsches Recht light“) bewusst adressieren – im Wissen, dass das Tribunal und letztlich der ordre public das Korrektiv bilden. (DIS)
Dokumentation und Prozesstauglichkeit. Gerade in Games-Streitigkeiten entscheidet die Aktenlage: definierte Abnahmekriterien, Change-Logs, SBOM/OSS-Inventare, Build-Hashes, Metriken zu Performance und Quality Gates, Audit-Reports zu Revenue-Shares. Wer diese Dokumente im Verfahren unkompliziert nutzbar macht, senkt Beweisrisiken.
Kommunikation & Reputation. Konsumentenrechtliche Auseinandersetzungen werden öffentlich geführt – Foren, Social Media, Fachpresse. Eine EULA, die sichtbar auf Fairness und Transparenz setzt, zahlt auf Vertrauen ein. US-Schiedsklauseln samt Klassenverzicht erzeugen in EU-Communities unnötige Reibung.
Häufige Praxisfragen – kurz eingeordnet
Gilt eine EULA-Schiedsklausel wenigstens gegenüber „Power-Usern“ (Creators, Streamern)? Maßgeblich ist die Verbrauchereigenschaft im konkreten Kontext. Auch Influencer sind beim Spielen typischerweise Verbraucher; nur wenn der Vertrag klar beruflich/gewerblich geschlossen wird, greifen die B2B-Spielregeln.
Kann man die Schriftform digital lösen (qualifizierte E-Signatur)? § 1031 Abs. 5 ZPO spricht von „eigenhändig unterzeichnet“. In der Praxis wird die handschriftliche Unterzeichnung verlangt; eine qualifizierte elektronische Signatur könnte diskutiert werden, ist aber nicht Marktpraxis und birgt Risiken – insbesondere bei Massendistribution.
Ist Mediation Pflicht? Nein. Aber Mediation als verpflichtende Vorstufe spart Kosten und erhält Geschäftsbeziehungen – in Meilenstein-Phasen oft wertvoller als „schnell klagen“.
Wie sichert man Eilrechtsschutz? Durch Carve-outs: einstweilige Maßnahmen bleiben den staatlichen Gerichten vorbehalten, das Hauptsacheverfahren läuft im Schiedsforum.
Wie sieht es mit Drittfinanzierung aus? In größeren B2B-Streitigkeiten ist Third-Party-Funding üblich; die Klausel kann Offenlegungs- und Interessenkonfliktregeln vorsehen.
Fazit
Für – was wirklich funktioniert (und was nicht) – was wirklich funktioniert (und was nicht) Wirksamkeit der Schiedsklausel von Streitfragen zur materiellen Rechtswahl und eröffnet damit Spielräume, Schiedsverfahren gezielt als effizientes Forum zu verankern. Mit DIS-Model-Clauses, sauberer Sitz-/Sprach-/Rechtswahl, Multi-Tier-Mechanik, IP-Carve-outs, Konsolidierungs- und Vertraulichkeitsregeln entsteht ein maßgeschneidertes Streitbeilegungssystem, das zur Games-Produktion passt: schnell, fachnah, international vollstreckbar – und zugleich kompatibel mit den Grenzen des europäischen Verbraucherrechts. (DIS)