Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
EuGH: Framing von Inhalten kann Urheberrechtsverletzung sein!
Der EuGH macht beim Framing eine Rolle rückwärts in seiner Rechtsauffassung. Mehr zu dem Thema und der Rolle des BGH...
Mehr lesenDetails
Fast jedes Startup arbeitet mit Freelancern. Entwickler, Designer, Texter, Videoproduzenten, Marketingagenturen – ohne externe Dienstleister wäre ein Großteil der heutigen Startup-Landschaft nicht handlungsfähig. Gleichzeitig gehört kaum ein Themenkomplex zu den häufigsten und teuersten Fehlern in der Frühphase wie die Annahme, dass mit der Zahlung auch automatisch die Rechte am Ergebnis übergehen.
Die Realität ist ernüchternd: Verträge werden schnell zusammengeklickt, aus früheren Projekten kopiert oder als „Standardvertrag“ aus dem Internet übernommen. Hauptsache, jemand fängt an zu arbeiten. Die rechtliche Absicherung wird vertagt, weil sie nicht „dringend“ erscheint. Spätestens beim nächsten Investorengespräch, beim Relaunch, bei der Internationalisierung oder beim Exit stellt sich dann heraus: Die Rechte an zentralen Assets liegen gar nicht beim Startup.
Was dann folgt, ist kein theoretisches Rechtsproblem, sondern ein handfester wirtschaftlicher Schaden. Nachlizenzierungen, Abhängigkeiten von einzelnen Freelancern, Blockaden bei Investoren oder sogar vollständige Neuentwicklungen sind keine Ausnahme, sondern Alltag. Besonders brisant wird es, wenn KI-Tools, Subunternehmer oder Agenturen beteiligt waren und niemand mehr genau sagen kann, wer eigentlich welche Rechte eingeräumt hat.
Dieser Beitrag erklärt, warum dieses Problem so häufig auftritt, warum Zahlung eben nicht Rechte bedeutet, welche rechtlichen Grundsätze greifen und wie sich diese Risiken vertraglich sauber vermeiden lassen.
Die Fehlannahme ist einfach und menschlich nachvollziehbar: Wer etwas bezahlt, geht davon aus, es auch „zu besitzen“. Im klassischen Kaufrecht mag diese Logik aufgehen. Im Urheberrecht gilt sie gerade nicht. Werke entstehen beim Schöpfer, nicht beim Auftraggeber. Und das Urheberrecht folgt eigenen Regeln, die mit Alltagserwartungen wenig zu tun haben.
Freelancer und Agenturen schaffen in aller Regel urheberrechtlich geschützte Werke: Softwarecode, Designs, Texte, Videos, Musik, Konzepte. Das Urheberrecht entsteht automatisch beim jeweiligen Urheber, also bei der Person, die das Werk geschaffen hat. Eine Rechnung, eine Zahlung oder ein Projektabschluss ändern daran nichts.
Was übertragen werden kann, sind Nutzungsrechte. Diese müssen entweder ausdrücklich vereinbart oder zumindest eindeutig aus dem Vertragszweck ableitbar sein. Genau hier liegt das Problem vieler Startup-Verträge: Sie regeln das operative „Was“, aber nicht das rechtliche „Wem gehört was – und wofür“.
Hinzu kommt Zeitdruck. In der Frühphase zählt Geschwindigkeit. Verträge werden „pragmatisch“ gehalten, oft bewusst kurz. Man kennt sich, vertraut sich, will keine Hürden aufbauen. Dass gerade diese Phase später rechtlich aufgearbeitet wird, wird verdrängt. Bis es zu spät ist.
Das deutsche Urheberrecht kennt kein automatisches „Buy-out“ durch Bezahlung. Zentral ist § 31 UrhG, der die Einräumung von Nutzungsrechten regelt. Danach erhält der Auftraggeber nur die Rechte, die ausdrücklich vereinbart wurden oder die sich zwingend aus dem Vertragszweck ergeben.
Diese sogenannte Zweckübertragungslehre ist einer der größten Stolpersteine für Startups. Sie bedeutet vereinfacht: Im Zweifel erhält der Auftraggeber nur so viele Rechte, wie er benötigt, um den konkret vereinbarten Zweck zu erfüllen – nicht mehr.
Ein Beispiel aus der Praxis: Ein Freelancer entwickelt eine Website für ein Startup. Der Zweck ist klar: eine Website betreiben. Daraus folgt regelmäßig ein Nutzungsrecht zur Nutzung dieser Website. Nicht zwingend folgt daraus aber das Recht, das Design später für andere Produkte zu verwenden, es international auszurollen, es an Investoren zu lizenzieren oder es vollständig zu verändern. All das müsste ausdrücklich geregelt werden.
Noch problematischer wird es bei Software. Wer Code entwickeln lässt, erhält ohne klare Regelung oft nur ein Nutzungsrecht für den konkreten Einsatz. Das Recht zur Weiterentwicklung, zur Nutzung in anderen Projekten, zur Lizenzierung oder zum Verkauf kann fehlen oder eingeschränkt sein. Spätestens bei Due-Diligence-Prüfungen fällt das auf.
Die Zweckübertragungslehre ist kein theoretisches Konstrukt, sondern gelebte Rechtsprechung. Sie greift immer dann, wenn Verträge unklar oder lückenhaft sind. Und genau das ist bei „schnell hingeschriebenen“ Freelancer-Verträgen regelmäßig der Fall.
Viele Verträge enthalten Sätze wie „Der Auftragnehmer überträgt alle Rechte an den Auftraggeber“ oder „Die Rechte gehen vollständig auf den Auftraggeber über“. Gründer fühlen sich damit sicher. Juristisch ist das oft eine trügerische Sicherheit.
Zum einen müssen Buy-out-Regelungen konkret sein. „Alle Rechte“ ist keine juristisch belastbare Beschreibung, wenn nicht klar ist, welche Nutzungsarten, welche Territorien, welche Zeiträume und welche Verwertungsformen gemeint sind. Zum anderen können bestimmte Rechte gar nicht pauschal übertragen werden oder unterliegen besonderen Einschränkungen.
Hinzu kommt ein weiterer Praxisfehler: Selbst wenn der Freelancer umfassend Rechte überträgt, heißt das noch lange nicht, dass er diese Rechte überhaupt innehatte. Viele Freelancer arbeiten mit Stockmaterial, Open-Source-Komponenten, Templates oder – zunehmend – mit KI-Tools. Die Rechte an diesen Vorleistungen können nicht einfach weitergegeben werden, wenn sie beim Freelancer selbst nur eingeschränkt vorliegen.
Die Buy-out-Illusion zeigt sich besonders drastisch bei Agenturleistungen. Agenturen treten häufig als „Single Point of Contact“ auf, arbeiten aber mit Subunternehmern. Wenn die Rechtekette nicht sauber bis zum letzten Urheber durchgezogen ist, nützt die schönste Buy-out-Klausel nichts. Das Startup glaubt, alles zu besitzen – tatsächlich besitzt es nur ein Kartenhaus.
Viele Startups bemerken das Rechteproblem nicht sofort. Die Assets werden genutzt, weiterentwickelt, vermarktet. Erst Jahre später – oft bei einer Finanzierungsrunde oder beim Exit – wird genauer hingeschaut. Dann kommt die Frage: „Habt ihr die Rechte an allem, was ihr nutzt?“
Wenn die Antwort darauf nicht eindeutig mit Ja beantwortet werden kann, beginnt die Nachlizenzierung. Das ist der Moment, in dem das Machtgefälle kippt. Der ehemalige Freelancer weiß plötzlich, dass das Startup von seinen Rechten abhängig ist. Die Verhandlungsposition ist entsprechend schlecht.
Nachlizenzierungen sind selten günstig. Sie erfolgen unter Zeitdruck, oft unter Androhung von Unterlassung oder Sperrung. Investoren reagieren empfindlich, wenn IP-Risiken auftauchen. Nicht selten wird der Kaufpreis gedrückt oder ein Deal scheitert vollständig.
Besonders bitter ist, dass diese Kosten in keinem Verhältnis zu dem stehen, was eine saubere Vertragsgestaltung zu Beginn gekostet hätte. Was am Anfang als „Overlawyering“ erschien, entpuppt sich später als minimale Prävention.
Die Situation verschärft sich durch den zunehmenden Einsatz von KI-Tools. Freelancer und Agenturen nutzen KI zur Code-Generierung, zur Erstellung von Texten, Designs oder Musik. Für Startups ist oft nicht transparent, welche Tools eingesetzt wurden und unter welchen Bedingungen.
Viele KI-Tools räumen dem Nutzer zwar Nutzungsrechte ein, behalten sich aber eigene Rechte vor oder schließen bestimmte Verwertungsformen aus. Teilweise ist unklar, ob die erzeugten Inhalte überhaupt exklusiv sind. Wenn solche Inhalte ungeprüft in Produkte integriert werden, entstehen neue Rechte- und Haftungsrisiken.
Hinzu kommt ein weiterer Aspekt: Missbrauch. Es gibt immer wieder Fälle, in denen Dienstleister Inhalte mehrfach verwerten, Kundenmaterial für eigene Zwecke nutzen oder KI-Modelle mit fremden Daten trainieren. Ohne klare vertragliche Regelungen sind diese Praktiken schwer angreifbar.
Gerade bei Agenturen mit vielen parallelen Projekten verschwimmen Grenzen. Was als Effizienz gedacht war, wird rechtlich problematisch. Startups merken das meist erst, wenn ein Wettbewerber mit auffällig ähnlichen Inhalten auftaucht oder Plattformen Fragen stellen.
Saubere Freelancer- und Agenturverträge sind kein Selbstzweck. Sie sind die Grundlage dafür, dass ein Startup überhaupt skalieren kann. Sie schaffen Klarheit darüber, was genutzt, verändert, verkauft oder lizenziert werden darf. Sie schützen nicht nur vor Streit, sondern vor struktureller Abhängigkeit.
Dabei geht es nicht um endlose Vertragswerke, sondern um die richtigen Punkte an der richtigen Stelle. Nutzungsrechte müssen klar beschrieben sein. Rechteketten müssen geschlossen werden. Der Einsatz von Subunternehmern und KI-Tools muss geregelt sein. Und es muss klar sein, was mit den Ergebnissen passiert, wenn die Zusammenarbeit endet.
Verträge, die „mal schnell hingerotzt“ werden, rächen sich fast immer. Nicht sofort, aber zuverlässig. Wer sich hier frühzeitig professionelle Unterstützung holt, spart sich später nicht nur Geld, sondern vor allem Zeit, Nerven und strategische Optionen.
Für Startups sind IP-Rechte kein juristisches Detail, sondern Unternehmenssubstanz. Wer nicht weiß, wem die eigenen Produkte, Designs oder Codes gehören, besitzt im Zweifel weniger als gedacht. Zahlung ersetzt keine Rechteübertragung. Vertrauen ersetzt keinen Vertrag.
Der typische Startup-Fehler besteht nicht darin, mit Freelancern zu arbeiten, sondern darin, deren Arbeit rechtlich falsch einzuordnen. Wer diesen Fehler früh erkennt und korrigiert, verschafft sich einen echten Vorteil. Wer ihn ignoriert, zahlt später fast immer drauf.
Marian Härtel ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für IT-Recht mit einer über 25-jährigen Erfahrung als Unternehmer und Berater in den Bereichen Games, E-Sport, Blockchain, SaaS und Künstliche Intelligenz. Seine Beratungsschwerpunkte umfassen neben dem IT-Recht insbesondere das Urheberrecht, Medienrecht sowie Wettbewerbsrecht. Er betreut schwerpunktmäßig Start-ups, Agenturen und Influencer, die er in strategischen Fragen, komplexen Vertragsangelegenheiten sowie bei Investitionsprojekten begleitet. Dabei zeichnet sich seine Beratung durch einen interdisziplinären Ansatz aus, der juristische Expertise und langjährige unternehmerische Erfahrung miteinander verbindet. Ziel seiner Tätigkeit ist stets, Mandanten praxisorientierte Lösungen anzubieten und rechtlich fundierte Unterstützung bei der Umsetzung innovativer Geschäftsmodelle zu gewährleisten.
Der EuGH macht beim Framing eine Rolle rückwärts in seiner Rechtsauffassung. Mehr zu dem Thema und der Rolle des BGH...
Mehr lesenDetailsDie Überschrift für diesen Blogpost klingt ein wenig nach Klick-Falle, oder? Es verbirgt sich dahinter aber ein lustiges Gerichtsverfahren, das...
Mehr lesenDetailsStartup-Accelerator-Programme haben sich als wertvolle Sprungbretter für junge Unternehmen etabliert. Sie bieten nicht nur finanzielle Unterstützung, sondern auch Mentoring, Netzwerke...
Mehr lesenDetailsGrüne Startups in Deutschland stehen vor einer Vielzahl von rechtlichen Herausforderungen, insbesondere wenn es um die Gestaltung von Verträgen geht....
Mehr lesenDetailsAgenturen, Freelancer, externe Entwicklerstudios und Content-Dienstleister sind für viele Unternehmen längst Teil der Wertschöpfungskette. Das gilt für Konzernstrukturen ebenso wie...
Mehr lesenDetailsBurnout Influencer, Social-Media-Stress, Creator Stress – klingt nach Schlagworten aus der Klatschpresse, oder? Doch als Rechtsanwalt im Influencer-Recht erlebe ich...
Mehr lesenDetailsDas Landgericht München hat in einem aktuellen Urteil Flixbus untersagt für die Nutzung von "PayPal" und "Sofortüberweisung" gesonderte Gebühren zu...
Mehr lesenDetailsDas digitale Marketing bietet Startups vielfältige Möglichkeiten, ihre Produkte und Dienstleistungen zu bewerben und ihre Zielgruppen effektiv zu erreichen. Allerdings...
Mehr lesenDetailsEin Businessplan ist ein unverzichtbares strategisches Dokument für Startups und Unternehmensgründer. Er dient als Fahrplan für die Geschäftsentwicklung und als...
Mehr lesenDetailsAuf itmedialaw.com geht es regelmäßig um die rechtliche und praktische Realität digitaler Kommunikation: Reichweite, Plattformlogik, Streit um Aussagen, Screenshots, Kontexte...
Mehr lesenDetails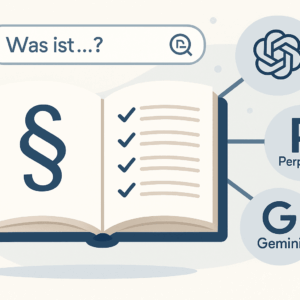 Von der Kanzlei zur KI-Quelle – LLM-SEO für Rechtsanwälte
9,99 €
Von der Kanzlei zur KI-Quelle – LLM-SEO für Rechtsanwälte
9,99 €inkl. MwSt.
 Videoberatung via Microsoft Teams 60 Minuten – Flexibel, unkompliziert und individuell
327,25 €
Videoberatung via Microsoft Teams 60 Minuten – Flexibel, unkompliziert und individuell
327,25 €inkl. MwSt.
 Kanzlei-Power-Bundle 2025: KI-Kompetenz & Sofort-Produktivität für Rechtsanwält:innen
99,99 €
Kanzlei-Power-Bundle 2025: KI-Kompetenz & Sofort-Produktivität für Rechtsanwält:innen
99,99 €inkl. MwSt.
 120 Minuten: Videoberatung via Microsoft Teams 120 Minuten – Ausführlich, vertieft und individuell
535,50 €
120 Minuten: Videoberatung via Microsoft Teams 120 Minuten – Ausführlich, vertieft und individuell
535,50 €inkl. MwSt.
 Leseprobe: KI effizient in der Kanzlei nutzen
0,00 €
Leseprobe: KI effizient in der Kanzlei nutzen
0,00 €inkl. MwSt.
In dieser spannenden Podcast-Episode tauchen wir ein in die faszinierende Welt der IT-Startups und erfahren, warum ein erfahrener Rechtsanwalt für...
Mehr lesenDetailsIn diesem Video rede ich ein wenig über transparente Abrechnung und wie ich kommuniziere, was es kostet, wenn man mit...
Mehr lesenDetails

















