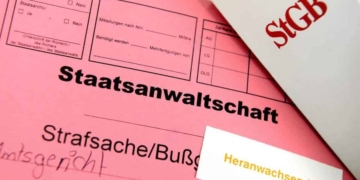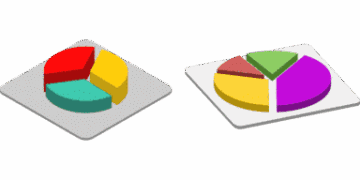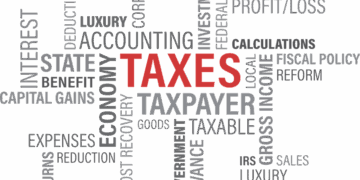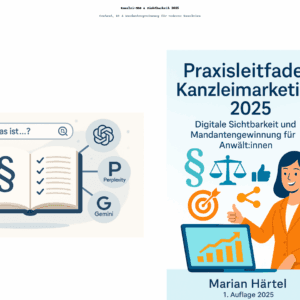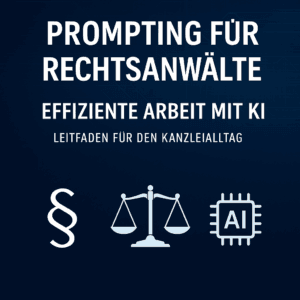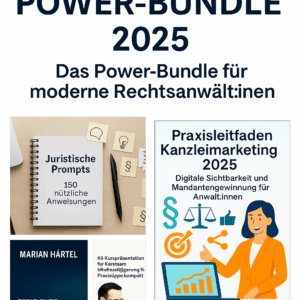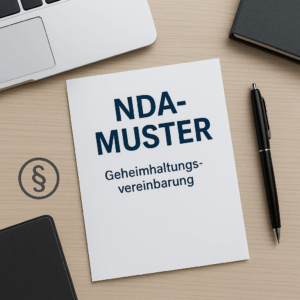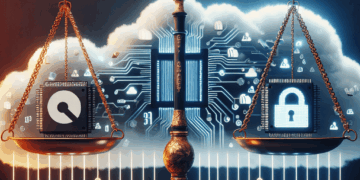Das Oberlandesgericht Frankfurt hat in einem kürzlich ergangenen Beschluss entschieden, dass ein Unternehmen nicht für wettbewerbswidrige Handlungen Dritter haftet, selbst wenn diese Handlungen dem Unternehmen dienlich sind.
Eine Haftung komme nur in Betracht, wenn es die konkreten streitgegenständlichen Veröffentlichungen selbst veranlasst habe oder wenn eine zurechenbare Verkehrssicherungspflicht vorliegen würde. Die Tatsache alleine, dass die das profitierende Unternehmen Kenntnis von den Handlungen Dritter gehabt hatte, könne die Verletzung einer Verkehrspflicht jedoch nicht begründen.
Das Gericht widerspricht damit der Auffassung des Landgericht Hamburg aus dem Jahr 2017, das damals entschied, die unternehmerische Sorgfalt im Sinne von § 3 II UWG würde eine Handlungspflicht bei offensichtlich fehlerhaften und irreführenden Äußerungen Dritter auslösen.
Auch eine bekannt gewordene Entscheidung des Oberlandesgericht Karlsruhe sah das Oberlandesgericht Frankfurt nicht als einschlägig an, denn die Störerhaftung lag dort darin begründet, dass die dortige Beklagte auf ihrer Internetseite etwas bereitgestellt hatte, das das Suchergebnis der Suchmaschinen beeinflusste, mithin eine eigene Handlung streitgegenständlich war.
Zudem ist die dort zugrunde gelegte Störerhaftung durch den BGH im Bereich des Unlauterkeitsrechts durch die Entscheidung „Geschäftsführerhaftung“ aufgegeben worden. Für Fälle des sogenannten Verhaltensunrechts, um die es bei Wettbewerbsverstößen geht und in denen keine Verletzung eines absoluten Rechts in Rede steht, kann die Passivlegitimation vielmehr allein nach den deliktsrechtlichen Kategorien der Täterschaft und Teilnahme begründet werden, so dass in vergleichbaren Konstellationen, soweit keine „eigenhändige“ Tatbegehung oder – beteiligung vorliegt, nur die Verletzung einer Verkehrspflicht haftungsbegründend wirken kann. Dies ist natürlich davon abzugrenzen, wenn man sich für die eigenen Handlungen nur eines dritten Unternehmens bedient hat (siehe dazu z.B. diesen Beitrag).
Die Entscheidung zeigt, dass im Unlauterkeitsrecht, insbesondere in Fällen der unlauteren Werbung und in Bezug auf Handlungen Dritter im Internet, die genaue Tathandlungen betrachtet und bewertet werden müssen.