BGH zu Verbraucherinformationen auf Werbemitteln
Die fast unzähligen Verbraucherschutznormen setzen oft voraus, dass die Verbraucherhinweise direkt auf den Werbemittel angebracht sind, allen voran unter anderem...
Mehr lesenDetailsPrivate Accounts bei ChatGPT & Co. für Unternehmenszwecke sind ein Einfallstor für Datenschutzverstöße, Geheimnisabfluss und arbeitsrechtliche Konflikte; wer KI im Betrieb nutzen will, braucht klare Verbote oder ein sauber aufgesetztes „Secure Enablement“ mit Technik-, Vertrags- und Verhaltensregeln.
Viele Teams arbeiten längst mit KI-Assistenten. Häufig nicht über Unternehmenslizenzen, sondern mit privaten Accounts. Genau hier beginnen die haftungsträchtigen Themen:
a) Kontrollverlust über Daten
Was einmal in ein Prompt eingegeben wurde, ist – je nach Anbieter – nicht mehr vollständig kontrollierbar. Ohne vertraglich gesicherten Opt-out gegen Trainingszwecke oder klare Löschfristen lässt sich weder der Grundsatz der Zweckbindung (Art. 5 Abs. 1 lit. b DSGVO) noch die Speicherbegrenzung (Art. 5 Abs. 1 lit. e DSGVO) zuverlässig nachweisen. Accountability nach Art. 5 Abs. 2 DSGVO scheitert praktisch, wenn Eingaben über Privatkonten laufen, für die es keine Logs, keine Richtlinienbindung und keine Auftragsverarbeitungsverträge gibt (Art. 28 DSGVO). (EUR-Lex)
b) Rechtswidrige internationale Datentransfers
Viele KI-Anbieter verarbeiten Daten außerhalb der EU. Ohne verlässliche Transfergrundlage nach Art. 44 ff. DSGVO drohen Bußgelder. Zwar existiert mit dem EU-US Data Privacy Framework eine (wieder) tragfähige Angemessenheitsentscheidung, sie greift jedoch nur für zertifizierte US-Unternehmen – und nur bei korrekter Einbindung. Private Nutzung umgeht jede Transfer-Due-Diligence des Unternehmens.
c) Geschäftsgeheimnisse in der Unsicherheitsschleuse
Geschäftsgeheimnisse sind nur geschützt, wenn „angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen“ getroffen wurden (§ 2 Nr. 1 b GeschGehG). Das Dulden privater KI-Kanäle konterkariert genau diese Maßnahmen: Es existiert kein vertraglich gesicherter Vertraulichkeitsstandard, keine technische Zugriffskontrolle und keine Auditspur. Im Streitfall fällt der Schutz weg – mit erheblichen Folgeansprüchen.
d) Arbeits- und betriebsverfassungsrechtliche Stolperfallen
Sobald die Nutzung von KI-Tools gesteuert, überwacht oder ausgewertet wird, ist i. d. R. der Betriebsrat im Boot: § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG (technische Einrichtungen zur Verhaltens-/Leistungsüberwachung) zieht hier regelmäßig eine Mitbestimmungspflicht – unabhängig von der Absicht, weil schon die objektive Eignung zur Überwachung genügt.
e) Haftung für fehlerhafte Inhalte und Rechteketten
Halluzinierte Fakten, Lizenz-Unklarheiten bei generiertem Code oder Bildern und unautorisierte Nutzung vertraulicher Informationen können vertragliche und deliktische Haftungstatbestände auslösen. Ohne Freigabeprozesse und Quellen-Dokumentation ist eine sorgfältige Werk-/Dienstleistungserbringung schwer belegbar.
Zwischenfazit: Private KI-Accounts sind organisatorisch bequem, rechtlich aber ein „Blindflug“: Niemand weiß, welche Daten wohin wandern, wer darauf zugreift, wie lange sie gespeichert werden – und ob der Einsatz mit der DSGVO, dem GeschGehG oder der eigenen Geheimhaltungsarchitektur kompatibel ist.
a) DSGVO-Pflichten des Verantwortlichen
b) Beschäftigtendatenschutz
Für Beschäftigtendaten gelten spezifische Anforderungen. § 26 BDSG wird nach dem EuGH-Urteil C-34/21 teils enger interpretiert; häufig ist auf die allgemeinen DSGVO-Rechtsgrundlagen auszuweichen. Für private KI-Nutzung bedeutet das: Einwilligungen sind im Arbeitsverhältnis nur eingeschränkt freiwillig; legitimes Interesse (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO) bedarf sorgfältiger Abwägung und technischer Schutzmaßnahmen.
c) Geschäftsgeheimnisse
Schutz nach GeschGehG setzt proaktive Maßnahmen voraus: Policies, Schulungen, Zugangsbeschränkungen, technische Barrieren. Private KI-Kanäle hebeln diese Elemente aus. Wer private Nutzung duldet, schwächt die eigene Anspruchsposition erheblich (§§ 2, 3 GeschGehG; bei vorsätzlichen Verstößen drohen strafrechtliche Folgen, § 23 GeschGehG).
d) Mitbestimmung nach BetrVG
Die Einführung und Anwendung von KI-Tools, Logging, Proxy-Sperren oder DLP-Regeln ist typischerweise mitbestimmungspflichtig (§ 87 Abs. 1 Nr. 1, 6 BetrVG). Ohne Betriebsvereinbarung sind sowohl Verbote als auch „Erlaubnis mit Auflagen“ angreifbar.
e) EU-AI-Act (Ausblick)
Der AI Act regelt Pflichten von Anbietern, Inverkehrbringern und Nutzern („Deployern“) risikobehafteter KI. Erste Verbote gelten seit Februar 2025; Verpflichtungen für General-Purpose-AI und weitere Stufen greifen stufenweise ab August 2025/2026. Für Unternehmen heißt das: Prozesse zur Modell-Kennzeichnung, Risikobewertung, Logging und Incident-Handling werden Standard – improvisierte Privatnutzung passt nicht in dieses Compliance-Raster.
Praxisanker: Die EDPB-ChatGPT-Taskforce betont Transparenz, Rechtsgrundlagen, Datenrichtigkeit und Minimierung – genau die Felder, die bei privater Nutzung strukturell unterlaufen werden.
Szenario 1: „Nur mal schnell prüfen lassen“
Ein Account Manager kopiert Kundendaten in einen Prompt, um einen Tonalitäts-Check zu erhalten. Problem: Personenbezug, ggf. besondere Kategorien, keine AV-Grundlage, unbekannte Transferpfade. Ergebnis: Verstoß gegen Art. 5, 6, 28, 32 DSGVO; Geheimnisschutz gefährdet.
Szenario 2: Pitch-Konzept mit vertraulichen Zahlen
Eine Kreativdirektion validiert Preisblätter, Marge und Produktroadmap über den privaten KI-Account. Diese Informationen sind regelmäßig Geschäftsgeheimnisse. Ohne angemessene Maßnahmen (§ 2 Nr. 1 b GeschGehG) entfällt der Schutz – das Unternehmen sägt an den eigenen Ansprüchen.
Szenario 3: Code-Snippets und Git-Links
Ein Entwickler lässt sich via Privat-Tool Code erklären und hängt zur Kontextualisierung Git-Links an. Neben möglichen Lizenz-/Urheberrisiken kann schon der Link Geheimnisse offenbaren (Repo-Struktur, Branch-Namen, Tickets). Je nach Anbieter gelangen Meta-/Zugriffsdaten in Drittländer.
Szenario 4: HR-Texte mit Beschäftigtendaten
HR generiert Arbeitszeugnisse via Privataccount, speist dabei interne Leistungsdaten ein. Beschäftigtendaten unterliegen strengen Regeln; Einwilligungen im Arbeitsverhältnis sind problematisch, erst recht, wenn nicht klar ist, wo die Daten landen.
Szenario 5: Monitoring „aus Versehen“
Die IT versucht, Privatnutzung zu unterbinden, aktiviert aber ohne BV ein Proxy-Logging, das Eingaben mitschneidet. Das ist eine technische Einrichtung i. S. d. § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG – ohne Mitbestimmung heikel.
Szenario 6: Falschaussagen im Kundenprojekt
Ein privat genutztes KI-Tool halluziniert fachliche Inhalte. Ohne dokumentierte Quellen-/Review-Pflicht und ohne Versionierung lässt sich Sorgfalt nicht belegen; vertragliche Haftungsrisiken eskalieren.
Es gibt zwei belastbare Wege: (A) klares Verbot mit technischer Durchsetzung oder (B) „Secure Enablement“ über freigegebene Unternehmens-Konten. Mischformen erzeugen Reibung.
Ziele: Schutz von personenbezogenen Daten, Wahrung von Geschäftsgeheimnissen, Einhaltung von Mitbestimmung und Vertragsketten.
Bausteine:
Pro & Contra: Ein Verbot ist rechtssicher und schnell kommunizierbar, aber innovations- und effizienzhemmend.
Ziele: Produktivitätsgewinne nutzen, ohne Datenschutz- und Geheimnisschutz zu opfern.
Bausteine (Mindeststandard):
Pro & Contra: Hohe Sicherheit bei gleichzeitiger Nutzbarkeit, aber Einführungsaufwand (Technik, Verträge, BV).
Hinweis: Formulierungen sind als praxisnahe Bausteine gedacht und müssen an Unternehmensgröße, Branche, Betriebsratssituation und bestehende Policies angepasst werden.
Auftragsverarbeitung (Art. 28 DSGVO) – Mindestpunkte gegenüber dem KI-Anbieter:
Tipp: Viele KI-Enterprise-Angebote bieten Training-Opt-out, Datenresidenz und Zero-Retention-Modi. Ohne diese Optionen kein Einsatz für vertrauliche Daten.
Wer private KI-Nutzung für Unternehmenszwecke zulässt, entfacht ein Bündel an Rechts- und Sicherheitsrisiken: fehlende AV-Verträge, unklare Drittlandtransfers, Verlust des Geheimnisschutzes, betriebsverfassungsrechtliche Konflikte und mangelnde Nachweisbarkeit von Sorgfalt. Zwei Wege sind belastbar: konsequentes Verbot (mit Technik- und Schulungsunterstützung) oder ein kontrolliertes Enablement über Unternehmenslizenzen, saubere Verträge, TOMs, Betriebsvereinbarung und klare Use-Case-Grenzen. In beiden Modellen gilt: Datenschutzprinzipien operationalisieren, Geheimnisschutz aktiv gestalten und AI-Act-Readiness mitdenken – dann bleibt Produktivität ohne Compliance-Kollateralschäden möglich.
Marian Härtel ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für IT-Recht mit einer über 25-jährigen Erfahrung als Unternehmer und Berater in den Bereichen Games, E-Sport, Blockchain, SaaS und Künstliche Intelligenz. Seine Beratungsschwerpunkte umfassen neben dem IT-Recht insbesondere das Urheberrecht, Medienrecht sowie Wettbewerbsrecht. Er betreut schwerpunktmäßig Start-ups, Agenturen und Influencer, die er in strategischen Fragen, komplexen Vertragsangelegenheiten sowie bei Investitionsprojekten begleitet. Dabei zeichnet sich seine Beratung durch einen interdisziplinären Ansatz aus, der juristische Expertise und langjährige unternehmerische Erfahrung miteinander verbindet. Ziel seiner Tätigkeit ist stets, Mandanten praxisorientierte Lösungen anzubieten und rechtlich fundierte Unterstützung bei der Umsetzung innovativer Geschäftsmodelle zu gewährleisten.
Die fast unzähligen Verbraucherschutznormen setzen oft voraus, dass die Verbraucherhinweise direkt auf den Werbemittel angebracht sind, allen voran unter anderem...
Mehr lesenDetailsViele Onlinehändler scheinen immer noch nicht beachtet zu haben, dass am 1. Oktober 2019, also in nicht einmal 2 Wochen...
Mehr lesenDetailsService Level Agreements (SLAs) sind für SaaS-Startups ein zentrales Instrument, um Kunden klare Leistungsvorgaben zu geben und gleichzeitig die eigene...
Mehr lesenDetailsGerade von meinen Influencer-Mandanten oder Streamern, die auf Twitch, YouTube oder ähnlichen Social Media Plattformen tätig sind, bekomme ich immer...
Mehr lesenDetailsPassend zu diesem Artikel seien auch noch ein paar Information zu Kleinunternehmern nach § 19 I UStG verloren, die Waren...
Mehr lesenDetailsDie Blockchain-Technologie und Smart Contracts haben das Potenzial, zahlreiche Branchen zu revolutionieren und neue Geschäftsmodelle zu ermöglichen. Für innovative Unternehmen...
Mehr lesenDetailsIch liebe es einfach mit KI rumzuspielen!
Mehr lesenDetailsObwohl das Konzept der Abmahnung, entgegen oftmals geäußerter Ansicht vieler Nichtjuristen, im Grundzug ein sehr gutes und cleveres System in...
Mehr lesenDetailsEinleitung Heute ist hier auf dem Blog der Tag der Rechtsfragen rund um das Impressum. Daher eine heute eine kurze...
Mehr lesenDetailsMods add new content to video games, improve graphics or add completely new ways of playing. Hardly any major PC...
Mehr lesenDetails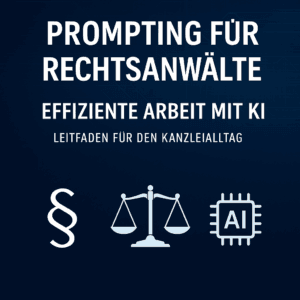 Effiziente Arbeit mit KI in Kanzleien – Praxiswissen für die tägliche Mandatsarbeit
Effiziente Arbeit mit KI in Kanzleien – Praxiswissen für die tägliche Mandatsarbeit
inkl. MwSt.
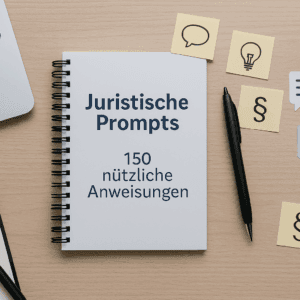 Juristische Prompts - 150 nützliche Anweisungen für jedes LLM
5,99 €
Juristische Prompts - 150 nützliche Anweisungen für jedes LLM
5,99 €
inkl. MwSt.
 Videoberatung via Microsoft Teams 30 Minuten – Schnell, unkompliziert und fokussiert
163,63 €
Videoberatung via Microsoft Teams 30 Minuten – Schnell, unkompliziert und fokussiert
163,63 €
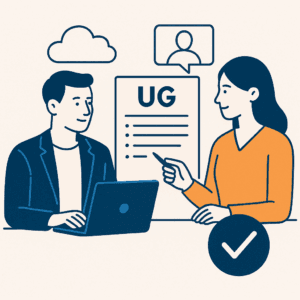 Mustersatzung für eine UG (haftungsbeschränkt)
0,00 €
Mustersatzung für eine UG (haftungsbeschränkt)
0,00 €
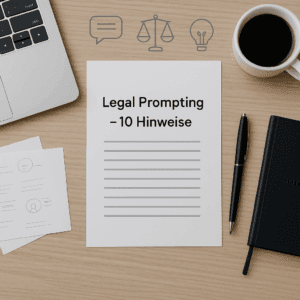 1 Pager „10 wichtigste Hinweise zum Legal Prompting
0,00 €
1 Pager „10 wichtigste Hinweise zum Legal Prompting
0,00 €
In this exciting episode of our podcast, we take a deep dive into the world of innovative business models. Our...
Mehr lesenDetailsIn this video, I talk a bit about transparent billing and how I communicate what it costs to work with...
Mehr lesenDetails