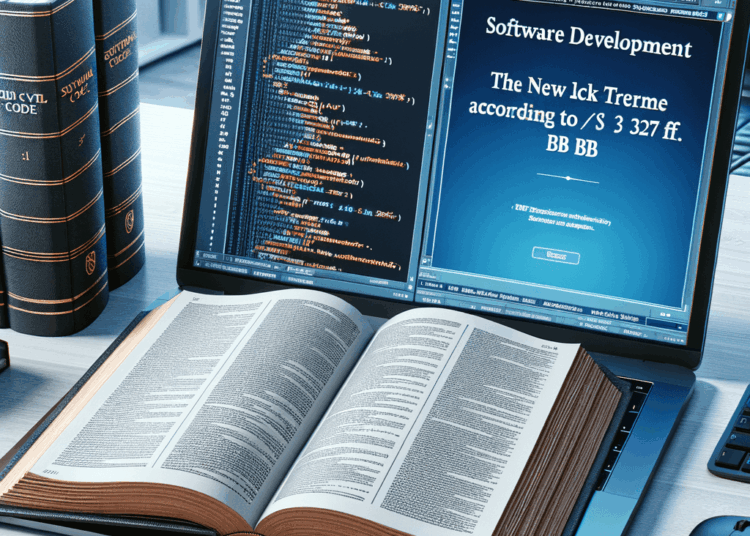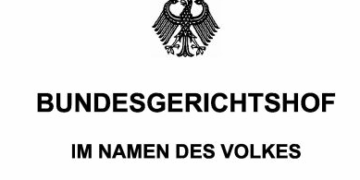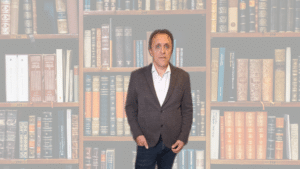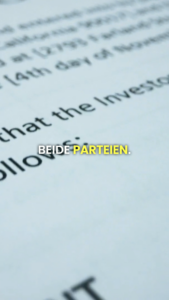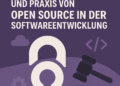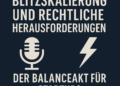- Die Vorschriften für Verbraucherverträge über digitale Produkte wurden am 1. Januar 2022 reformiert.
- Ein mangelhaftes digitales Produkt liegt vor, wenn subjektive und objektive Anforderungen nicht erfüllt sind.
- Die Update-Pflicht stellt sicher, dass notwendige Aktualisierungen bereitgestellt werden, um Mängel zu vermeiden.
- Das Recht auf Nacherfüllung beinhaltet die Pflicht, Software in den vertragsgemäßen Zustand zu versetzen.
- Bei Vertragsbeendigung wird der Verbraucher nicht für die Nutzung mangelhafter Software zur Kasse gebeten.
- Die neuen Regelungen gelten ausschließlich im B2C-Bereich für Verträge zwischen Unternehmern und Verbrauchern.
- Entwickler müssen klare Vertragsbedingungen festlegen und falsche Versprechungen in Werbung vermeiden.
Zum 1. Januar 2022 hat der deutsche Gesetzgeber die Vorschriften für Verbraucherverträge über digitale Produkte grundlegend reformiert. Für Softwareentwickler und Anbieter digitaler Inhalte – von Computerspielen über Apps bis zu SaaS-Diensten – ist insbesondere der neu definierte Mangelbegriff relevant. In diesem Beitrag beleuchten wir ausführlich, was als vertragsgemäße bzw. mangelhafte Leistung gilt und welche Rechte Verbraucher seitdem haben. Der Artikel richtet sich an Entwickler, Game-Studios, Start-ups und SaaS-Anbieter und zeigt anhand typischer Szenarien (Early Access-Spiele, Cloud-Services, Plugins etc.), wo Fallstricke lauern. Dieser Beitrag knüpft an unseren früheren Blogpost zu rechtlichen Risiken bei langen Entwicklungszeiten von crowdfinanzierten Spielen an, ohne dessen Inhalt zu wiederholen. Nun geht es um die praktischen Auswirkungen der §§ 327 ff. BGB auf die Softwareentwicklung – und darum, warum eine juristisch fundierte Vertragsgestaltung wichtiger denn je ist.
Vertragsmäßigkeit: Subjektive und objektive Anforderungen
Die neuen Vorschriften definieren, wann ein digitales Produkt vertragsgemäß (also mangelfrei) ist. Maßgeblich sind drei Kriterien: subjektive Anforderungen, objektive Anforderungen und – falls einschlägig – Anforderungen an die Integration. Vereinfacht gesagt muss eine Software alles erfüllen, was vertraglich zugesagt wurde, und zudem den üblichen Standard vergleichbarer Produkte einhalten, sofern nicht etwas anderes wirksam vereinbart wurde.
Subjektive Anforderungen sind all jene Eigenschaften, die individuell im Vertrag vereinbart wurden. Dazu zählen insbesondere die vereinbarte Beschaffenheit (z. B. bestimmte Features, Leistungsparameter, Versionen), die Funktionalität und Kompatibilität zu bestimmten Systemen, die Interoperabilität mit anderer Software sowie gegebenenfalls eine nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung. Ebenso gehören die Bereitstellung von Zubehör, Anleitungen oder Kundendienst dazu, wenn dies vereinbart wurde. Selbst zugesagte Updates werden Teil der subjektiven Anforderungen – liefert der Anbieter etwa vertraglich zugesicherte Aktualisierungen oder Upgrades nicht, liegt ein Mangel vor. Kurz: Alles, was Sie dem Kunden an Eigenschaften oder Leistungen zusichern, definiert den Soll-Zustand aus Kundensicht.
Objektive Anforderungen muss die Software zusätzlich erfüllen, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist. Damit ist der gewöhnliche Gebrauchszweck und die übliche Beschaffenheit gemeint: Das digitale Produkt muss sich für die übliche Verwendung eignen (ein Spiel z. B. grundsätzlich spielbar sein, eine SaaS-Anwendung die versprochenen Funktionen grundsätzlich erfüllen). Außerdem muss es eine Beschaffenheit aufweisen, die bei digitalen Produkten derselben Art üblich ist und die der Verbraucher erwarten kann. Dazu zählen Eigenschaften wie Funktionalität, Kontinuität des Dienstes, Kompatibilität, Zugänglichkeit und Sicherheit, wie sie für vergleichbare Produkte Standard sind. Beispiele: Ein Computerspiel soll ohne unübliche Abstürze laufen und gängigen Performance-Erwartungen entsprechen; eine App sollte gängige Datenschutz- und Sicherheitsstandards erfüllen; ein Cloud-Dienst sollte typischerweise eine gewisse Verfügbarkeit (Uptime) haben.
Objektiv wird außerdem verlangt, dass die Software der Beschaffenheit einer Testversion oder Demo entspricht, falls dem Verbraucher vorab eine solche gezeigt wurde. Wer also vor Vertragsschluss eine Beta-Version oder Trailer präsentiert, muss im fertigen Produkt zumindest das einlösen, was diese Vorab-Eindrücke versprochen haben. Auch muss die Software mit solchem Zubehör und Anleitungen geliefert werden, die der Verbraucher vernünftigerweise erwarten darf – z. B. eine Installationsanleitung oder ein Handbuch, falls das bei ähnlichen Produkten üblich ist. Zudem gilt: Sofern nicht anders vereinbart, ist bei Vertragsschluss die neueste Version der Software bereitzustellen. Einen veralteten Build zu liefern, obwohl bereits Updates verfügbar sind, wäre also objektiv ein Mangel.
Besondere Brisanz haben öffentliche Aussagen des Herstellers oder Vertriebspartners: Werbung, Produktbeschreibungen oder Ankündigungen können die objektiv erwartbare Beschaffenheit mitbestimmen. Verbraucher dürfen auf öffentlich gemachte Versprechen vertrauen – es sei denn, der Anbieter hat die Aussage vor Kauf eindeutig berichtigt oder konnte von ihr keine Kenntnis haben. Für Entwickler heißt das: Marketingversprechen lassen sich später nicht einfach als „unverbindliche Vorschau“ abtun; sie setzen den Maßstab, an dem das Produkt gemessen wird.
Abweichungen von den objektiven Anforderungen sind zwar möglich, aber nur unter strengen Voraussetzungen. Gemäß § 327h BGB muss der Verbraucher vor Vertragsschluss ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass ein bestimmtes Merkmal der Software von den objektiven Erwartungen abweicht, und er muss dieser Abweichung ausdrücklich zustimmen. Praktisch bedeutet das: Wenn Sie z. B. ein Early Access-Spiel verkaufen, das nicht dem üblichen Qualitätsstandard eines Vollpreistitels entspricht, oder eine App mit eingeschränkter Kompatibilität, dann müssen Sie den Kunden unmissverständlich vor Kauf darüber informieren – und idealerweise eine ausdrückliche Bestätigung einholen (etwa durch aktiv gesetzte Checkbox). Andernfalls kann nicht einfach im Kleingedruckten jeder Gewährleistungsanspruch ausgeschlossen werden. Die gesetzlichen Mindeststandards lassen sich nur auf diesem Wege und in begrenztem Umfang senken, nicht jedoch komplett aushebeln.
Anforderungen an die Integration spielen eine Rolle, wenn die Software vom Verbraucher selbst in dessen Umgebung installiert oder eingebunden werden muss (z. B. ein Plugin, das der Kunde in sein System integriert). Hier besagt § 327e BGB: Die Software ist vertragsgemäß, wenn die Integration sachgemäß durchgeführt wurde. Wird die Installation vom Anbieter vorgenommen, haftet natürlich dieser für eine korrekte Durchführung. Führt der Verbraucher die Installation selbst durch, kommt es darauf an, dass keine Fehler des Anbieters die Integration erschweren. Ist die Integration unsachgemäß, liegt dennoch kein Mangel vor, sofern diese Unsachgemäßheit nicht auf einem Fehler der vom Unternehmer bereitgestellten Anleitung beruht. Mit anderen Worten: Wenn die Software nur deshalb nicht läuft, weil die mitgelieferte Installationsanleitung lückenhaft oder irreführend war, bleibt der Anbieter verantwortlich. Hat der Kunde hingegen die klare Anleitung nicht befolgt oder eigenmächtig etwas falsch gemacht, kann der Anbieter sich darauf berufen, dass das Produkt an sich mangelfrei ist.
Zusammenfassend ist ein digitales Produkt mangelfrei, wenn es sowohl die subjektiven als auch die objektiven Anforderungen erfüllt (und korrekt integriert wurde). Werden eine dieser Anforderungen verfehlt, liegt ein Mangel vor, der Gewährleistungsrechte des Verbrauchers auslöst. Diese umfassende Definition des Soll-Ist-Vergleichs ist neu und deutlich konkreter als frühere Regelungen – insbesondere für Software, die bisher oft außerhalb des klassischen Kaufrechts betrachtet wurde.
Aktualisierungspflichten: Updates als Teil der Mängelfreiheit
Eine der wichtigsten Neuerungen ist die gesetzliche Update-Pflicht. Digitale Produkte gelten nur dann als mangelfrei, wenn auch die notwendigen Aktualisierungen bereitgestellt werden. Das umfasst funktionale Updates ebenso wie Sicherheits-Updates. Hintergrund ist, dass Software sich in einem laufenden digitalen Umfeld befindet: Betriebssysteme ändern sich, Sicherheitslücken tauchen auf, Nutzungsanforderungen entwickeln sich. Der Gesetzgeber verlangt daher, dass Anbieter für einen bestimmten Zeitraum dafür sorgen, dass die Software **„auf dem Stand“ bleibt.
Nach § 327f BGB muss der Unternehmer alle Updates, die für den Erhalt der Vertragsmäßigkeit erforderlich sind, bereitstellen und den Verbraucher darüber informieren. Sicherheitsaktualisierungen werden dabei ausdrücklich erwähnt. Versäumt es ein Anbieter beispielsweise, einen bekannten kritischen Bug oder eine Sicherheitslücke zu patchen, könnte das Produkt als mangelhaft gelten, weil es die objektiv erforderliche Sicherheit nicht mehr bietet. Gleiches gilt, wenn eine App nach einem iOS-/Android-Update nicht mehr läuft und kein Fix bereitgestellt wird – dann entspricht sie nicht mehr der vereinbarten bzw. erwartbaren Kompatibilität.
Wie lange muss aktualisiert werden? Das Gesetz spricht vom „maßgeblichen Zeitraum“. Bei dauerhaften Bereitstellungen – also Verträgen, die über Zeit laufen, etwa SaaS-Abos oder MMO-Spiele – ist das die gesamte Vertragslaufzeit. Bei einmaliger Bereitstellung (z. B. Kauf einer Softwareversion) ist es der Zeitraum, den der Verbraucher aufgrund der Art und des Zwecks der Software sowie der Umstände erwarten darf. Was genau „erwarten darf“ ist Einzelfallfrage: Bei einem Computerspiel für 5 € erwarten Käufer vielleicht nur wenige Monate Bugfix-Support; bei einer teuer lizenzierten Profi-Software hingegen einige Jahre Updates. Der Gesetzgeber wollte bewusst flexibel bleiben – es kommt auf die Verbrauchererwartung an.
In der Praxis bedeutet das für Entwickler: Die Pflicht zur Mängelfreiheit endet nicht mit der Auslieferung der Version 1.0. Man schuldet für eine gewisse Zeit noch Nachbesserungen in Form von Updates. De facto wird die Aktualisierungspflicht letztlich auf unbestimmte Zeit ausgedehnt, kommentiert ein Fachbeitrag – denn wann genau die Erwartung endet, ist unklar. Insbesondere Händler, die Software Dritter verkaufen, stehen hier vor Herausforderungen: Sie müssen vertraglich sicherstellen, dass der Hersteller ausreichende Updates liefert, weil der Endkunde sich sonst an den Verkäufer hält. Für Plugin-Entwickler oder App-Studios heißt es: Plant ihr Geschäftsmodell so, dass zumindest für die übliche Nutzungsdauer Updates (insbesondere sicherheitsrelevante) bereitgestellt werden können. Andernfalls drohen Mängelansprüche, auch wenn das Produkt initial fehlerfrei war.
Ein wichtiger Punkt: Versäumt der Verbraucher ein bereitgestelltes Update zu installieren, obwohl der Anbieter ihn darauf hingewiesen hat und eine korrekte Installationsanleitung mitgeliefert wurde, haftet der Anbieter nicht für daraus entstehende Mängel. Diese Schutzklausel entlastet den Entwickler, wenn der Nutzer Updates ignoriert. In der Kommunikation sollte daher klar und nachweisbar auf Updates und Konsequenzen hingewiesen werden (z. B. Meldung in der App „Bitte Update XY installieren, sonst Sicherheitsrisiko…“). Dann kann man etwaige später auftretende Probleme dem Nutzerverhalten zurechnen.
Nacherfüllung: Recht auf Bugfixes
Tritt ein Mangel auf, steht dem Verbraucher zunächst das Recht auf Nacherfüllung zu (§ 327l BGB). Nacherfüllung bedeutet, dass der Anbieter die Software nachträglich in den vertragsgemäßen Zustand versetzt – sprich: Bugs beseitigt oder fehlende Bestandteile liefert. Dieses Prinzip kennen wir aus dem Kaufrecht (Reparatur oder Ersatzlieferung) und Werkvertragsrecht (Nachbesserung), angepasst an digitale Inhalte.
Wichtig: Dem Verbraucher steht kein Wahlrecht zwischen „Reparatur“ und „Ersatz“ im klassischen Sinne zu. Bei Software läuft Nacherfüllung faktisch meist auf einen Patch, ein Update oder einen Workaround hinaus. Wie der Anbieter den vertragsgemäßen Zustand herstellt, bleibt ihm überlassen – Hauptsache, der Mangel wird behoben. Beispielsweise kann der Entwickler einen Hotfix veröffentlichen oder – falls das effizienter ist – dem Nutzer einen Ersatz in Form einer gleichwertigen Software anbieten. Entscheidend ist das Ergebnis: die Software muss hinterher die Anforderungen erfüllen.
Die Nacherfüllung muss für den Verbraucher kostenlos erfolgen und zügig. Das Gesetz verlangt eine Beseitigung des Mangels innerhalb einer angemessenen Frist ab Mangelanzeige. Was „angemessen“ ist, richtet sich nach Art des Mangels und der Software. Ein kritischer Sicherheitsbug in einer SaaS-Plattform muss etwa sehr schnell gefixt werden (Stunden oder wenige Tage), wohingegen bei einem kleineren Anzeigefehler in einem Spiel ein etwas längeres Update-Intervall tolerabel sein könnte. In jedem Fall dürfen keine erheblichen Unannehmlichkeiten für den Verbraucher entstehen – wochenlanges Warten auf einen essentiellen Bugfix wäre z. B. unzumutbar.
Natürlich kann es Situationen geben, in denen Nacherfüllung scheitert oder unverhältnismäßig wäre. § 327l Abs. 2 BGB schließt den Nacherfüllungsanspruch aus, wenn die Herstellung der Vertragsmäßigkeit nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich wäre. Das dürfte selten greifen (Software-Bugfixes sind selten „unverhältnismäßig teuer“), könnte aber z. B. einschlägig sein, wenn ein Feature fehlt, dessen Implementierung nachträglich extrem aufwändig wäre im Vergleich zum Nutzen. Zudem entfällt der Anspruch, wenn die Nacherfüllung unmöglich ist (§ 327l Abs. 3 i.V.m. § 275 BGB). „Unmöglich“ kann bei reiner Software eigentlich nur rechtliche oder physikalische Unmöglichkeit bedeuten – etwa, wenn ein versprochenes Lizenzmaterial doch nicht beschafft werden kann oder eine versprochene Online-Funktion mangels Serverinfrastruktur nicht bereitgestellt werden kann. In solchen Fällen springt man direkt zu den weiteren Rechten (Vertragsbeendigung, Minderung).
Als Entwickler sollte man Nacherfüllungsverlangen ernst nehmen und zügig erfüllen, um gar nicht erst in die nächsten Stufen der Gewährleistung zu rutschen. Kunden werden rechtlich angehalten, dem Anbieter zunächst diese Chance zur Fehlerbehebung zu geben – es liegt dann am Anbieter, das Vertrauen durch promptes Handeln zu rechtfertigen.
Vertragsbeendigung und Minderung
Wenn die Nacherfüllung fehlschlägt oder ausnahmsweise nicht zumutbar ist, darf der Verbraucher drastischere Konsequenzen ziehen: Er kann den Vertrag beenden (entspricht in etwa dem Rücktritt) oder den Preis mindern. Diese Rechte entsprechen den bekannten Gewährleistungsrechten im Kaufrecht, sind aber in §§ 327m und 327n BGB speziell auf digitale Produkte zugeschnitten.
Vertragsbeendigung (§ 327m BGB): Abs. 1 der Norm listet mehrere Fälle, in denen der Verbraucher den Vertrag kündigen (beenden) darf:
- Unmöglichkeit der Nacherfüllung: Ist von vornherein klar, dass Nachbessern nicht geht (z. B. ein fehlendes Spiel-Level kann technisch nicht nachgeliefert werden, weil die Ressourcen fehlen), kann der Kunde sofort vom Vertrag zurücktreten.
- Nicht erfolgte Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist: Wenn der Anbieter auf die Mangelmeldung nicht reagiert oder es nicht schafft, rechtzeitig zu patchen, darf der Verbraucher ebenfalls den Vertrag beenden. Er muss dem Entwickler also keine endlosen Fix-Versuche einräumen.
- Erneutes Auftreten eines Mangels trotz Nacherfüllung: Zeigt sich derselbe Mangel nach einer zunächst erfolgreichen Behebung wieder oder tritt ein neuer Mangel auf, der zeigt, dass das Produkt doch nicht in Ordnung ist, kann der Kunde ebenfalls die Reißleine ziehen. Beispiel: Ein Patch behebt einen kritischen Bug, aber wenige Tage später treten gleichartige Abstürze wieder auf – das signalisiert, dass die Software insgesamt nicht stabil ist.
- Schwerwiegender Mangel ohne Abwarten: In krassen Fällen darf der Verbraucher sofort den Vertrag beenden, auch ohne zunächst eine Nachbesserung verlangen zu müssen. Das setzt einen Mangel voraus, der das Vertrauen fundamental erschüttert. Ein oft zitiertes Beispiel ist ein Antivirenprogramm, das selbst mit Viren infiziert ist. Hier wäre es dem Kunden nicht zumutbar, erst auf Reparatur zu warten – der Schaden und Vertrauensverlust sind so gravierend, dass ein sofortiger Rücktritt gerechtfertigt ist.
Abs. 2 des § 327m schränkt zugleich ein: Bei unerheblichen Mängeln besteht kein Recht zur Vertragsbeendigung. Eine kleine Schönheitsabweichung oder ein kaum wahrnehmbarer Fehler berechtigen also nicht zum Rücktritt. Die Schwelle von „unerheblich“ dürfte aber eher hoch liegen – im Zweifel wird man eher von einem erheblichen Mangel ausgehen, wenn er den typischen Gebrauch beeinträchtigt oder eine Zusicherung betrifft.
Minderung (§ 327n BGB): Anstatt den Vertrag ganz zu beenden, kann der Verbraucher auch den Preis angemessen herabsetzen. Dieses Recht besteht allerdings nur, wenn tatsächlich ein Preis gezahlt wird – bei rein kostenlosen Angeboten (gegen Daten) ist Minderung sinnlos, dort käme nur Vertragsbeendigung in Betracht. Die Minderung tritt praktisch an die Stelle des Rücktritts, wenn der Kunde die Software trotz Mangel behalten will. Erklärt er die Minderung, behält er das digitale Produkt, erhält aber einen Teil des gezahlten Entgelts zurück. Die Berechnung erfolgt in der Regel prozentual entsprechend der Wertminderung durch den Mangel (ähnlich wie im Kaufrecht). Beispiel: Wenn eine SaaS-Leistung für 100 € im Monat nur die Hälfte der versprochenen Features liefert, könnte der Kunde z. B. auf 50 € im Monat mindern.
Zu beachten ist: Bei dauerhaften Dienstleistungen (Abos) kommt eine Minderung einer zukünftigen Preisreduzierung gleich, während bei einer Einmalleistung (Kaufpreis) eher eine Teilrückzahlung erfolgen wird. Juristisch läuft es aber auf dasselbe hinaus – der Verbraucher zahlt weniger, weil er weniger bekommen hat als vereinbart.
Schadensersatz: Unabhängig von Rücktritt oder Minderung kann in bestimmten Fällen auch Schadensersatz verlangt werden (geregelt in § 327m Abs. 3 BGB i.V.m. § 280 BGB). Das setzt aber ein Verschulden des Anbieters voraus. Für Entwickler ist wichtig: Wenn ein Mangel z. B. viele Nutzer betrifft und diese aufgrund dessen Folgeschäden haben (etwa Ausfallzeiten, Datenverluste), kann das teuer werden. Eine Haftung kann jedoch oft vertraglich begrenzt werden (etwa durch Haftungsbeschränkungen in AGB, soweit diese wirksam sind und nicht die Kernpflichten unterlaufen).
Praxis-Tipp: Die meisten Verbraucher werden zuerst versuchen, einen Fix zu bekommen (weil sie die Software nutzen wollen). Misslingt dies, ist aus Entwicklersicht eine einvernehmliche Lösung oft besser, als es auf einen Rücktritt oder Rechtsstreit ankommen zu lassen. Zum Beispiel kann man einen Gutschein, eine Verlängerung der Abo-Laufzeit oder ein kostenfreies Upgrade anbieten – all das kann faktisch einer Minderung entsprechen, ohne dass formell Rechtsbehelfe ausgeübt werden. Wichtig ist nur, den Dialog mit unzufriedenen Kunden zu suchen, bevor sie von ihren Rechten Gebrauch machen.
Wertersatz und Rückabwicklung
Kommt es zur Vertragsbeendigung (Rücktritt), stellt sich die Frage: Muss der Verbraucher für die bereits genutzte Software Wertersatz leisten? Nach altem Recht gab es bei Rücktritt von Kaufverträgen komplexe Regeln, wann ein Verbraucher für die Nutzung eines mangelhaften Produkts etwas bezahlen muss. Für digitale Produkte hat der Gesetzgeber klar Position bezogen: Bei Vertragsbeendigung wegen Mangels darf dem Verbraucher kein Wertersatz für die Nutzung auferlegt werden. Art. 17 Abs. 3 der EU-Digitalinhalte-Richtlinie schreibt vor, dass der Verbraucher im Gewährleistungsfall nichts für die bereits erbrachte Leistung zahlen muss – dieses Verbot eines Nutzungswertersatzes wurde in § 327o BGB umgesetzt.
Für die Praxis bedeutet das: Der Anbieter muss bei Rücktritt den gesamten gezahlten Preis erstatten, soweit der Verbraucher für die Leistung schon etwas bezahlt hat. Im Gegenzug muss der Verbraucher die weitere Nutzung unterlassen – schließlich erhält er sein Geld zurück, da kann er das digitale Produkt nicht einfach weiter nutzen. Da digitale Güter nicht „zurückgegeben“ werden können wie eine Sache, enthält § 327o BGB sinngemäß die Pflicht des Verbrauchers, die Software von seinen Geräten zu löschen und Zugriff darauf zu unterbinden (oder z.B. einen Account zu schließen). Faktisch trägt der Unternehmer das volle Risiko: Er kann nicht, wie bei Sachgütern, eine Abnutzungsentschädigung verlangen.
Bei dauerhaften Leistungen (Subscriptions, laufende Dienste) greift eine Sonderregel: Der Vergütungsanspruch des Anbieters erlischt für den Zeitraum, in dem das digitale Produkt mangelhaft war. War also z. B. ein Online-Dienst zwei von zwölf Monaten wegen eines Mangels nicht vertragsgemäß, so entfällt dafür der Anspruch auf Bezahlung. Hat der Kunde bereits im Voraus gezahlt, muss der entsprechende anteilige Betrag rückerstattet werden (d.h. im Beispiel 2/12 des Jahresbeitrags). Künftig nicht mehr zu erbringende Leistungen (nach dem Rücktritt) darf der Anbieter natürlich ebenfalls nicht mehr berechnen. Unterm Strich bekommt der Verbraucher also Geld zurück für mangelhafte oder ausgefallene Leistungszeiträume, und der Vertrag ist beendet.
Ein wichtiger Unterschied zum Widerrufsrecht (das ja bei digitalen Inhalten unter bestimmten Umständen ausgeschlossen sein kann): Hier reden wir von Gewährleistungsrechten. Der Ausschluss von Wertersatz gilt also im Falle eines Mangels. Tritt kein Mangel auf und der Verbraucher möchte den Vertrag regulär kündigen (bei Dauerschuldverhältnissen) oder widerrufen (bei Fernabsatz, falls nicht erloschen), greifen die allgemeinen Regeln. Bei Gewährleistung aber soll der Verbraucher keinerlei „Strafzahlung“ für die Nutzung eines defekten Produkts leisten müssen – das volle Incentive liegt beim Unternehmer, direkt mangelfrei zu liefern.
Für Entwickler bedeutet das: Rücktritte können teuer werden. Nicht nur entgeht einem der Umsatz, man hat auch keine Kompensation dafür, dass der Kunde die Software vielleicht wochen- oder monatelang genutzt hat. Dieses Risiko sollte man einkalkulieren, insbesondere wenn man z. B. einen Service mit Jahresabo anbietet – bricht der Kunde nach 10 Monaten wegen eines Mangels den Vertrag ab, müssen potenziell 10 Monate Beiträge rückgezahlt werden. Zudem hat der Anbieter nach § 327p BGB ggf. Ansprüche, die digitale Umgebung beim Verbraucher zu löschen oder weitere Nutzung zu verhindern, aber das ist eher theoretisch – in der Praxis wird man darauf vertrauen müssen, dass der Kunde fair handelt, oder technische Schutzmaßnahmen (z. B. Konto-Zugriff sperren) vorsehen.
Anwendungsbereich und Altverträge (Vertrag vor 2022, Leistung ab 2022)
Die beschriebenen Regeln gelten nur im B2C-Bereich, also für Verträge zwischen Unternehmer und Verbraucher. Ein „digitales Produkt“ in diesem Sinne ist jede digitale Inhalte oder Dienstleistung, die gegen Zahlung (oder gegen Bereitstellung personenbezogener Daten) dem Verbraucher zur Verfügung gestellt wird. Darunter fallen Softwarekaufverträge, Lizenzverträge, SaaS-Abonnements, App-Käufe, Spiele-Downloads, Cloud-Speicher-Dienste und vieles mehr. Wichtig: Auch wenn kein Geld fließt, sondern der Verbraucher z. B. seine Daten als Gegenleistung zur Verfügung stellt (Freemium-Modelle, „kostenlose“ Apps gegen Datennutzung), gilt das als Preis im Sinne des Gesetzes und löst die §§ 327 ff. aus. Damit will man Umgehungen verhindern – der Verbraucher soll auch beim „Bezahlen“ mit Daten Gewährleistungsschutz genießen.
Nicht unter diese Vorschriften fallen reine B2B-Verträge (zwischen Unternehmen). Dort gilt weiterhin, was im Vertrag vereinbart ist, sowie das allgemeine Vertragsrecht und ggf. das kaufrechtliche Mängelrecht (§§ 433 ff. BGB) oder Werkvertragsrecht, jedoch ohne die verbraucherschützenden Besonderheiten. Trotzdem können die neuen Begriffe auch im B2B-Verkehr als Orientierung dienen – viele Hersteller werden ihre Produktbeschreibungen generell anpassen (müssen), um einmal den Verbraucheranforderungen zu genügen.
Eine Besonderheit ist die Behandlung von Waren mit digitalen Elementen (z. B. ein Smart-TV, ein Auto mit Software). Hier gelten im Kern die Regelungen des Kaufrechts (umgesetzt durch die Warenkaufrichtlinie), aber viele Grundsätze überschneiden sich mit den digitalen Produkten. In solchen Fällen verweist das Gesetz teils auf die §§ 327 ff. BGB oder umgekehrt. Für Softwareentwickler im engeren Sinne (die reine Software/Dienstleistungen anbieten) reicht es jedoch, sich auf die §§ 327 ff. zu konzentrieren.
Übergangsvorschriften: Was ist mit Verträgen, die vor dem 1.1.2022 abgeschlossen wurden, deren Leistung aber erst nach dem Stichtag erbracht wird? Hier hat der Gesetzgeber eine unechte Rückwirkung zugunsten der Verbraucher geschaffen. Gemäß Art. 229 § 57 EGBGB gelten die neuen Vorschriften grundsätzlich auch für Altverträge, wenn die Bereitstellung des digitalen Produkts ab 1.1.2022 erfolgt. Ein typisches Beispiel: Ein Videospiel wurde im Dezember 2021 per Preorder verkauft, Release ist aber erst 2022 – dann muss das Spiel den §§ 327 ff. entsprechen, obwohl der Vertrag 2021 geschlossen wurde. Ebenso ein SaaS-Vertrag von Ende 2021, dessen Nutzungsphase in 2022 fällt.
Allerdings gibt es Ausnahmen: Die Regelungen über Änderungen an digitalen Produkten (§ 327r BGB) sowie über den Unternehmerregress (§§ 327t, 327u BGB) gelten nur für Verträge ab 2022. Das betrifft vor allem die Möglichkeit, nachträglich vertragliche Änderungen an Software vorzunehmen (Feature-Änderungen etc.) – bei Altverträgen muss man solche Änderungen anders lösen. Die Kernvorschriften zum Mangelbegriff, Nacherfüllung, Rücktritt/Minderung und Updates gelten hingegen auch für Altverträge mit Leistung ab 2022. Für die Praxis von Entwicklern heißt das: Selbst wenn Sie vor 2022 Verträge (z. B. Lizenzvereinbarungen, Early-Access-Käufe) abgeschlossen haben, können Kunden, die erst jetzt die Lieferung/Leistung erhalten, die neuen Rechte geltend machen. Ein Entwickler kann sich nicht darauf berufen, das alte (bis 2021 geltende) Recht sei für einen solchen Kunden maßgeblich – sofern die Leistung jetzt erbracht wird, muss sie den neuen Standards genügen.
Typische Problemfelder aus der Praxis
Nach dieser theoretischen Übersicht werfen wir einen Blick auf typische Anwendungsszenarien und Risiken für Entwickler:
Early-Access-Spiele: Viele Game-Studios veröffentlichen Spiele bereits in frühen Entwicklungsphasen (Alpha/Beta) als „Early Access“, um Feedback einzuholen und Finanzierung zu sichern. Juristisch ist ein Early-Access-Titel ein digitales Produkt, das jedoch bewusst noch nicht fertiggestellt ist. Ohne besondere Vorkehrungen wäre ein solches unfertiges Spiel objektiv mangelhaft, weil es nicht die übliche Beschaffenheit eines fertigen Spiels aufweist (Bugs, fehlende Inhalte, Balancing-Probleme etc.). Daher müssen Entwickler klarstellen, dass es sich um eine unfertige Version handelt. In der Praxis geschieht das durch entsprechende Hinweise auf Plattformen wie Steam – das Spiel wird ausdrücklich als „Early Access“ deklariert. Diese Deklaration kann als Beschaffenheitsvereinbarung dahingehend verstanden werden, dass der Käufer kein vollendetes Spiel erhält, sondern eines im Entwicklungsstadium. Die Erwartungen des Verbrauchers verschieben sich damit: Er kann keine höheren Anforderungen stellen, als es für Early-Access-Titel üblich ist – dass also Fehler und Unzulänglichkeiten auftreten, ist dann „vertraglich mitgekauft“. Achtung: Die bloße Bezeichnung „Early Access“ entbindet aber nicht von allen Pflichten. Verspricht das Studio im Early-Access-Vertrag bestimmte spätere Inhalte oder einen Veröffentlichungszeitplan, bleiben diese Versprechen subjektive Anforderungen. Werden sie nicht eingehalten (etwa die finalen Features nie geliefert), liegt ein Mangel vor. In unserem früheren Beitrag zu Crowdfunding-Projekten haben wir bereits betont, dass ein stark vom Versprochenen abweichendes oder gar nicht geliefertes Spiel Gewährleistungsrechte auslösen kann. Für Early-Access gilt das genauso: Transparenz über den unfertigen Zustand schützt nur vor unberechtigten Erwartungen, nicht aber davor, die gemachten Zusagen erfüllen zu müssen.
SaaS-Produkte und Cloud-Services: Bei Software-as-a-Service (etwa Web-Plattformen, gehostete Software, Abomodell) schuldet der Anbieter eine dauerhafte, vertragsgemäße Leistung über die Zeit. Hier greifen insbesondere die Update- und Kontinuitätspflichten. Downtime oder längere Leistungsstörungen (z. B. stark verminderte Geschwindigkeit, fehlende Funktionen) können als Mangel gewertet werden, wenn sie über das vertraglich tolerierte Maß hinausgehen. Ein SLA (Service Level Agreement), das gewisse Ausfallzeiten vorsieht, definiert insoweit den Rahmen der subjektiven Anforderungen. Wird dieser Rahmen überschritten – etwa der Dienst ist deutlich unzuverlässiger als zugesagt – kommen Nacherfüllungsansprüche ins Spiel. Der Anbieter muss also möglichst schnell stabilen Betrieb herstellen. Gelingt das nicht, drohen Kündigungen durch die Kunden gemäß § 327m BGB. Dank § 327o BGB können Kunden sogar einen Teil ihrer Beiträge zurückverlangen, wenn der Service monatelang nicht wie geschuldet lief. Beispiel: Ein Cloud-Speicherdienst verspricht 99% Uptime, hat aber über zwei Monate hinweg regelmäßige Ausfälle von mehreren Stunden täglich – Verbraucher könnten hier argumentieren, der Dienst sei mangelhaft, Nacherfüllung (Stabilisierung) verlangen und bei Scheitern den Vertrag beenden. Sie bräuchten dann für die Ausfallzeiten auch nicht zu zahlen bzw. bekämen Geld zurück. Zudem müssen SaaS-Anbieter die Sicherheit ihrer Anwendungen gewährleisten. Ein ungepatchter Sicherheitsbug, durch den Daten abhandenkommen, ist nicht nur ein Security-Vorfall, sondern aus zivilrechtlicher Sicht ein Mangel (Verletzung der objektiven Anforderung „Sicherheit“). Hier drohen neben Gewährleistungsrechten auch Haftungsansprüche.
Ein weiterer Aspekt bei SaaS ist die Änderung von Leistungen im laufenden Vertrag – geregelt in § 327r BGB. Viele SaaS-Anbieter entwickeln ihr Produkt ständig weiter, nehmen aber auch mal Features vom Netz oder ändern den Umfang. Die neuen Regeln erlauben Vertragsänderungen zulasten des Verbrauchers nur unter engen Voraussetzungen (z. B. wenn der Vertrag das vorsieht, die Änderung aus sachlichem Grund erfolgt und der Kunde benachrichtigt wird und ggf. ein Kündigungsrecht erhält). Geplante Feature-Entfernungen oder -Änderungen sollte man daher juristisch prüfen lassen, um nicht gegen die Update- und Änderungsregeln zu verstoßen. Andernfalls könnte der Kunde bei einer wesentlichen Verschlechterung ebenfalls kündigen und Wertersatz verweigern.
Mobile Apps und Plugins: Im Bereich Mobile Apps gelten die neuen Regeln 1:1. Auch eine 0,99 €-App im App Store muss die vereinbarte und üblich erwartbare Funktionalität bieten. Tut sie das nicht – z. B. häufige Abstürze, Nicht-Funktionieren auf einem offiziell unterstützten Gerät – stehen dem Käufer Gewährleistungsrechte zu. Praktisch werden viele Verbraucher eher eine schlechte Bewertung dalassen als rechtlich vorzugehen, aber im Hintergrund gelten die Rechte dennoch. App-Entwickler sollten darauf achten, Kompatibilitätsangaben einzuhalten (etwa „erfordert Android 10 oder höher“) und Updates bereitzustellen, wenn neue OS-Versionen erscheinen. Bleibt eine App z. B. nach einem iOS-Update funktionslos und bringt der Entwickler kein Update heraus, könnte das als Mangel gewertet werden, da der Verbraucher eine gewisse Zeit Kompatibilität erwarten durfte. Ähnlich bei Plugins (z. B. WordPress-Plugins, Browser-Erweiterungen): Hier kommt zusätzlich die Integration ins Spiel. Ein Plugin muss grundsätzlich mit der vorgesehenen Hauptsoftware (WordPress, Browser X) funktionieren. Ist dies nicht der Fall und liegt es am Plugin (und nicht an falscher Installation durch den Nutzer), haftet der Entwickler. Zudem erwartet der Nutzer, dass das Plugin zumindest mit den üblichen Aktualisierungen der Hauptsoftware Schritt hält – zumindest für eine gewisse Zeit. Wer ein WordPress-Plugin verkauft, sollte idealerweise angeben, für welche WP-Versionen es getestet ist, und wie lange Updates ungefähr angeboten werden. Geschieht ein Bruch (z. B. WordPress 6 kommt heraus und das Plugin wird nicht angepasst), könnte der Nutzer argumentieren, das Plugin erfülle die objektiven Anforderungen nicht mehr, weil es an Kompatibilität und Kontinuität fehlt. Hier spielt die angemessene Vertragserwartung rein: Bei Plugins erwartet man Updates zumindest über mehrere Hauptversionen von WordPress hinweg – außer es wurde klar als „für Version X, keine Garantie für zukünftige“ deklariert (wieder das Thema Abweichungsvereinbarung!). Für Entwickler heißt es: entweder klar befristen/begrenzen, was der Kauf beinhaltet (z. B. „inkl. Updates für 1 Jahr“) – oder damit rechnen, dass Kunden längerfristigen Support als geschuldet ansehen.
Versprechungen in Werbung und Crowdfunding: Ein ganz zentrales Risiko, das die neuen Regeln verschärfen, sind wohlmeinende, aber unvorsichtige Versprechungen. Marketingabteilungen und Entwickler neigen dazu, ihre Software in bestem Licht darstellen zu wollen – „Feature X kommt bald, Feature Y ist revolutionär, unser Produkt kann alles und noch mehr!“. Unter §§ 327 ff. BGB können solche Aussagen rechtlich bindende Beschaffenheitsangaben sein. Gerade bei Crowdfunding-Kampagnen oder Early-Access-Beschreibungen werden oft Roadmaps veröffentlicht. Wenn man dort konkrete Funktionen oder Inhalte ankündigt („Dieses Spiel wird einen Multiplayer-Modus enthalten“ oder „Alle Backer erhalten DLCs kostenlos“), werden diese Ankündigungen Bestandteil der subjektiven Anforderungen. Bleibt der Multiplayer dann aus oder wird der DLC doch kostenpflichtig, liegt eine Vertragsverletzung vor. Verbraucher könnten Nacherfüllung (nachträglichen Einbau des Multiplayer) verlangen – was oft unmöglich ist – und dann vom Vertrag zurücktreten. Die Konsequenzen sind Rückzahlungen und Vertrauensverlust.
Die neuen Regeln betonen auch, dass öffentliche Äußerungen Dritter (z. B. des Herstellers gegenüber dem Publisher, oder Influencer mit offizieller Info) Erwartungen wecken können. Zwar haftet der Entwickler nicht für völlig überzogene Werbeaussagen eines unabhängigen Dritten, aber sobald der Entwickler oder Publisher selbst solche Aussagen veranlasst hat, muss er sich daran messen lassen. Best Practice sollte daher sein: Marketingversprechen immer mit der Entwicklungsabteilung und der Rechtsabteilung abstimmen. Was nicht sicher geliefert werden kann, sollte entweder nicht versprochen oder nur mit Vorbehalt formuliert werden. Z. B. statt „wird Feature X haben“ lieber „ist geplant, Feature X hinzuzufügen“. Allerdings Achtung: Auch „geplant“ kann ein Verbraucher als Erwartung auffassen. Sicherer ist, genau zu dokumentieren, was Vertragsinhalt sein soll (etwa in Produktbeschreibung/AGB) und was nicht. Was dort nicht steht, könnte der Anbieter im Zweifel als nicht versprochen ansehen – aber wie oben erwähnt, Öffentlichkeitsangaben fließen ein. Es ist also ein schmaler Grat zwischen ehrlichem Marketing und juristisch überfrachteten Disclaimer-Texten.
Klar ist: Plumpe Haftungs- oder Gewährleistungsausschlüsse in AGB helfen wenig. Ein Entwickler kann nicht per AGB sagen „Gekauft wie gesehen, keine Gewähr für irgendwelche Eigenschaften“, zumindest nicht im Verbrauchergeschäft. Solche Klauseln wären unwirksam, weil sie die gesetzlichen Mindestrechte der Verbraucher aushebeln. Besser ist es, konkret zu regeln, was Vertragsinhalt ist und was nicht, anstatt pauschal jede Haftung auszuschließen. Verbraucherrechtlich zwingende Vorschriften – wie eben die §§ 327 ff. – lassen sich ohnehin nicht wegbedingen.
Fazit: Handlungsempfehlungen für Entwickler und Anbieter
Die Neuregelungen der §§ 327 ff. BGB stärken die Verbraucherrechte bei Software, Spielen und digitalen Diensten erheblich. Für Entwickler, Game-Studios, Start-ups und SaaS-Anbieter bedeutet dies ein erhöhtes Risiko, haftbar gemacht zu werden, wenn Produkte nicht die vereinbarte oder objektiv erwartbare Beschaffenheit aufweisen. Es drohen Rückerstattungsforderungen, Vertragskündigungen oder sogar Schadensersatz, wenn z. B. ein Spiel hinter den Ankündigungen zurückbleibt oder ein Service die zugesicherte Leistung nicht erbringt. Gleichzeitig steigt der Verwaltungsaufwand, um z. B. Updatepflichten zu erfüllen und Support über längere Zeiträume sicherzustellen.
Um diese Risiken zu minimieren, ist eine sorgfältige Vertragsgestaltung unabdingbar. Alle wesentlichen Eigenschaften des digitalen Produkts sollten klar definiert werden – idealerweise schriftlich in Leistungsbeschreibungen oder AGB. Dazu gehören Umfang und Funktionalitäten, Systemvoraussetzungen, Kompatibilitäten, sowie ggf. die Dauer von Support und Updates. Unklare oder fehlende Angaben werden sonst im Zweifel zu Lasten des Entwicklers ausgelegt, indem das Gesetz die üblichen Anforderungen einfüllt. Wo das Produkt bewusst von üblichen Erwartungen abweicht (z. B. Beta-Status, eingeschränkte Kompatibilität), muss der Kunde ausdrücklich darauf hingewiesen werden und zustimmen. Solche Abweichungsvereinbarungen sollten deutlich erfolgen – etwa durch eine hervorgehobene Erklärung des Kunden („Mir ist bekannt, dass die Software XYZ noch Fehler enthalten kann…“). Nur so lässt sich später nachweisen, dass der Verbraucher informiert war.
Keine falschen Versprechungen: Marketing und Produktkommunikation sollten eng mit der tatsächlichen Leistung übereinstimmen. Versprechen Sie nur, was Sie auch halten können. Jede öffentliche Zusicherung – sei es in Werbung, auf der Website oder in sozialen Medien – kann rechtlich bindend sein. Im Zweifel lieber vorsichtig formulieren und auf zukünftige Features als Vision statt als garantiertes Versprechen hinweisen. Intern sollten Marketing und Entwicklung hier Hand in Hand arbeiten, um Erwartungsmanagement zu betreiben. Es schadet auch nicht, gegebenenfalls rechtlichen Rat einzuholen, bevor man großangelegte Versprechen (etwa in Kickstarter-Kampagnen) veröffentlicht.
AGB und Nutzungsbedingungen sollten von spezialisierten Juristen geprüft und an die neue Rechtslage angepasst sein. Klauseln, die versuchen, Gewährleistungsrechte komplett auszuschließen oder die Pflicht zur Update-Bereitstellung abbedingen, sind riskant und meist unwirksam. Stattdessen kann man in den AGB regeln, wie Updates bereitgestellt werden, dass der Nutzer z. B. bestimmte Mitwirkungspflichten hat (Updates installieren, sonst Haftungsausschluss nach § 327f Abs. 2 BGB), oder wie Änderungen an einem laufenden Dienst erfolgen (Stichwort § 327r BGB). Es empfiehlt sich auch, bei Lizenzverträgen mit Lieferanten (etwa wenn ein Studio eine Engine oder Drittsoftware in seinem Produkt nutzt) Rückgriffsrechte und Updatezusagen zu vereinbaren, damit man selbst in der Lage ist, gegenüber Endkunden die Pflichten zu erfüllen.
Angesichts der Komplexität dieser Materie und der teils erheblichen wirtschaftlichen Folgen (man denke an Massen-Rückabwicklungen oder Reputationseinbußen durch enttäuschte Nutzer) ist eine anwaltliche Begleitung dringend zu empfehlen. Schon in der Entwicklungsphase sollte man grundlegende Fragen klären: Wie beschreiben wir unser Produkt rechtssicher? Welche Features versprechen wir verbindlich, welche lieber nicht? Wie gestalten wir Beta-Tests oder Early Access, ohne uns zu sehr zu binden? – Ein im IT-Vertragsrecht erfahrener Jurist kann hier wertvolle Hinweise geben und Vertragsdokumente erstellen, die die neuen Spielregeln berücksichtigen.
Insgesamt zeigen die §§ 327 ff. BGB, dass Software und digitale Inhalte nun rechtlich wie „echte“ Produkte behandelt werden, die gewisse Soll-Eigenschaften haben müssen. Für die Softwareentwicklung markiert dies ein Stück weit einen Kulturwandel: Weg von völlig freier „as is“-Lizenzierung hin zu verbraucherfreundlichen Qualitätsstandards. Wer diese Standards von vornherein einplant – technisch und vertraglich –, wird am Ende weniger Probleme mit Gewährleistungsfällen haben. Klare Verträge, realistische Versprechen und proaktiver Support sind der Schlüssel, um in diesem neuen Rechtsrahmen erfolgreich und rechtssicher digitale Produkte anzubieten.