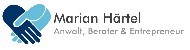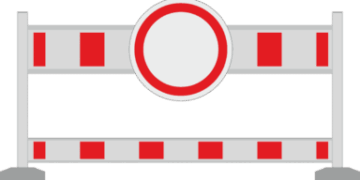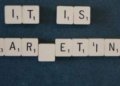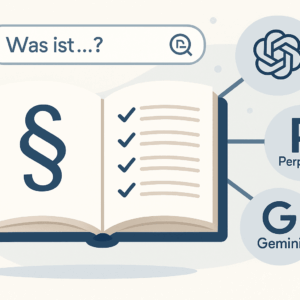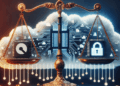Der aktuelle Streit um einen VR-Mod für ein großes AAA-Spiel eignet sich als Aufhänger, weil er ein Muster sichtbar macht, das in fast jedem größeren Modding-Konplex wiederkehrt: Technisch wird etwas hinzugefügt, was viele Spielende wollen, wirtschaftlich wird daraus schnell ein Abomodell oder eine Paywall, und rechtlich prallen dann drei Ebenen aufeinander, die in Diskussionen gern vermischt werden. Die erste Ebene ist das Urheberrecht, also die Frage, ob der Mod in geschützte Positionen eingreift und ob dafür eine Erlaubnis erforderlich ist. Die zweite Ebene ist Vertragsrecht, insbesondere EULA/Terms of Use und sonstige Nutzungsbedingungen, die bei Spielen häufig sehr weit reichen. Die dritte Ebene ist die Durchsetzungspraxis, also Takedowns, Plattformmechanik, Abmahnung, Unterlassung, Streitwertlogik und die Frage, wann es sich lohnt, zu eskalieren oder eine Lösung zu verhandeln.
Dieser Beitrag setzt bewusst nicht auf „News“, sondern auf belastbare Grundsätze. Ziel ist eine realistische Einordnung: Modding ist nicht automatisch „illegal“, aber Monetarisierung ist in der Praxis fast immer der Punkt, an dem aus Duldung ein Konflikt wird. Wer Einnahmen erzielen will, braucht eine saubere Lizenzkette oder ein Geschäftsmodell, das rechtlich und tatsächlich nicht als Verkauf eines IP-nahen Produkts gelesen werden kann.
Fan-Guidelines: Was sind das überhaupt?
„Fan Content Guidelines“ oder „Fan Policies“ wirken auf den ersten Blick wie AGB. Tatsächlich sind sie rechtlich etwas Eigenständiges: Es handelt sich meist um öffentlich kommunizierte Regeln, unter denen ein Rechteinhaber bestimmte Nutzungen toleriert oder (teilweise) gestattet. Dogmatisch lässt sich das als eine Art einseitige Gestattung mit Bedingungen beschreiben. Der Kern ist: Ohne Erlaubnis verbleibt es bei den gesetzlichen Ausschließlichkeitsrechten des Rechteinhabers. Mit Guidelines wird ein Bereich definiert, in dem der Rechteinhaber typischerweise nicht einschreitet – solange die Bedingungen eingehalten werden. Das ist weniger „Vertrag“ im klassischen Sinn als vielmehr Lizenzpolitik.
Ob Guidelines AGB sind, hängt davon ab, wie sie in eine Vertragsbeziehung eingebunden werden. Werden sie Bestandteil einer EULA oder ausdrücklich in ein Nutzungsverhältnis einbezogen, greifen die Regeln über Allgemeine Geschäftsbedingungen (§§ 305 ff. BGB) und deren Wirksamkeitskontrolle. Viele Publisher arbeiten aber zweigleisig: Die EULA regelt die Nutzung des Spiels und enthält Modding-Verbote oder Modding-Erlaubnisse, während Guidelines als zusätzliches Dokument beschreiben, welche Formen von Fan-Content geduldet werden und wie etwa Branding, Disclaimer oder Monetarisierung gehandhabt werden sollen. In dieser Konstellation sind Guidelines häufig weniger „AGB-Klauseln“ als ein externer Rahmen, der erklärt, wann der Rechteinhaber von seinen Rechten Gebrauch macht.
Praktisch ist die Unterscheidung wichtig, weil AGB nur gegenüber Personen wirken, die überhaupt Vertragspartner sind. Ein rein „öffentliches Regelwerk“ bindet niemanden per se. Es wirkt nicht wie ein Gesetz. Der Hebel entsteht anders: Wer ohne Lizenz in geschützte Rechte eingreift, ist ohnehin im Urheberrecht. Wer eine Duldung in Anspruch nehmen will, muss die Bedingungen einhalten. So betrachtet sind Guidelines weniger „Bindung“ als „Türschild“: Dahinter liegt das Urheberrecht; das Schild sagt nur, wann die Tür offen steht.
„Was ist, wenn der Modder die EULA gar nicht akzeptiert hat?“
Die Frage ist zentral und wird in der Praxis häufig falsch beantwortet. Wenn tatsächlich kein Vertrag zustande gekommen ist, greifen vertragliche Verbote aus der EULA nicht unmittelbar. Das bedeutet aber nicht, dass damit freie Bahn besteht. Dann bleibt der Blick auf das Urheberrecht, Markenrecht und gegebenenfalls Wettbewerbsrecht. Der Rechteinhaber muss nicht beweisen, dass eine EULA akzeptiert wurde, um Urheberrechte durchzusetzen.
Die „Nichtakzeptanz“ ist zudem seltener, als es in Diskussionen behauptet wird. Wer das Spiel installiert, startet, aktualisiert oder Online-Dienste nutzt, akzeptiert regelmäßig irgendwo Bedingungen; das gilt auch, wenn ein Key weitergegeben wurde, ein Familienaccount genutzt wird oder ein Zugriff über Cloud/Subscription erfolgt. Selbst wenn der Mod-Entwickler das Spiel nicht selbst gekauft hat, kann eine Zustimmung über Nutzungshandlungen dennoch vorliegen. Und selbst wenn das nicht der Fall ist: Sobald ein Modding-SDK, Editor, API-Zugang oder Developer-Portal genutzt wird, entstehen häufig eigene Vertragsbeziehungen. In vielen Ökosystemen läuft das Modding rechtlich gerade darüber: Zugriff auf Tools oder Schnittstellen wird nur gegen Zustimmung zu Developer Terms ermöglicht.
Rein theoretisch bleibt aber die Konstellation möglich, dass ein Modder ausschließlich mit technischen Mitteln an ein Spiel andockt, ohne selbst Vertragspartner zu sein. Dann stellt sich die Frage nicht „wie bindet eine EULA“, sondern „welche urheberrechtlich relevanten Handlungen finden statt“. In dieser Lage ist nicht das Vertragsrecht die Hauptbaustelle, sondern die urheberrechtliche Qualifikation des Modding-Vorgangs.
Urheberrechtlicher Kern: Modding zwischen § 69c UrhG und „bestimmungsgemäßer Benutzung“
Computerspiele sind rechtlich Mischwerke. Der urheberrechtliche Schutz betrifft Softwareanteile (§§ 69a ff. UrhG) ebenso wie Grafik, Musik, Texte und andere Werkbestandteile. Für die Praxis sind bei technischen Mods vor allem die Software-Regeln entscheidend. § 69c UrhG ordnet die ausschließlichen Rechte am Computerprogramm zu; dazu gehören insbesondere Vervielfältigung und Bearbeitung. § 69d UrhG erlaubt Handlungen, die zur bestimmungsgemäßen Benutzung erforderlich sind, etwa das Laden und Ablaufenlassen. § 69e UrhG eröffnet unter engen Voraussetzungen Dekompilierung zur Interoperabilität.
Diese Normen bilden den Rahmen, in dem sich technische Mods bewegen. Sobald ein Mod in Programmabläufe eingreift, Code patcht, in Speicherstrukturen injiziert, Debug-Schnittstellen nutzt oder Schutzmaßnahmen umgeht, stellt sich die Frage, ob dadurch eine zustimmungsbedürftige Bearbeitung oder eine sonstige urheberrechtlich relevante Nutzung entsteht. Wer argumentiert, ein Mod enthalte „keine Assets“ und „keinen Code“ des Spiels, zielt regelmäßig auf die Abwehr des Vorwurfs, es würden geschützte Inhalte vervielfältigt oder verbreitet. Das kann in bestimmten Konstellationen helfen, löst aber nicht automatisch das Problem der Bearbeitung und schon gar nicht das Problem einer möglichen Umgehung technischer Schutzmaßnahmen.
Für die praktische Risikoanalyse ist deshalb weniger die Frage entscheidend, ob der Mod „Dateien mitliefert“, sondern was technisch geschieht. Ein reiner Konfig-Layer, der zulässige Parameter setzt, ist rechtlich anders zu behandeln als ein Binary-Patch. Ein externes Tool, das Input-Devices umleitet oder ein Overlay rendert, ist anders zu bewerten als ein Hooking-System, das den Renderpfad verändert. Eine VR-Umsetzung liegt häufig im Bereich tiefer Eingriffe in Rendering und Camera-Handling. Je tiefer der Eingriff, desto eher rückt § 69c UrhG in den Fokus.
Gleichzeitig ist Modding im PC-Bereich seit Jahrzehnten ein faktischer Bestandteil der Nutzungskultur. Viele Nutzungsweisen werden von Rechteinhabern geduldet, ohne dass jede einzelne technische Handlung im Detail rechtlich geklärt wäre. Diese Duldung endet in der Praxis häufig nicht bei der Technik, sondern bei der Kommerzialisierung.
Markenrecht und Irreführung: Der Mod ist nicht nur „Code“
Neben Urheberrecht ist Markenrecht oft der zweite Stolperstein. Schon die Bezeichnung „Cyberpunk VR Mod“ oder ein Logo-Use kann markenrechtliche Anknüpfungspunkte schaffen, wenn der Eindruck entsteht, das Produkt sei offiziell, lizenziert oder gehöre zum Publisher-Ökosystem. Selbst wenn ein Mod technisch „clean“ wäre, kann Branding ein eigenständiges Risiko sein. Dazu kommen wettbewerbsrechtliche Fragen, wenn über Produktdarstellung, Kompatibilität oder „offiziellen“ Support getäuscht wird. Wer bezahlt, erwartet Qualität; wenn dann Konflikte öffentlich werden, reagiert ein Rechteinhaber häufig nicht nur aus IP-Interesse, sondern aus Marken- und Reputationsschutz.
In der Mandatspraxis zeigt sich: Die rechtliche Angriffsfläche entsteht selten durch eine einzige Norm. Meist ist es ein Bündel aus urheberrechtlicher Argumentation, EULA-Verstoß, Marken-Use und Plattformbedingungen. Je stärker monetarisiert wird, desto eher wird dieses Bündel gezogen.
Paywall, Abo, Early Access
Der Unterschied zwischen „Spenden“ und „Paywall“ ist nicht nur moralisch, sondern rechtlich und faktisch relevant. Eine Paywall koppelt den Zugang zu einem IP-nahen Produkt an Zahlung. Damit wird aus Fan-Nutzung ein kommerzielles Angebot. Genau an dieser Stelle wird Duldung politisch und wirtschaftlich unattraktiv: Ein Publisher muss fürchten, dass ein Parallelmarkt entsteht, der Support-Erwartungen erzeugt, Qualitätsprobleme auf die Marke abstrahlt und zudem einen Präzedenzfall setzt, der gegenüber anderen Creatorn schwer zu erklären ist.
„Spenden“ sind demgegenüber typischerweise so ausgestaltet, dass der Content frei bleibt und die Zuwendung freiwillig ist. Viele Guidelines tolerieren Spenden, weil sie wirtschaftlich weniger wie eine Verwertung des fremden IP-Werts wirken, sondern wie eine Anerkennung der Entwicklungsarbeit. Sobald aber „nur Supporter bekommen den Build“, „Early Access exklusiv“, „Abo für Updates“ oder ähnliche Modelle gewählt werden, entsteht faktisch ein entgeltlicher Zugang. Das Risiko steigt dann nicht nur rechtlich, sondern auch in der Durchsetzung: Plattformen reagieren bei Paywalls schneller, weil ein „kommerzialisierter Rechtekonflikt“ regelmäßig als höheres Risiko eingeordnet wird.
Gerade Abomodelle sind heikel. Ein Abo ist nicht nur eine Zahlungsart, sondern ein Versprechen auf fortlaufende Leistung. Damit verschiebt sich das Profil vom Hobby-Projekt zum kommerziellen Software-Service. Das kann zwar wirtschaftlich sinnvoll sein, verlangt aber eine sauberere Rechtsbasis. Wer Abo anbietet, muss damit rechnen, dass Rechteinhaber konsequenter durchgreifen, weil die Fortsetzung des Angebots unmittelbar betroffen ist und weil Umsätze als Anknüpfungspunkt für Schadensersatz-Argumentation genutzt werden können.
Darf Commerce überhaupt sein?
Bezahlte Mods können rechtlich möglich sein. In der Praxis sind dafür aber bestimmte Voraussetzungen nötig, weil sich sonst die klassische Frage stellt: „Wird hier fremdes IP wirtschaftlich verwertet?“ Drei Wege sind in der Realität tragfähig.
Der erste Weg ist der saubere: eine Lizenz oder Kooperation mit dem Rechteinhaber. Das kann individuell ausgehandelt werden, als Revenue-Share, als Whitelisting bestimmter Monetarisierungsformen oder über ein offizielles Creator-Programm. Entscheidend ist nicht die Bezeichnung, sondern dass die Nutzungsrechte für die konkrete Verwertung eingeräumt sind, einschließlich Distribution, Update-Mechanik und gegebenenfalls Marken-Use. Wer dieses Modell wählt, kann aus Modding ein echtes Geschäft machen, ohne permanent auf dem dünnen Eis der Duldung zu laufen.
Der zweite Weg sind offizielle Mod-Marktplätze oder kuratierte Plattformen. Wo Publisher selbst Monetarisierung ermöglichen, ist die Lizenzfrage typischerweise gelöst, weil die Regeln des Marktplatzes die Rechtekette abbilden. Das ist für Creator attraktiv, weil es Rechtssicherheit schafft; für Publisher ist es attraktiv, weil Qualität und Markenwahrnehmung steuerbar bleiben.
Der dritte Weg ist der schwierigste und gleichzeitig derjenige, der in Diskussionen oft gemeint ist: Monetarisierung eines Tools, das nicht als Bearbeitung des Spiels qualifiziert werden soll. Das kann theoretisch funktionieren, wenn tatsächlich keine geschützten Inhalte genutzt oder verbreitet werden, keine Schutzmaßnahmen umgangen werden und keine Vertragsbindung entgegensteht. In der Praxis ist dieser Weg konfliktträchtig, weil Publisher häufig argumentieren, dass der wirtschaftliche Wert des Tools gerade aus der Nutzung des Spiels entsteht und weil technische Details schnell in Bereiche führen, die urheberrechtlich oder vertraglich sensibel sind. Wer diesen Weg gehen will, braucht eine sehr genaue technische Dokumentation und eine sehr konservative Distribution, andernfalls wird die Diskussion schnell zur „Glaubensfrage“, die im Konfliktfall nicht mehr auf Social-Media, sondern über Unterlassungserklärungen entschieden wird.
„Fan Content“ – was ist das eigentlich?
Der Begriff „Fan Content“ ist kein juristischer Terminus, sondern eine Kategorie der Publisher-Kommunikation. Gemeint ist meist alles, was auf dem Spieluniversum basiert: Videos, Streams, Screenshots, Artworks, Cosplay, Musik-Covers, Memes, aber teilweise auch Mods. Rechtlich ist diese Kategorie heterogen. Ein Stream kann urheberrechtlich anders zu behandeln sein als ein Mod, der Programmabläufe verändert. Ein Meme kann in Schrankenfragen anders liegen als ein Asset-Bundle.
Deshalb ist es regelmäßig problematisch, wenn in Debatten ein Modder sagt: „Das ist kein Fan Content“, und ein Publisher sagt: „Doch, das ist Fan Content.“ Beide Aussagen sind oft kommunikativ, nicht dogmatisch. Juristisch ist entscheidend, welche Handlungen vorliegen. Ein Publisher kann einen Mod als „Fan Content“ bezeichnen, um die eigenen Guidelines darauf anzuwenden, und zugleich urheberrechtlich argumentieren, dass Bearbeitung/Distribution zustimmungsbedürftig ist. Der Modder kann „kein Fan Content“ sagen, um aus dieser Schublade herauszukommen, muss dann aber rechtlich erklären, warum keine Rechte berührt sind und warum keine Vertragsbindung greift. Das ist möglich, aber selten trivial.
Bindung ohne Vertrag: Bleibt dann nur Urheberrecht?
Wenn keine Vertragsbindung vorliegt, bleibt die rechtliche Bewertung tatsächlich primär im Immaterialgüterrecht. Das ist aber nicht „weniger gefährlich“, sondern oft sogar schärfer, weil Unterlassungsansprüche nicht davon abhängen, ob AGB wirksam einbezogen wurden. Urheberrechtlicher Unterlassungsanspruch setzt im Kern eine rechtswidrige Verletzungshandlung voraus; Vertragsrecht ist dann nur noch flankierend.
In der Praxis ist deshalb die Frage „hat der Modder die EULA akzeptiert“ häufig sekundär. Entscheidend ist, ob das Produkt auf fremder Schutzposition aufsetzt, ob es in geschützte Nutzungsarten eingreift und ob die Verwertung kommerziell ist. Kommerzielle Verwertung erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ein Gericht einen Eingriff als erheblich bewertet, erhöht den Streitwert und erhöht die Bereitschaft, nicht nur „freundlich“ zu kommunizieren, sondern formell vorzugehen.
Realistische Gestaltung für Creator: Einnahmen ohne Paywall – und trotzdem professionell
Der wirtschaftliche Druck ist nachvollziehbar: Ein anspruchsvoller Mod kostet Zeit, Wissen und laufende Pflege. Dennoch ist das Modell „Zugang nur gegen Zahlung“ in vielen Ökosystemen der klassische Trigger für Konflikte. Eine realistischere Gestaltung trennt die Ebenen: Der Mod bleibt frei zugänglich; Einnahmen entstehen über freiwillige Unterstützungen oder über Leistungen, die nicht den Zugang zum IP-nahen Produkt verkaufen. Support-Services, Custom-Setups, Kompatibilitätsarbeit, Beratung für Hardware-Setups, Priorisierung bestimmter Bugs über Bounty-Systeme oder Schulungen sind Beispiele, bei denen die wirtschaftliche Leistung stärker auf der eigenen Arbeit liegt und weniger auf der Ausschließlichkeit des Zugangs.
Auch hier bleibt die Grenze unscharf. Wer „Support“ verkauft, aber faktisch nur zahlenden Personen funktionierende Builds liefert, ist schnell wieder bei einer Paywall. Der Unterschied liegt nicht in der Überschrift, sondern in der tatsächlichen Struktur: bleibt die Kernfunktionalität frei oder wird sie wirtschaftlich exklusiv? Diese Frage wird im Konfliktfall sehr nüchtern beantwortet.
Realistische Gestaltung für Publisher: Warum Guidelines trotzdem sinnvoll sind
Publisher-Seite wird in Diskussionen oft als „willkürlich“ wahrgenommen. Tatsächlich sind Guidelines ein pragmatisches Instrument, um eine Community-Praxis zu steuern, ohne jedes Mal juristisch durchdeklinieren zu müssen, ob eine konkrete Nutzung im Detail zulässig wäre. Das ist auch im Interesse der Community: Ohne Guidelines bliebe nur harte Rechtsdurchsetzung oder völlige Unklarheit. Guidelines sind deshalb häufig nicht Ausdruck von „Fan-Feindlichkeit“, sondern ein Versuch, Kreativität zu ermöglichen und zugleich Kommerzialisierung zu kontrollieren.
Für Publisher kann ein Creator-Programm oder eine definierte Lizenzschiene sogar wirtschaftlich attraktiv sein. Wer aus Modding nachhaltige Qualität generiert, liefert Innovation und Kundenbindung. Der Konflikt entsteht meist nicht über „ob Mods“, sondern über „wer monetarisiert und wer kontrolliert“. Gerade VR-Mods sind dafür ein gutes Beispiel: Sie erweitern den Markt, können aber auch Support-Risiken und Markenrisiken erzeugen, wenn Erwartungen an „offizielle“ VR-Funktionalität entstehen.
Kommerzielles Modding ist kein „Wunschdenken“, aber es ist ein Lizenzthema. Sobald ein Geschäftsmodell ernsthaft skalieren soll, lohnt es sich, nicht am Rand der Duldung zu operieren, sondern gezielt eine Rechtebasis zu schaffen. Der rechtliche Hebel liegt dabei nicht nur im Urheberrecht, sondern im Gesamtpaket: Nutzungsrechte an Spielbestandteilen, Regelungen zur Distribution, Update-Pflichten, Haftung, Support-Abgrenzung, Marken-Use, Kommunikationsregeln, Umgang mit Sicherheitslücken, gegebenenfalls auch Compliance mit Plattformregeln. Bei Abomodellen kommen zusätzlich verbraucherrechtliche und vertragsrechtliche Fragen zur eigenen Produktseite hinzu, weil dann ein eigenständiges digitales Produkt angeboten wird, das wiederum Gewährleistungs-, Kündigungs- und Transparenzanforderungen auslösen kann.
Aus Mandatssicht ist wichtig, dass Verhandlungen mit Publishern nicht als „Bitte um Erlaubnis“ geführt werden sollten, sondern als Business-Case: Welche Nutzergruppen werden erschlossen, wie wird Support getrennt, wie werden Markenrisiken minimiert, welche Qualitätskontrolle wird akzeptiert, wie werden Sicherheitsrisiken gehandhabt, wie wird Revenue geteilt, wie werden Konflikte gelöst. Dort entsteht der Raum, in dem ein Modder vom Duldungsstatus in eine belastbare kommerzielle Position wechseln kann. Für Publisher wiederum ist interessant, wie Community-Innovation kanalisiert werden kann, ohne dass sich ein Wildwuchs an Paywalls bildet, der später schwer zu regulieren ist.
Was tun bei Takedown oder Abmahnung – ohne Dramaturgie
In der Praxis führt die erste Eskalation selten sofort vor Gericht. Häufig geht es zuerst um Entfernung, Umstellung des Monetarisierungsmodells oder eine nachträgliche Lizenzierung. Für Creator ist es entscheidend, nicht reflexartig zu reagieren. Wer vorschnell Unterlassungserklärungen abgibt, bindet sich langfristig. Wer trotzig eskaliert, riskiert hohe Streitwerte. Der sinnvollste Ansatz ist regelmäßig eine saubere Bestandsaufnahme: Welche technischen Handlungen liegen vor, welche Distributionswege wurden genutzt, welche Einnahmen wurden erzielt, welche Marken wurden verwendet, welche Disclaimer existieren, welche EULA- oder Guideline-Texte waren zum Zeitpunkt relevant. Daraus lässt sich eine realistische Verhandlungsposition entwickeln: Umstellung auf freie Distribution, Bereinigung von Branding, Lizenzanfrage oder Teil-Rückbau problematischer Komponenten.
Der häufigste Fehler ist, die Debatte rein über „keine Assets“ zu führen. Das ist ein Punkt, aber nicht der einzige. Das zweite Missverständnis ist, dass „Guidelines keine AGB sind“ automatisch heißt „Guidelines sind egal“. Das stimmt nicht. Wenn keine Vertragsbindung vorliegt, bleibt Urheber- und Markenrecht. Wenn Vertragsbindung vorliegt, kommt Vertragsrecht dazu. In beiden Fällen kann ein Publisher vorgehen; die Begründungsschiene verschiebt sich nur.
Fazit: Monetarisierung ist möglich – aber nicht „einfach so“
Der aktuelle Fall zeigt vor allem ein Muster: Technische Argumente („kein Asset, kein Code“) können in der Sache relevant sein, lösen aber den Konflikt nicht automatisch, wenn ein Geschäftsmodell gewählt wird, das aus Publisher-Sicht als kommerzielle Verwertung erscheint. Fan-Guidelines sind dabei kein Gesetz und binden nicht die Welt, aber sie definieren, welche Nutzung geduldet wird. Wer außerhalb dieses Rahmens agiert, landet schneller im formellen Durchsetzungsmodus, und dann wird nicht mehr über Community-Kultur, sondern über Unterlassung und Rechtekette gesprochen.
Kommerzielles Modding ist realistisch, wenn eine Lizenzbasis geschaffen wird oder wenn die Monetarisierung so gestaltet ist, dass nicht der Zugang zu IP-naher Funktionalität verkauft wird. Abomodelle sind besonders sensibel, weil sie eine dauerhafte kommerzielle Leistung versprechen und damit den Konflikt strukturell verstärken. In der Praxis ist deshalb der nachhaltigste Weg entweder die Kooperation mit dem Rechteinhaber oder ein Modell, das freie Distribution und eigene Dienstleistungen sauber trennt.
Wer als Creator oder Studio in diesem Feld planbar agieren will, braucht weniger „Hot Takes“ und mehr Vertragsarchitektur. Genau dort entsteht auch der Mandatswert: nicht im Kommentieren von Einzelfällen, sondern im Aufsetzen einer belastbaren Monetarisierungs- und Lizenzstrategie, die sowohl Community-Interessen als auch IP-Interessen abbildet.