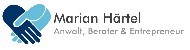Gerichtsstandsklauseln werden in vielen Verträgen wie ein Routine-Baustein behandelt. Ein Satz, einmal aus einem alten Muster übernommen, kurz angepasst, fertig. Der Fall, den das Kammergericht Anfang 2026 entschieden hat, zeigt sehr plastisch, warum genau diese Bequemlichkeit teuer werden kann: Nicht, weil Gerichtsstände „kompliziert“ wären – sondern weil Unschärfe im Vertragstext Gerichten die Tür öffnet, den Vertrag interessen- und vollstreckungsorientiert auszulegen.
Die Entscheidung: „Gerichtsstand gilt Vaduz“ – und trotzdem Zuständigkeit deutscher Gerichte
Am 08.01.2026 hat das Kammergericht Berlin (2. Zivilsenat) unter dem Aktenzeichen 2 U 20/25 ein Urteil zur internationalen Zuständigkeit und zur Auslegung einer Gerichtsstandsvereinbarung gefällt.
Ausgangspunkt war eine Klausel, die sinngemäß formuliert war wie: „Als Gerichtsstand gilt das Landgericht Vaduz.“ Der Streit entzündete sich daran, ob diese Formulierung einen ausschließlichen Gerichtsstand begründet (dann wären deutsche Gerichte grundsätzlich „draußen“) oder ob Vaduz nur als zusätzlicher Gerichtsstand gemeint war (dann bleibt Klage auch am sonst zuständigen Gericht möglich).
Das Kammergericht hat die Klausel nicht als exklusiv verstanden. In der veröffentlichten Kurzbeschreibung wird ausdrücklich herausgestellt, dass der Wortlaut nicht zwingend auf Ausschließlichkeit hindeutet – etwa mit der Passage: „…deutet auch der Wortlaut … nicht auf eine Ausschließlichkeit hin.“
Das ist der erste wichtige Punkt für die Vertragsgestaltung: „Gerichtsstand gilt …“ ist nicht dasselbe wie „ausschließlicher Gerichtsstand ist …“. Wer Exklusivität will, muss Exklusivität klar formulieren.
Auslegung nach §§ 133, 157 BGB: Nicht „Wortklauberei“, sondern objektiver Sinn
Juristisch läuft der Streit über die klassische Vertragsauslegung: Maßgeblich ist, wie eine Erklärung nach Treu und Glauben und mit Rücksicht auf die Verkehrssitte zu verstehen ist (§§ 133, 157 BGB). Der Wortlaut ist Ausgangspunkt, aber nicht Endpunkt. Gerade bei Gerichtsstandsvereinbarungen kommt hinzu, dass die Regelung nicht im luftleeren Raum steht, sondern in eine prozessuale Realität hineinwirkt: Zuständigkeit ist nur dann praktisch wertvoll, wenn am Ende ein Titel verwendbar ist.
Genau hier wird die Entscheidung interessant, weil sie ein typisches Auslegungsmuster sichtbar macht, das in der Praxis häufig unterschätzt wird: Wenn eine Klausel sprachlich „irgendwie“ passt, aber bei strenger Exklusivität wirtschaftlich oder prozessual in eine Sackgasse führt, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Gerichte die Klausel nicht als ausschließend lesen.
Das ist kein „Trick“, sondern konsequente Anwendung von Auslegungsregeln: Eine Auslegung, die den Vertrag in zentralen Punkten funktionslos macht, ist für „redliche und verständige“ Vertragspartner regelmäßig fernliegend.
Das Vollstreckbarkeits-Argument: Warum der Vertrag nicht in einer praktischen Sackgasse enden darf
Die entscheidende (und für die Praxis lehrreiche) Begründungsschiene ist die Vollstreckbarkeit. Der Hintergrund ist bekannt, wird aber im Vertragsalltag oft verdrängt: Zwischen Deutschland und Liechtenstein besteht typischerweise keine unkomplizierte Anerkennungs- und Vollstreckungsbrücke für staatliche Urteile wie innerhalb der EU. In der deutschen Diskussion wird seit Jahren darauf verwiesen, dass Urteile aus dem Fürstentum Liechtenstein mangels verbürgter Gegenseitigkeit grundsätzlich nicht anerkennungsfähig sind (§ 328 Abs. 1 Nr. 5 ZPO).
Damit ist die wirtschaftliche und prozessuale Konsequenz naheliegend: Ein exklusiver Gerichtsstand bei einem Gericht in Liechtenstein kann – je nach Vollstreckungsort und Vermögenslage – dazu führen, dass am Ende zwar ein Urteil existiert, aber im Inland nicht sinnvoll durchgesetzt werden kann. Für die Auslegung kann das als starkes Indiz gegen eine „wirklich gewollte“ Ausschließlichkeit dienen. Genau dieses Indiz spielt im Umfeld der Entscheidung eine zentrale Rolle.
Parallel dazu kommt der systemische Kontext: Das Lugano-Übereinkommen 2007 bildet eine Anerkennungs- und Vollstreckungsbrücke zwischen EU und bestimmten EFTA-Staaten (u. a. Schweiz, Norwegen, Island). Dass Landgericht Vaduz in einem Staat liegt, der nicht Vertragsstaat dieses Instruments ist, wird in der Literatur ausdrücklich als Vollstreckungsproblem beschrieben.
Die praktische Botschaft lautet: Gerichtsstand ist kein reines „Forum Shopping“-Thema, sondern Teil der Durchsetzungskette. Ein Vertrag, der zwar einen schönen Gerichtsstand benennt, aber den Titel am Ende im Zielstaat nicht effizient durchsetzbar macht, ist kein „starker Vertrag“, sondern ein Risiko.
Vertragsmuster und Formulierungsdisziplin: Warum ein einziges Wort die Prozessstrategie dreht
Genau an dieser Stelle wird sichtbar, warum saubere Formulierung keine Stilfrage ist. Der Unterschied zwischen
„Gerichtsstand gilt Vaduz“
und
„Ausschließlicher Gerichtsstand ist Vaduz, unter Ausschluss aller anderen Gerichtsstände“
ist nicht akademisch. Er entscheidet darüber, ob eine Partei sich am Anfang des Streits mit einer Zuständigkeitsrüge verteidigen kann, ob ein Verfahren verzögert wird, ob Kosten in Vorfragen verbrannt werden – und ob am Ende ein Titel überhaupt praktikabel verwertbar ist.
Viele Vertragsmuster bleiben in der Mitte stehen: Sie wollen „bestimmt“ klingen, vermeiden aber die klaren Triggerwörter, die rechtlich wirklich festlegen, was gemeint ist. Das produziert genau die Zone, in der Gerichte dann auslegen müssen. Und wenn Gerichte auslegen, wird nicht selten nach Plausibilität, Interessenlage und praktischer Wirksamkeit entschieden – gerade bei Klauseln, die den Zugang zur staatlichen Gerichtsbarkeit strukturieren.
Der Berliner Fall ist deshalb so instruktiv, weil er ein Muster offenlegt, das in IT-, SaaS- und Medienverträgen besonders häufig vorkommt: internationale Parteien, grenzüberschreitende Leistungen, Vermögenswerte im Inland, aber „importierte“ Gerichtsstandstexte, die aus einem ganz anderen Kontext stammen (Finanz-/Vermögensverwaltung, ältere Standardbedingungen, internationale Holding-Strukturen). Wenn dann der Streit vor der Tür steht, wird aus einem Einzeiler eine strategische Sollbruchstelle.
Konsequenzen für IT- und SaaS-Verträge: Zuständigkeit, Vollstreckung, Streitbeilegung als Paket denken
Für Verträge im Tech-Umfeld – insbesondere bei SaaS, Agentur-Setups, internationalen Freelancern, Plattform- und Lizenzmodellen – ist die Entscheidung ein guter Anlass, Standardannahmen zu überprüfen:
Wer einen ausländischen exklusiven Gerichtsstand vereinbart, sollte nicht nur fragen „klingt das international?“, sondern „wo liegt das Vermögen, wo soll vollstreckt werden, wie wird der Titel dort durchgesetzt?“. Wenn die Antwort lautet „im Zweifel in Deutschland“, ist eine Klausel riskant, die die Parteien prozessual in ein Forum zwingt, dessen Urteil im Inland nur mit erheblicher Reibung oder gar nicht verwertbar ist.
Wo internationale Neutralität gewollt ist, kann Streitbeilegung strukturell anders gelöst werden, etwa über Schiedsverfahren (mit besserer internationaler „Transportfähigkeit“ von Schiedssprüchen, Stichwort New-York-Übereinkommen) – dann allerdings mit der Konsequenz, dass das gesamte Streitbeilegungsdesign sauber gebaut werden muss (Schiedsort, Institution/Regeln, Sprache, einstweiliger Rechtsschutz, Kosten). Dass das New-York-Übereinkommen in Liechtenstein im Landesrecht umgesetzt ist, zeigt jedenfalls, dass die schiedsrechtliche Schiene dort normativ verankert ist. (gesetze.li)
Der eigentliche Wert liegt in der Methodik: Gerichtsstandsklauseln gehören nicht ans Ende der Verhandlung („egal, Hauptsache drin“), sondern in die Risikoarchitektur. Gerade in IT-Verträgen, in denen Streit häufig mit schnellen Maßnahmen (Unterlassung, Sperrung, Herausgabe, einstweilige Verfügung) zusammenhängt, ist eine unscharfe oder praktisch untaugliche Zuständigkeitsregelung ein echter Business-Impact.
Schluss: Verträge sind keine Deko – sondern Prozessvermeidung
Die Entscheidung des Kammergerichts ist in einem Satz zusammengefasst: Eine Gerichtsstandsklausel, die sprachlich nicht eindeutig exklusiv ist und die bei strenger Exklusivität praktisch in eine Vollstreckungs-Sackgasse führen würde, wird eher nicht als ausschließend ausgelegt.
Das ist keine Einladung, unpräzise zu schreiben – im Gegenteil. Es ist ein Hinweis darauf, was passiert, wenn ein Vertrag an einer Stelle unpräzise bleibt, an der Präzision billig und Streit teuer ist. Gerade Vertragsmuster sollten deshalb nicht als „bewährte Texte“ behandelt werden, sondern als Werkzeuge, die regelmäßig gegen Geschäftsmodell, Parteienstruktur und Durchsetzungskette getestet werden müssen.
Wenn ein Folgeartikel sinnvoll sein soll, bietet sich als nächster Schritt eine kurze, praxistaugliche Klausel-Logik an (exklusiv / nicht exklusiv / Schiedsgericht) jeweils mit typischen SaaS-Szenarien (B2B, internationaler Kunde, Holding-Struktur, Freelancer-Setup) – mit Formulierungen, die die Ausschließlichkeit wirklich eindeutig machen, statt sie nur zu suggerieren.