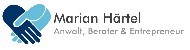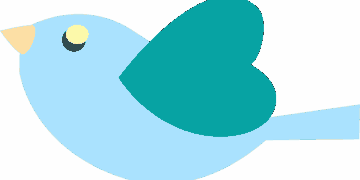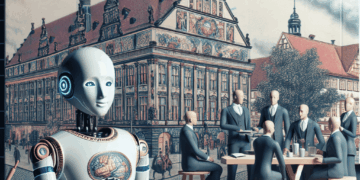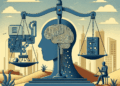Einleitung
In einem aktuellen Urteil hat das Landgericht Hamburg eine Entscheidung getroffen, die für Aufsehen in der juristischen Landschaft sorgt. Das Gericht schloss sich der Rechtsmeinung des OLG Celle an und erklärte einen „Coaching“-Vertrag für nichtig, da die Klägerin nicht über die erforderliche Zulassung nach dem Fernunterrichtsschutzgesetz (FernUSG) verfügte. Dieses Urteil steht im Kontrast zu Entscheidungen des Kammergerichts in Berlin und des OLG Frankfurt am Main, die sich explizit nicht dieser Rechtsmeinung anschließen. In einem Blogpost von gestern habe ich bereits die divergierende Rechtsprechung der Oberlandesgerichte zum FernUSG in B2B-Verträgen diskutiert. Der heutige Beitrag beleuchtet die Entscheidung des Landgerichts Hamburg und wägt sie gegen die Argumente des Kammergerichts in Berlin und des OLG Frankfurt am Main ab.
Die Entscheidung des Landgerichts Hamburg
Das Landgericht Hamburg kam zu dem Schluss, dass der „Coaching“-Vertrag zwischen den Parteien gemäß § 7 Abs. 1 in Verbindung mit § 12 Abs. 1 Satz 1 des Fernunterrichtsschutzgesetzes (FernUSG) nichtig ist. In der Begründung führte das Gericht mehrere wichtige Punkte an. Zunächst stellte es fest, dass das Angebot der Klägerin als Fernunterrichtsvertrag zu qualifizieren ist. Dies ist von Bedeutung, da die Klägerin nicht über die erforderliche Zulassung gemäß § 7 Abs. 1 FernUSG verfügte, was die Nichtigkeit des Vertrags zur Folge hat.
Ein weiterer zentraler Punkt in der Entscheidung war die Anwendbarkeit des FernUSG selbst. Das Gericht betonte, dass das Gesetz nicht nur für Verbraucher, sondern auch für Unternehmer gilt. Dies ist eine wichtige Klarstellung, da es in der Rechtsprechung unterschiedliche Auffassungen zur Anwendbarkeit des FernUSG in B2B-Verhältnissen gibt. Das Landgericht Hamburg schloss sich hier der Rechtsmeinung des OLG Celle an, welches ebenfalls die Auffassung vertritt, dass das FernUSG unabhängig von der Eigenschaft der Vertragsparteien als Verbraucher oder Unternehmer anwendbar ist.
Diese Entscheidung des Landgerichts Hamburg ist insofern bemerkenswert, als sie eine klare Linie in der bisher uneinheitlichen Rechtsprechung zu ziehen versucht und die Anwendbarkeit des FernUSG auf eine breite Palette von Verträgen ausdehnt.
Argumente des Kammergerichts in Berlin und des OLG Frankfurt am Main
Das Kammergericht in Berlin und das OLG Frankfurt am Main stehen der Anwendbarkeit des Fernunterrichtsschutzgesetzes (FernUSG) in B2B-Verträgen kritisch gegenüber. Das Kammergericht in Berlin argumentiert, dass das Gesetz „aufgrund des vom Gesetzgeber verfolgten Zweckes eben nur auf Verbraucher Anwendung finden kann.“ Es stellt klar, dass ein Unternehmer sich nicht auf die fehlende Zulassung des Anbieters berufen könne, was die Nichtigkeit des Vertrags ausschließen würde. Das OLG Frankfurt am Main legt Wert darauf, dass „die spezifischen Umstände des Einzelfalls berücksichtigt werden müssen.“
Beide Gerichte nehmen auch Bezug auf die historische Entwicklung des Gesetzes. Das Kammergericht in Berlin weist darauf hin, dass der Begriff des „Verbrauchers“ im Jahr 1975 nicht gleichzusetzen ist mit dem Begriff des Verbrauchers im Jahr 2023. Es argumentiert, dass „ein eingetragener Kaufmann und ein Formkaufmann nach der Historie des Gesetzes nicht auf den Schutz durch das FernUSG berufen können, während alle anderen – nicht im Handelsregister eingetragenen Unternehmen – dies könnten.“
Diese differenzierten Ansichten der Gerichte zeigen die Komplexität der Rechtsfrage und die Notwendigkeit einer Klärung durch den Bundesgerichtshof. Die divergierenden Interpretationen des FernUSG durch die Gerichte unterstreichen die Dringlichkeit einer höchstrichterlichen Entscheidung, um Rechtssicherheit in diesem Bereich zu schaffen. Es bleibt abzuwarten, wie der Bundesgerichtshof diese komplexe Rechtsfrage letztlich klären wird.
Fazit
Die divergierenden Entscheidungen der Gerichte zeigen, dass es an der Zeit ist, dass der Bundesgerichtshof in dieser Angelegenheit für Klarheit sorgt. Bis dahin bleibt die Rechtslage unklar, und Unternehmen sollten vorsichtig sein, wenn sie Fernunterrichtsverträge abschließen, ohne die erforderliche Zulassung zu haben. Diese Unsicherheit birgt nicht nur rechtliche Risiken, sondern kann auch das Vertrauen in die Rechtsprechung und die Integrität des Marktes für Fernunterrichtsdienstleistungen untergraben. Darüber hinaus könnte die anhaltende Uneinigkeit der Gerichte dazu führen, dass Unternehmen vermehrt auf alternative Vertragsmodelle ausweichen, die möglicherweise weniger Schutz für die Vertragsparteien bieten. Die aktuelle Situation stellt somit nicht nur für die beteiligten Parteien, sondern auch für die gesamte Branche eine Herausforderung dar. Es ist daher im Interesse aller Beteiligten, dass der Bundesgerichtshof bald eine klare und verbindliche Entscheidung trifft.