Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Start meines Youtube-Kanals
Ich hatte es mir im vergangenen Jahr schon einige Male vorgenommen, aber letztendlich haben mich meine kleine, neu geborene Tochter,...
Mehr lesenDetailsDer EuGH wird sich in einem Vorlageverfahren mit interessanten Fragen aus dem Filesharingbereich beschäftigen, die auch Rechtsfragen in Deutschland betreffen könnten. Wie genau, bleibt abzuwarten.
Die Klägerin Mircom aus Belgien ist Inhaberin von Verwertungsrechen an einer Reihe von pornografischen Filmen, produziert jedoch weder Pornos, noch vertreibt diese Pornos. Mircom widmet sich nur Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen gegen vermeintliche Verletzer, die diese zum Teil an die Produzenten zurücküberweist.
Um diese Ansprüche geltend zu machen, möchte Mircom Nutzerdaten des Internetanbietern Telnet herausverlangen. Weil Telnet dies verweigerte, kam es zum Prozess. Im Rahmen dieses Verfahrens kamen Fragen zum Begriff der öffentlichen Wiedergabe nach Unionsrecht, Fragen aus Datenschutzrecht und Fragen aufgrund des Umstandes, dass Mircom selbst keine Videos vertreibt, auf.
Diese Fragen soll nun der EuGH in einem Vorabentscheidungsersuchen gemäß Art. 98 Abs. 1 der Verfahrensordnung des Gerichtshofs klären.
1.a) Ist das Herunterladen einer Datei über ein „Peer-to-Peer“-Netz und das gleichzeitige Bereitstellen zum Hochladen („Seeden“) von (bisweilen im Verhältnis zum Ganzen sehr fragmentarischen) Teilen („Pieces“) davon als öffentliche Wiedergabe im Sinne von Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29 zu betrachten, obwohl diese einzelnen „Pieces“ als solche unbrauchbar sind?
Falls ja:
b) Gibt es eine Bagatellgrenze, ab der das „Seeden“ dieser „Pieces“ eine öffentliche Wiedergabe darstellen würde?
c) Ist der Umstand relevant, dass das „Seeden“ automatisch (infolge der Einstellungen des „Torrent-Clients“) und daher vom Nutzer unbemerkt erfolgen kann?
2.a) Kann eine Person, die vertragliche Inhaberin von Urheberrechten (oder verwandten Rechten) ist, diese Rechte aber nicht selbst nutzt, sondern lediglich Schadensersatzansprüche gegen vermeintliche Verletzer geltend macht – deren Geschäftsmodell somit vom Bestehen von Produktpiraterie anstatt von deren Bekämpfung abhängt – die gleichen Rechte in Anspruch nehmen, wie sie Kapitel II der Richtlinie 2004/48 Urhebern oder Lizenznehmern zuerkennt, die Urheberrechte auf normale Art und Weise nutzen?
b) Wie kann der Lizenznehmer in diesem Fall einen „Schaden“ (im Sinne von Art. 13 der Richtlinie 2004/48) durch die Rechtsverletzung erlitten haben?
3. Sind die in den Fragen 1 und 2 erläuterten konkreten Umstände im Rahmen der Interessenabwägung zwischen der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums einerseits und der durch die Charta gewährleisteten Rechte und Freiheiten wie der Achtung des Privatlebens und des Schutzes personenbezogener Daten andererseits, insbesondere im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung, relevant?
4. Ist die systematische Registrierung und allgemeine Weiterverarbeitung der IP-Adressen eines „Schwarms“ von „Seedern“ (durch den Lizenznehmer selbst und in dessen Auftrag durch einen Dritten) unter all diesen Umständen nach der Datenschutz-Grundverordnung, konkret nach deren Art. 6 Abs. 1 Buchst. f, gerechtfertigt?
Marian Härtel ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für IT-Recht mit einer über 25-jährigen Erfahrung als Unternehmer und Berater in den Bereichen Games, E-Sport, Blockchain, SaaS und Künstliche Intelligenz. Seine Beratungsschwerpunkte umfassen neben dem IT-Recht insbesondere das Urheberrecht, Medienrecht sowie Wettbewerbsrecht. Er betreut schwerpunktmäßig Start-ups, Agenturen und Influencer, die er in strategischen Fragen, komplexen Vertragsangelegenheiten sowie bei Investitionsprojekten begleitet. Dabei zeichnet sich seine Beratung durch einen interdisziplinären Ansatz aus, der juristische Expertise und langjährige unternehmerische Erfahrung miteinander verbindet. Ziel seiner Tätigkeit ist stets, Mandanten praxisorientierte Lösungen anzubieten und rechtlich fundierte Unterstützung bei der Umsetzung innovativer Geschäftsmodelle zu gewährleisten.
Ich hatte es mir im vergangenen Jahr schon einige Male vorgenommen, aber letztendlich haben mich meine kleine, neu geborene Tochter,...
Mehr lesenDetailsImmer häufiger bieten Fahrzeughändler heute ihre Fahrzeuge im Internet auf entsprechenden Plattformen an. Der Kontakt mit dem Verbraucher, der sich...
Mehr lesenDetailsIch bin gerade auf ein paar Irrtümer gestoßen, die nach der Zustimmung zur Urheberrechtslinie, bei Politikern durch den Verstand geistern....
Mehr lesenDetailsAuch wenn es immer so eine Sache ist, etwas ein neues Rechtsgebiet zu nennen, aber spätestens mit der zweiten Esport-Recht...
Mehr lesenDetailsDie rasant pulsierende Welt der Start-ups ist ein Ort, an dem Träume wahr werden können, wo innovative Gedankenströme unaufhaltsam hervorbrechen,...
Mehr lesenDetailsWorum geht es? Bei dem „Keyword-Advertising“ buchen Werbende sogenannte Keywords bei einem Suchmaschinenbetreiber, bei deren Eingabe die von ihnen erworbenen...
Mehr lesenDetailsLetztes Jahr ging die Geoblocking Verordnung an den Start (siehe diesen Beitrag) und bei einem Verstoß können durchaus empfindliche Bußgelder...
Mehr lesenDetailsLiebe Leser, aktuell suche ich einen Rechtsreferendar oder einen Studenten, der Interesse am IT-Recht hat und im Bereich Gaming, Urheberrecht,...
Mehr lesenDetailsDas Thema der Quellensteuer beim Buchen von Werbung im Internet, allen voran bei Google, kocht in den letzten Wochen recht...
Mehr lesenDetailsInzwischen ist der Influencer-Markt steuerlich kein Sonderfall mehr, sondern ein klar erkennbares Geschäftsmodell. Das zeigt sich besonders deutlich am Beispiel...
Mehr lesenDetails Absichtserklärung (Letter of Intent) für Startup-Investments
Absichtserklärung (Letter of Intent) für Startup-Investments
inkl. MwSt.
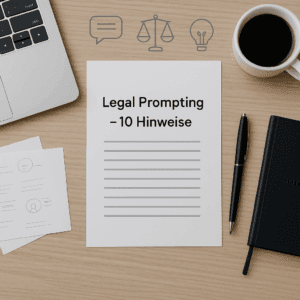 1 Pager „10 wichtigste Hinweise zum Legal Prompting
0,00 €
1 Pager „10 wichtigste Hinweise zum Legal Prompting
0,00 €inkl. MwSt.
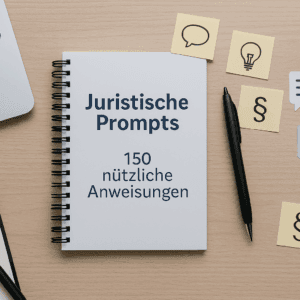 Juristische Prompts - 150 nützliche Anweisungen für jedes LLM
5,99 €
Juristische Prompts - 150 nützliche Anweisungen für jedes LLM
5,99 €inkl. MwSt.
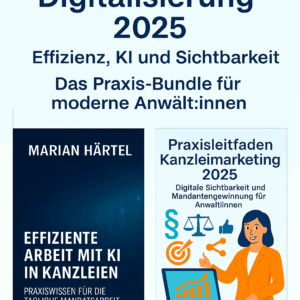 Kanzlei-Digitalisierung 2025: Effizienz, KI und Sichtbarkeit – Das Praxis-Bundle für moderne Anwält:innen
89,99 €
Kanzlei-Digitalisierung 2025: Effizienz, KI und Sichtbarkeit – Das Praxis-Bundle für moderne Anwält:innen
89,99 €inkl. MwSt.
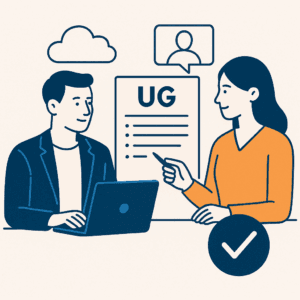 Mustersatzung für eine UG (haftungsbeschränkt)
0,00 €
Mustersatzung für eine UG (haftungsbeschränkt)
0,00 €inkl. MwSt.
In dieser aufschlussreichen knapp 20-minütigen Podcast-Episode von und mit mir wird das komplexe Thema des Urheberrechts im digitalen Zeitalter beleuchtet....
Mehr lesenDetailsIn diesem Video rede ich ein wenig über transparente Abrechnung und wie ich kommuniziere, was es kostet, wenn man mit...
Mehr lesenDetails


















